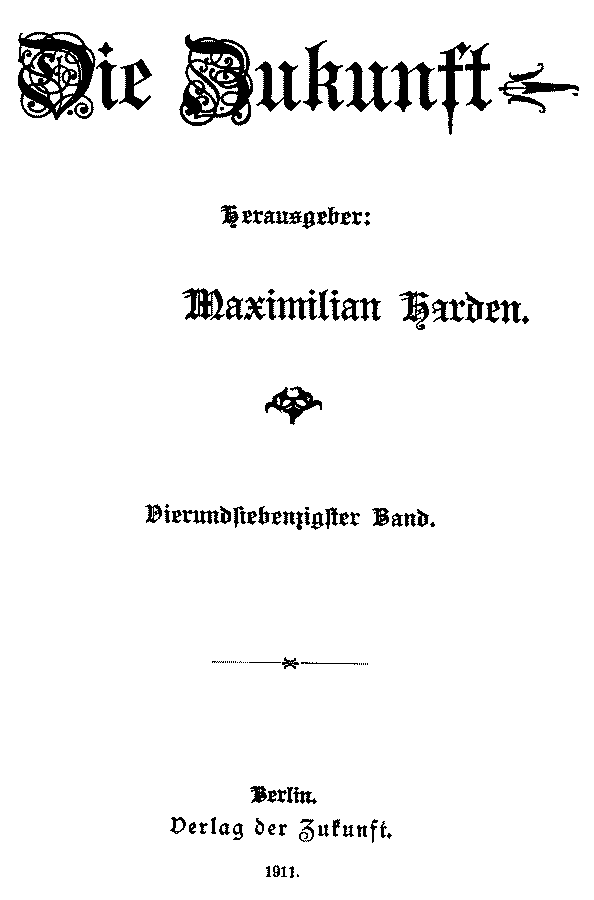
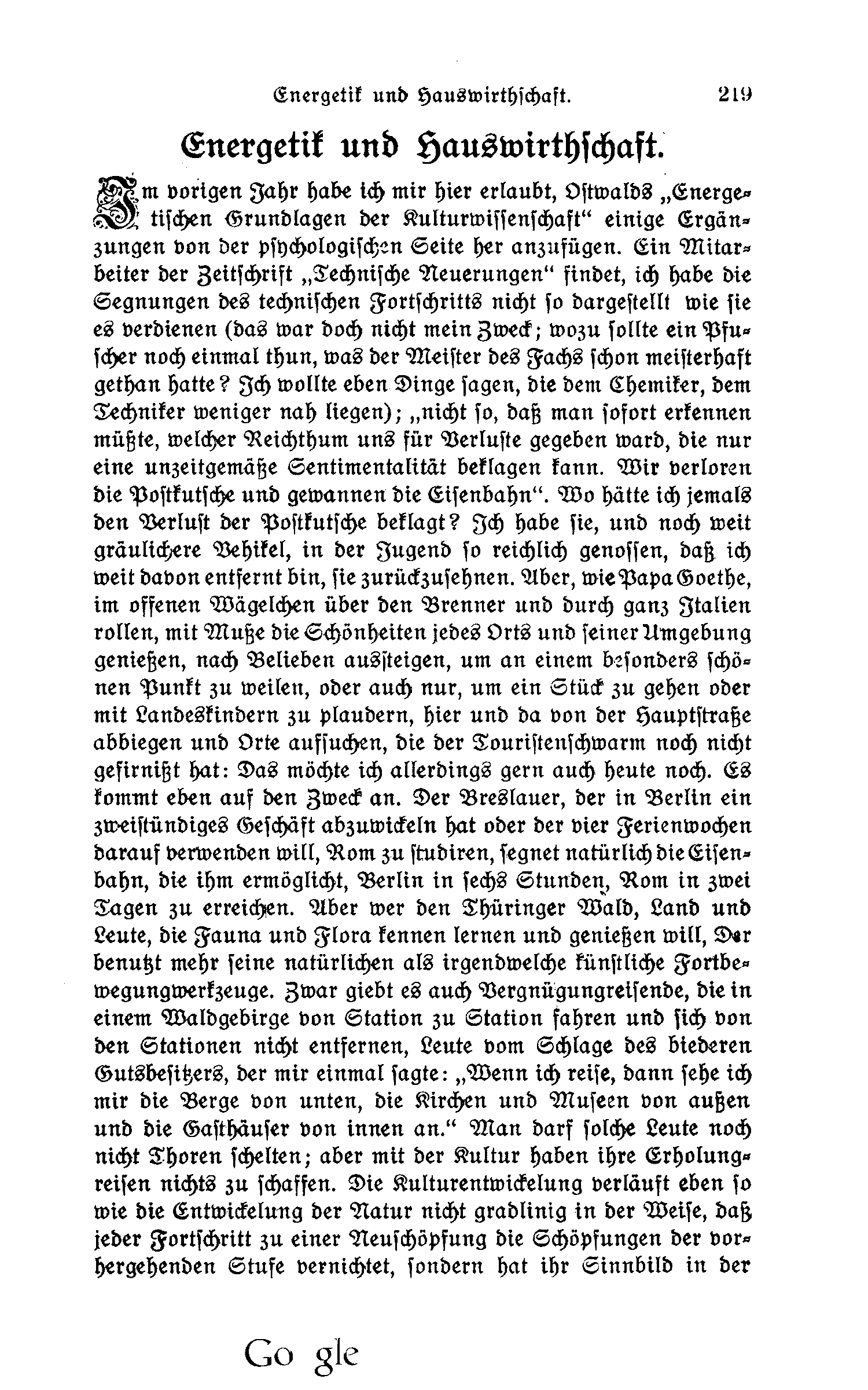
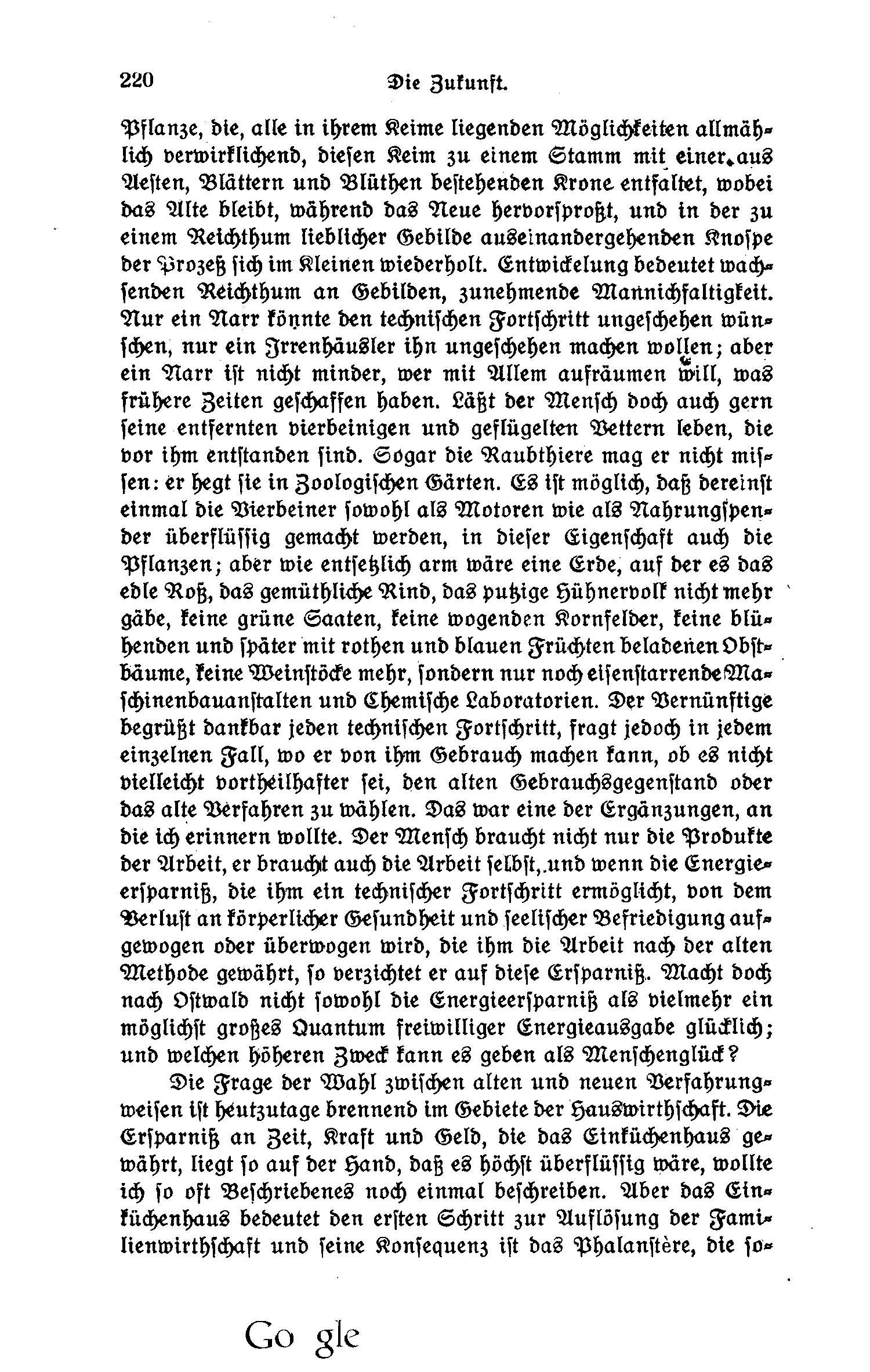
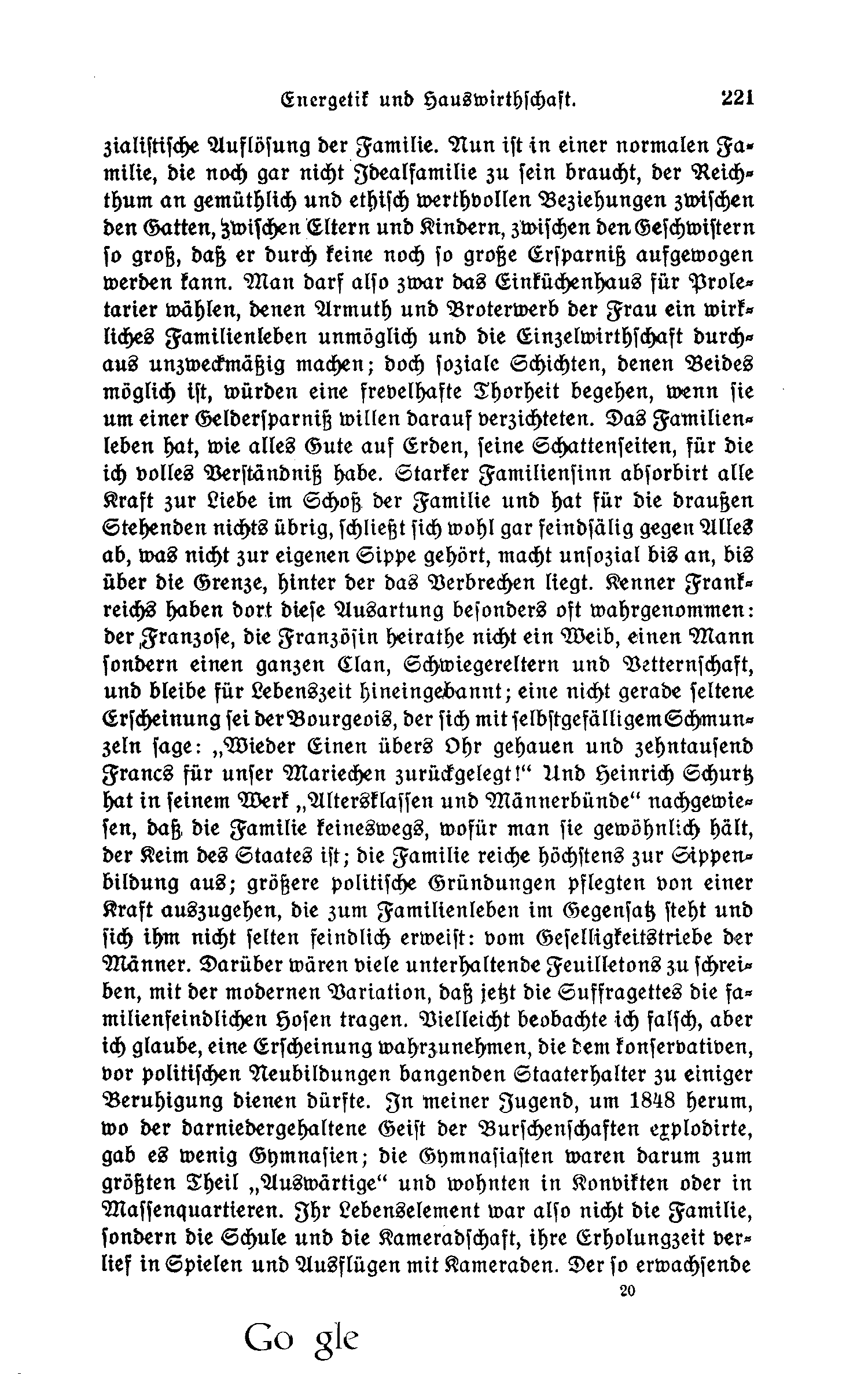
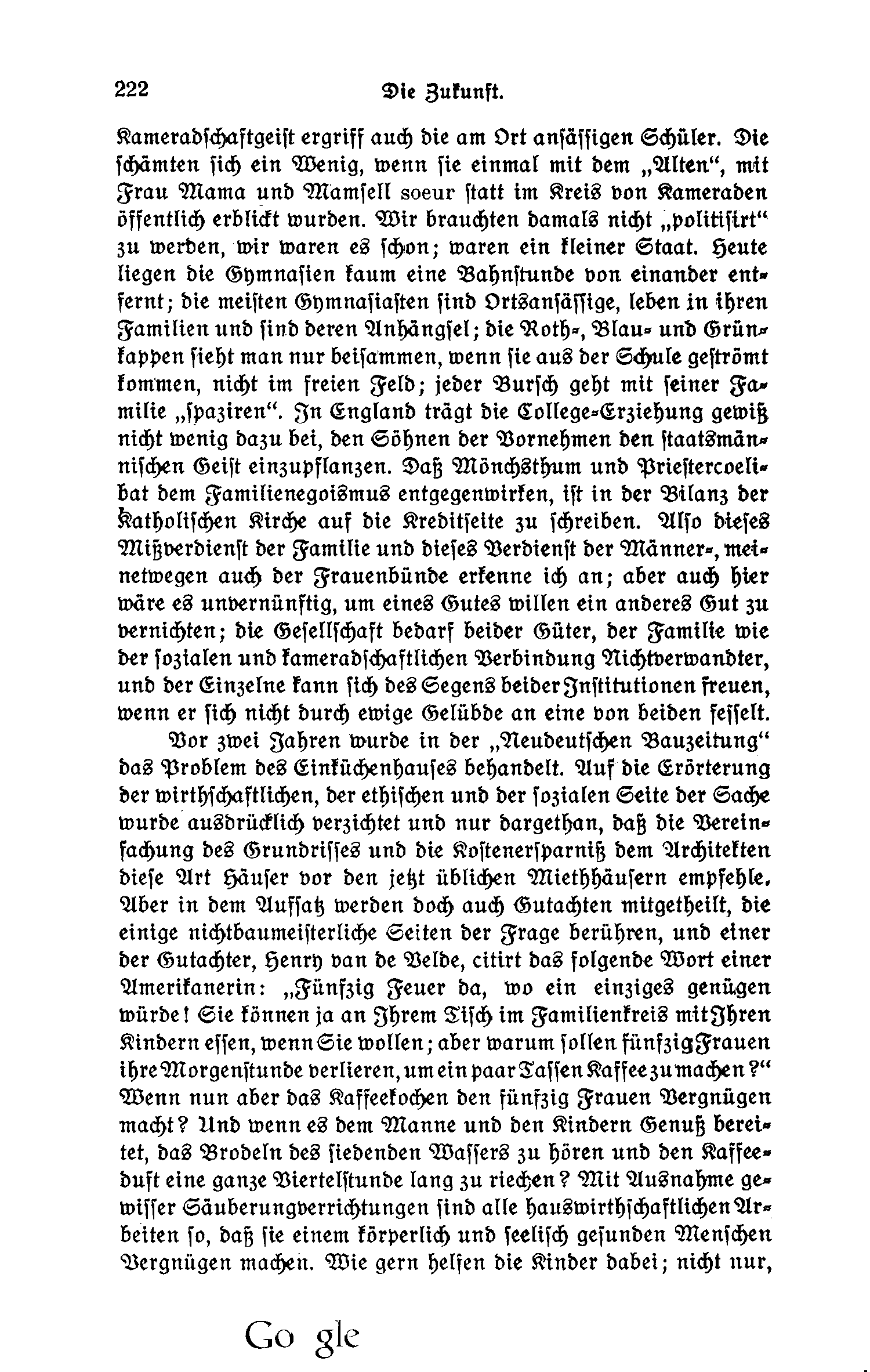
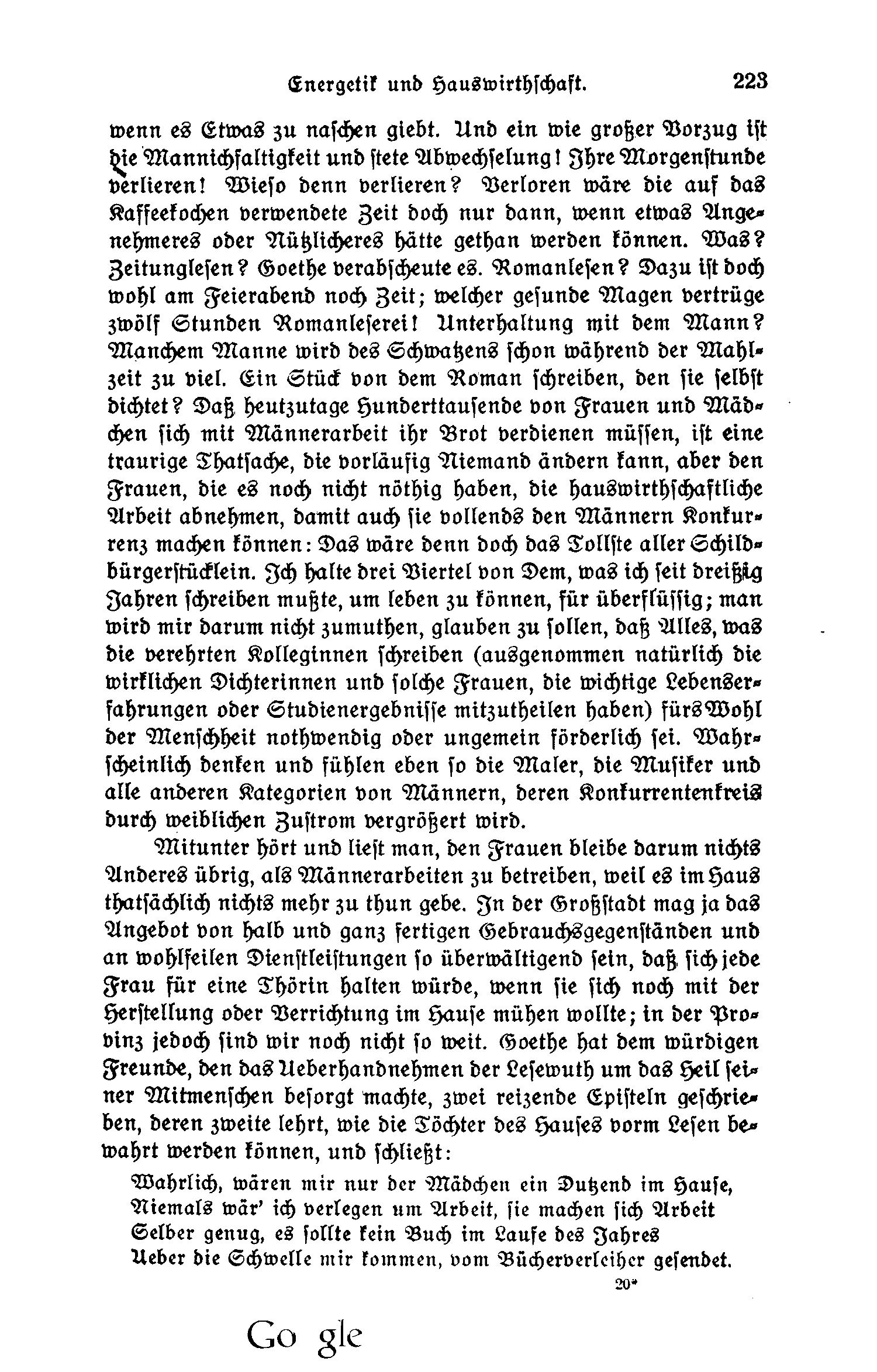
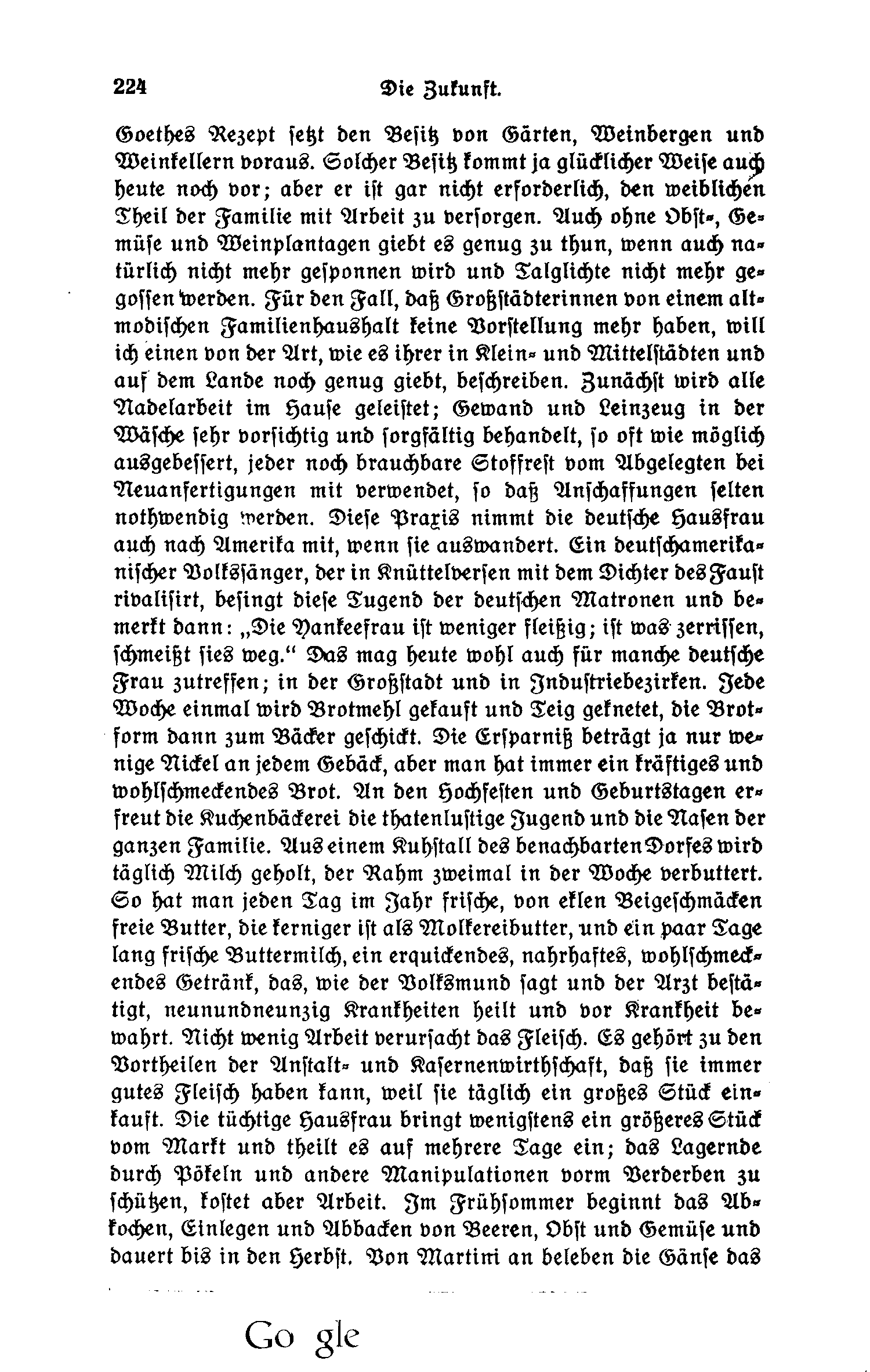
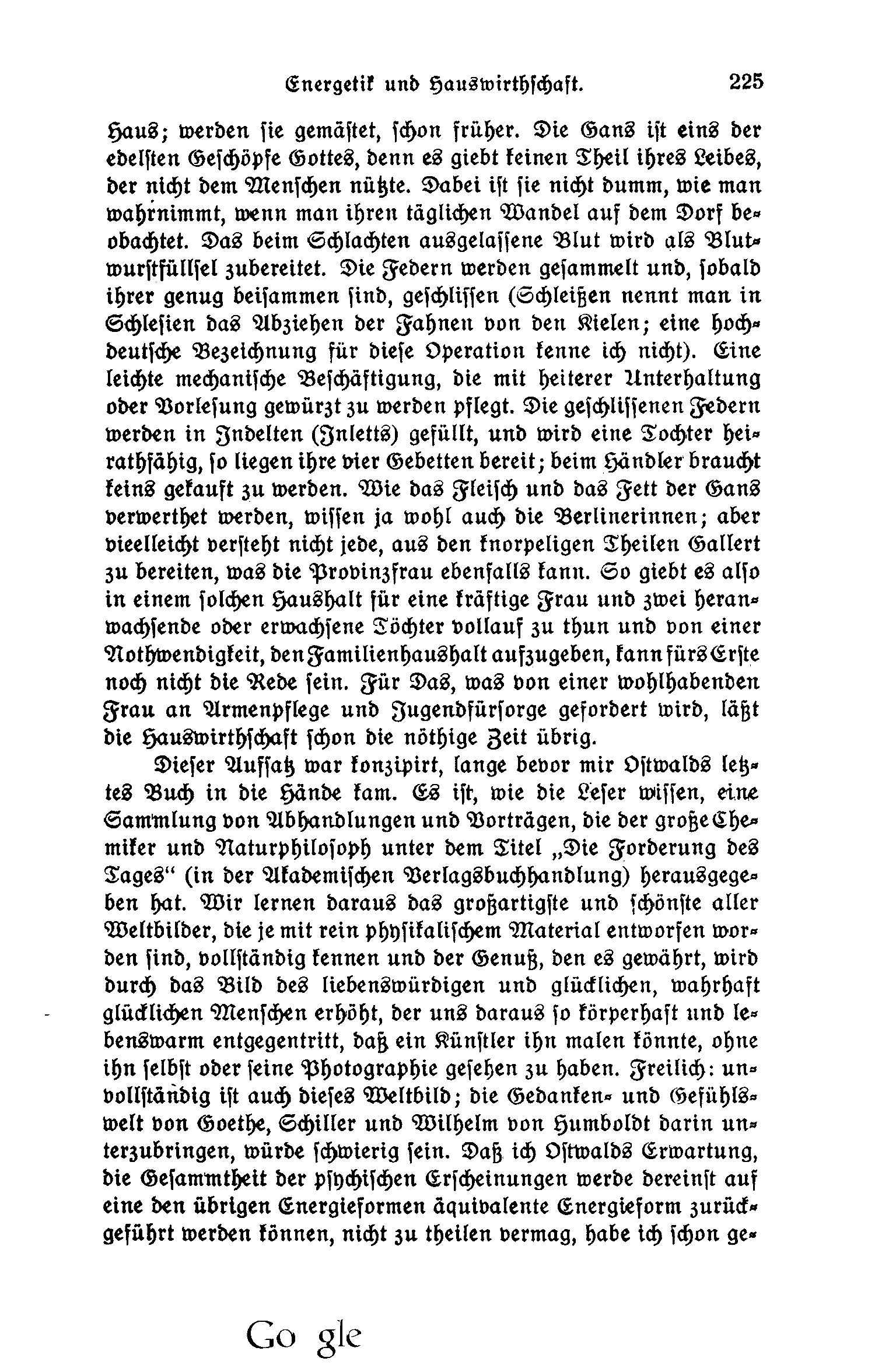
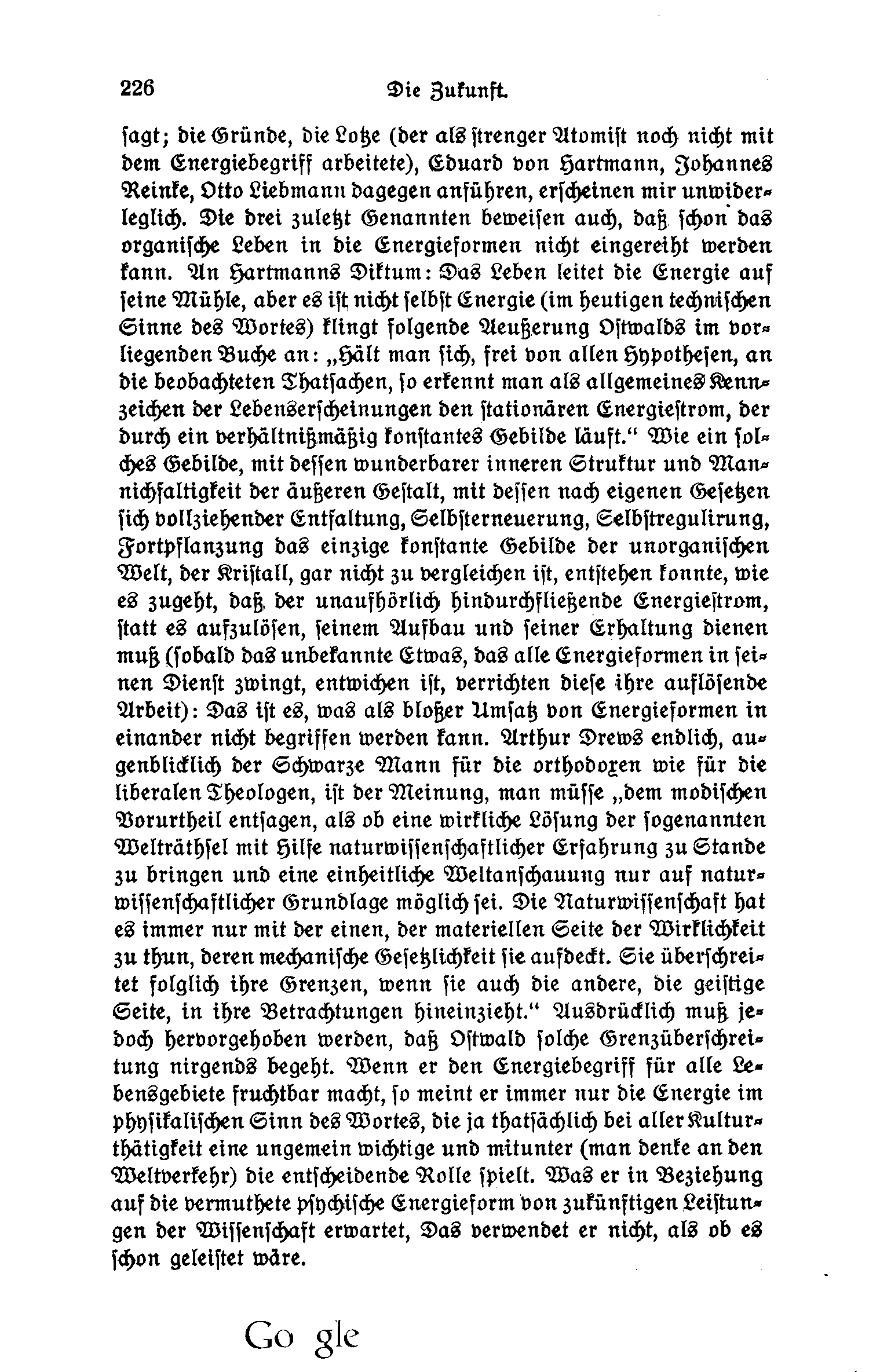
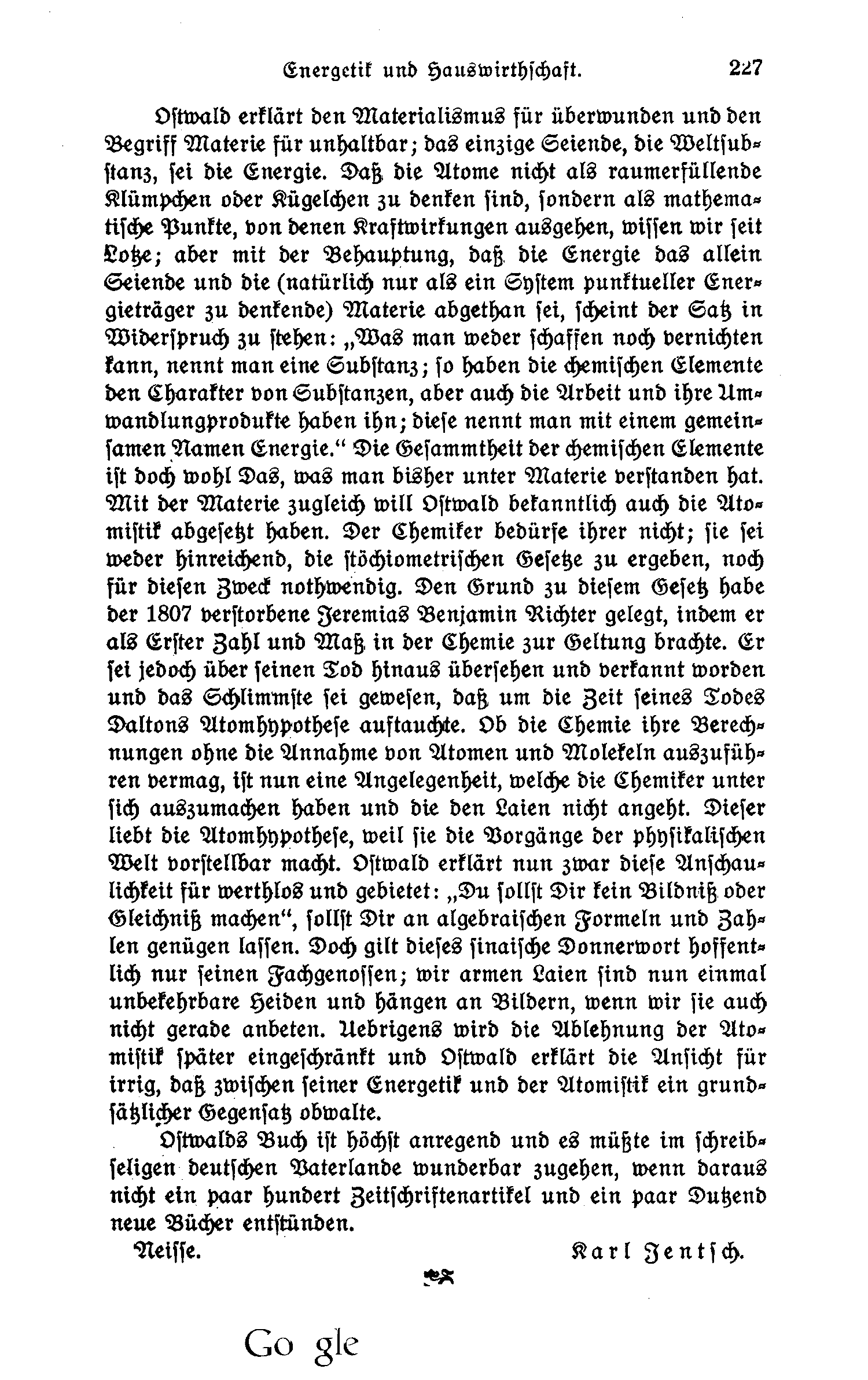 Text
Text
↑
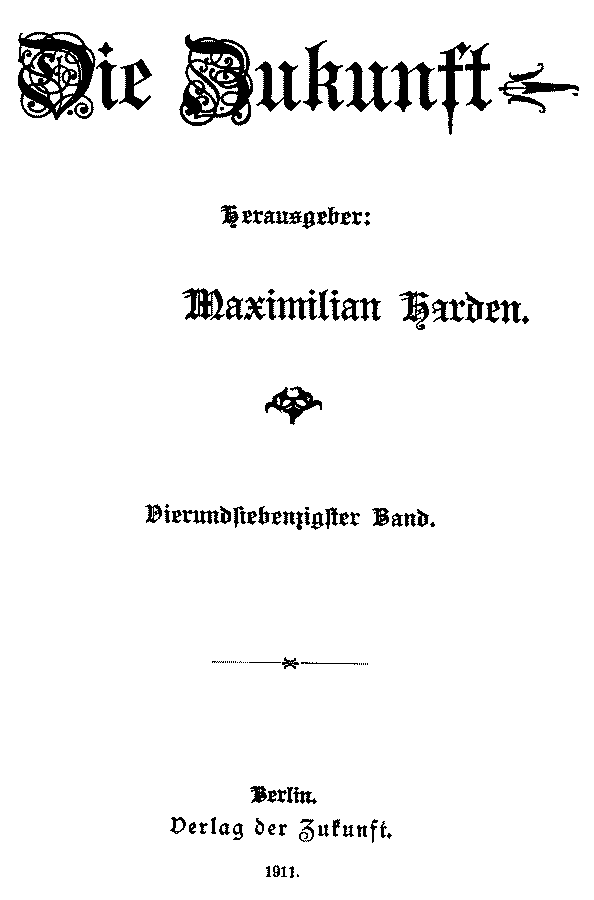
↑
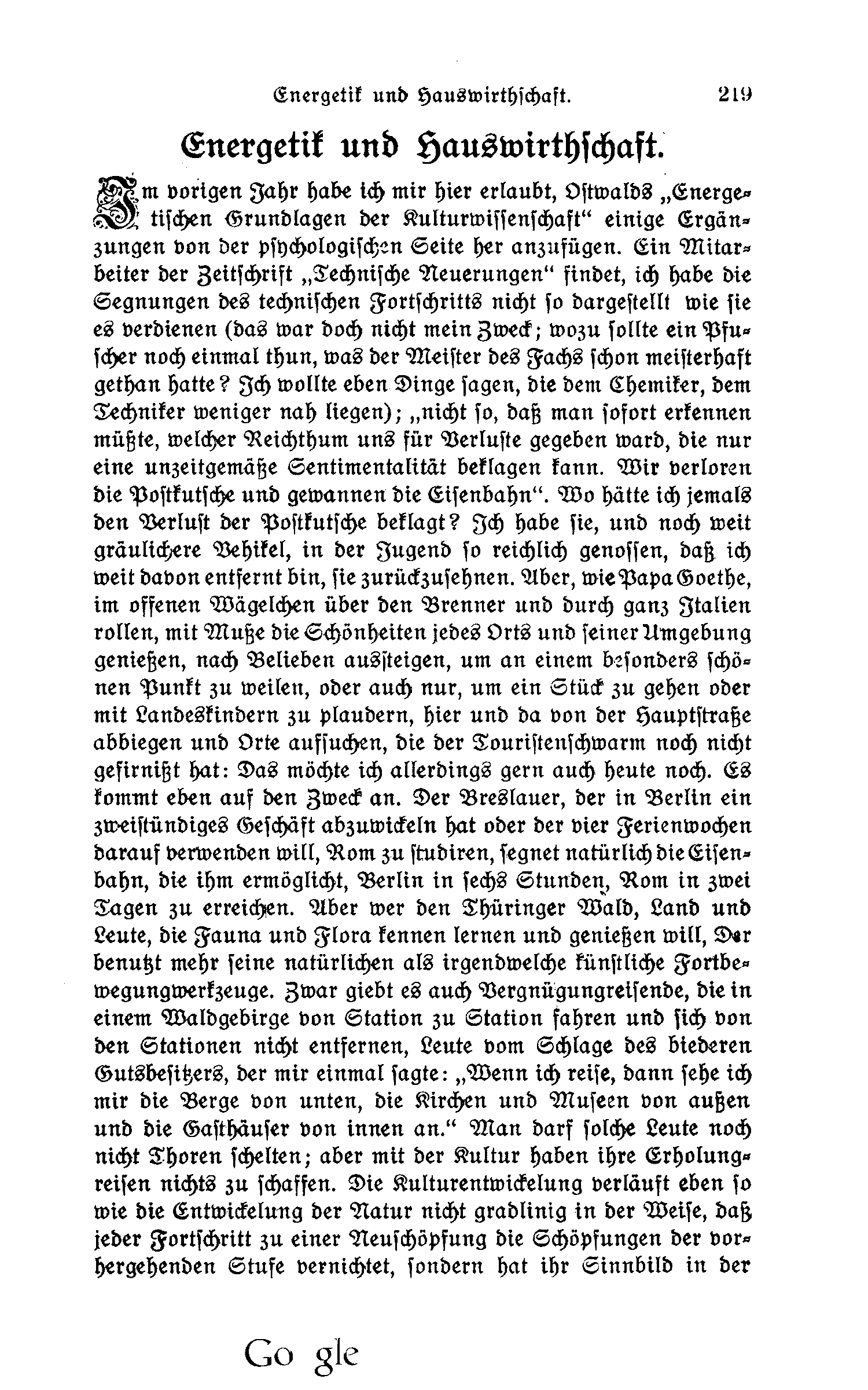
↑
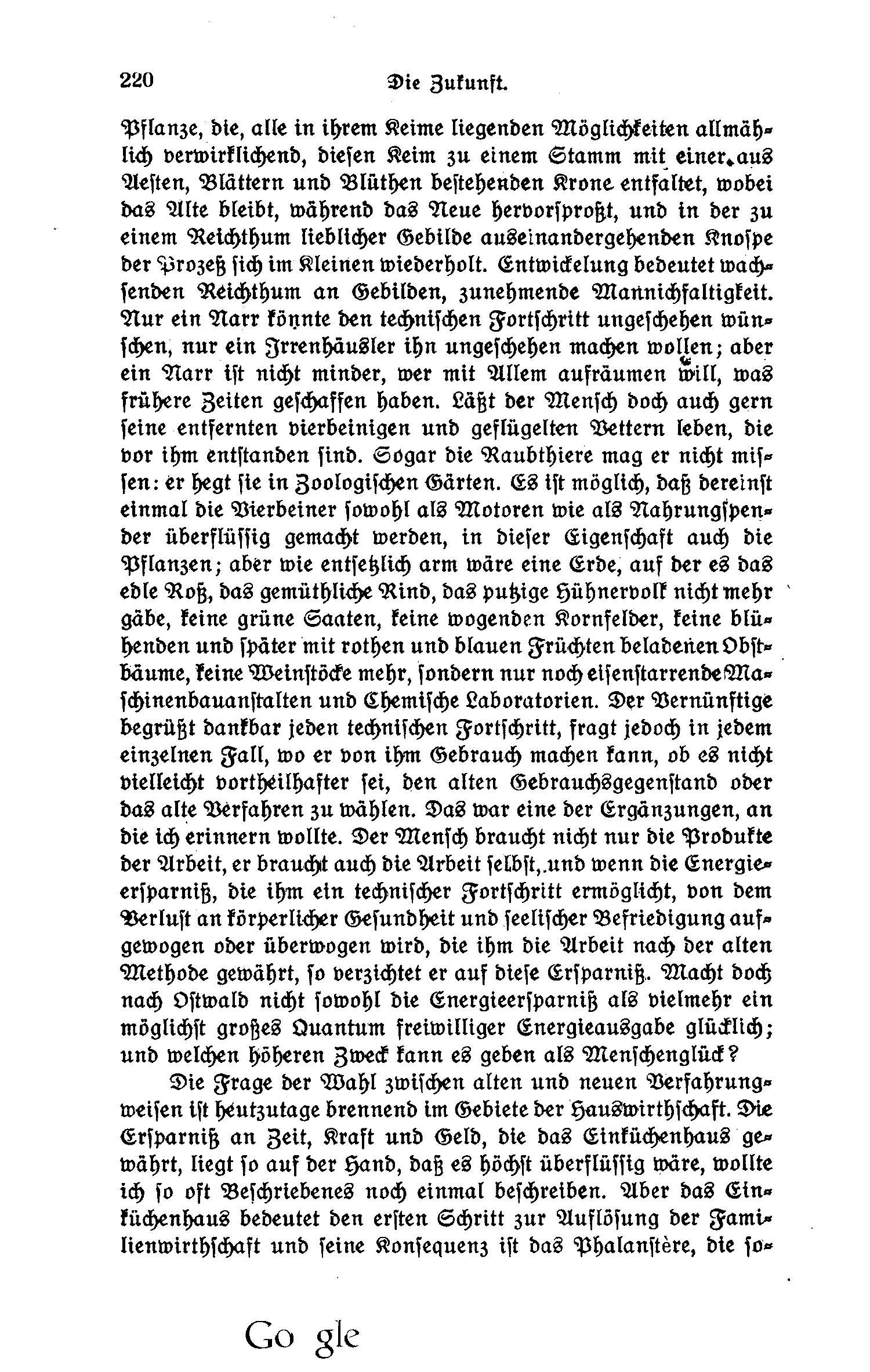
↑
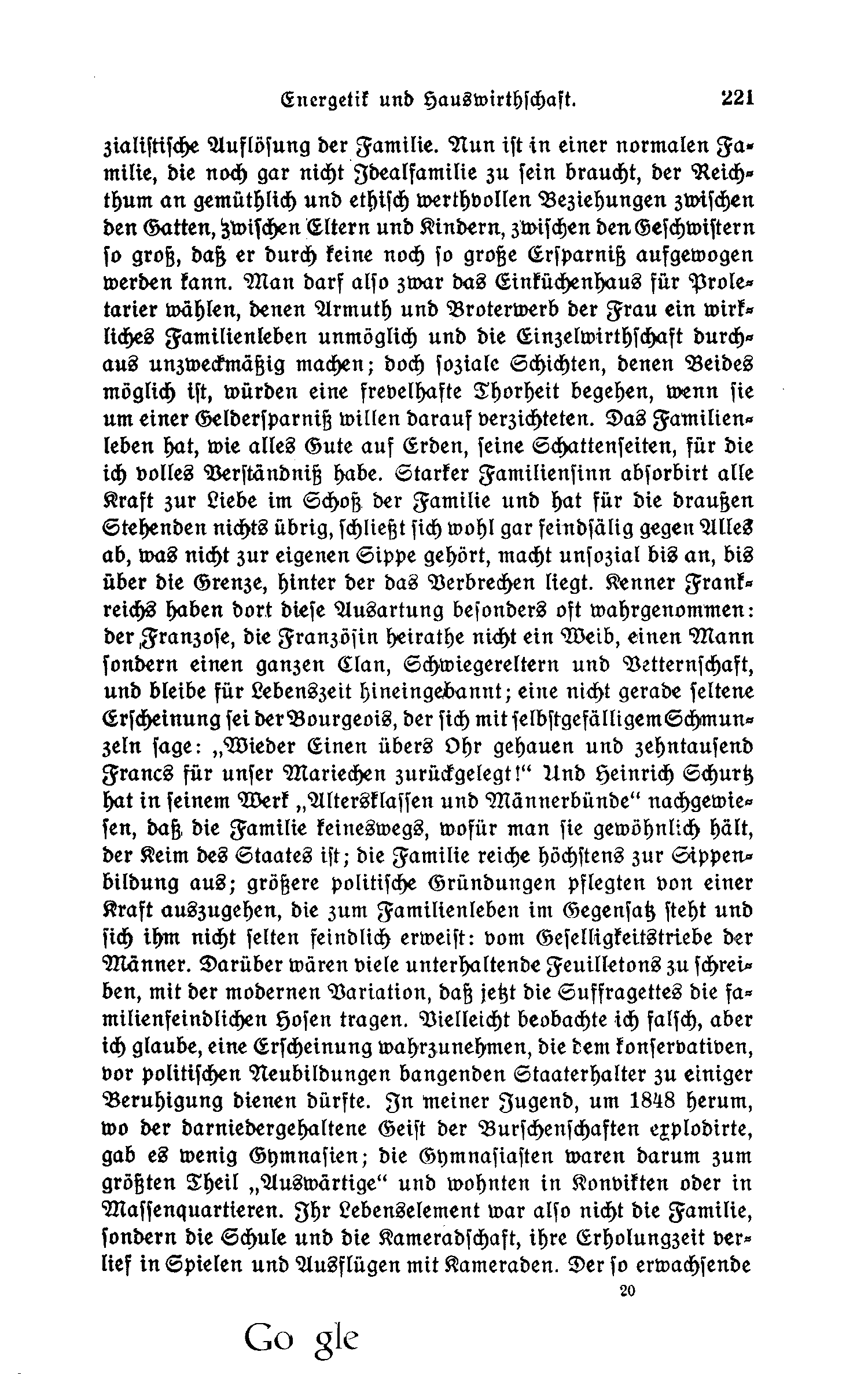
↑
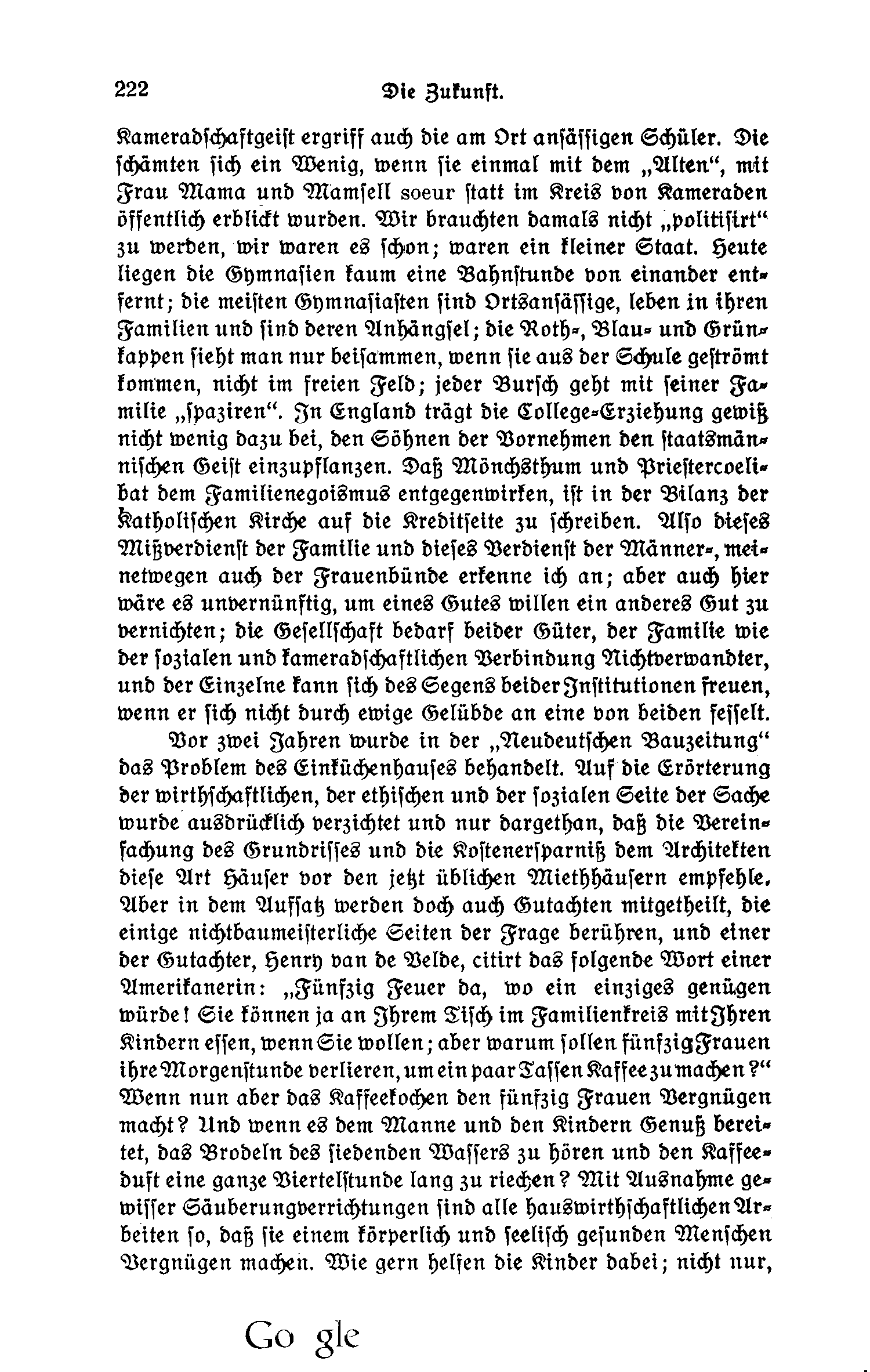
↑
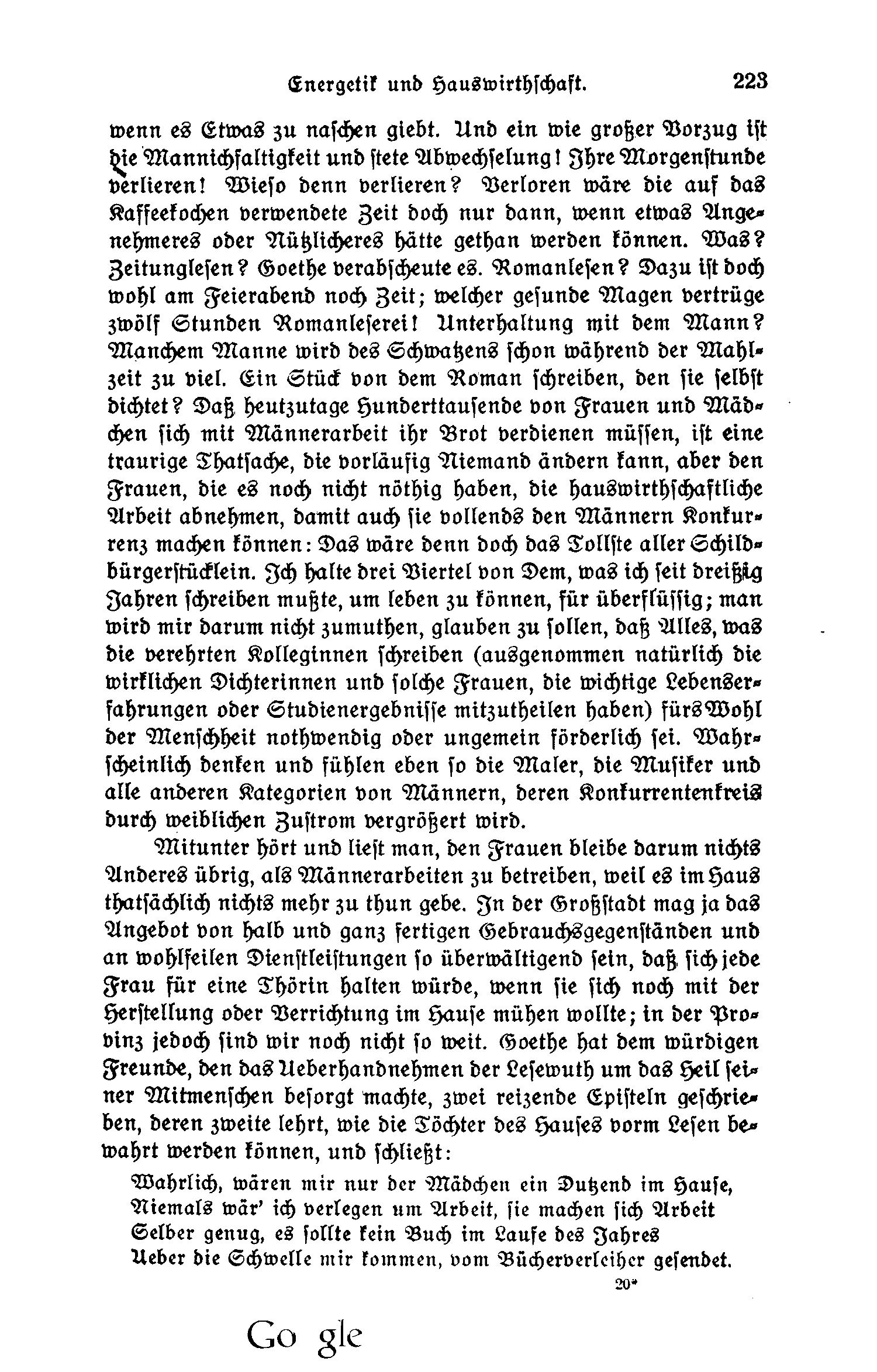
↑
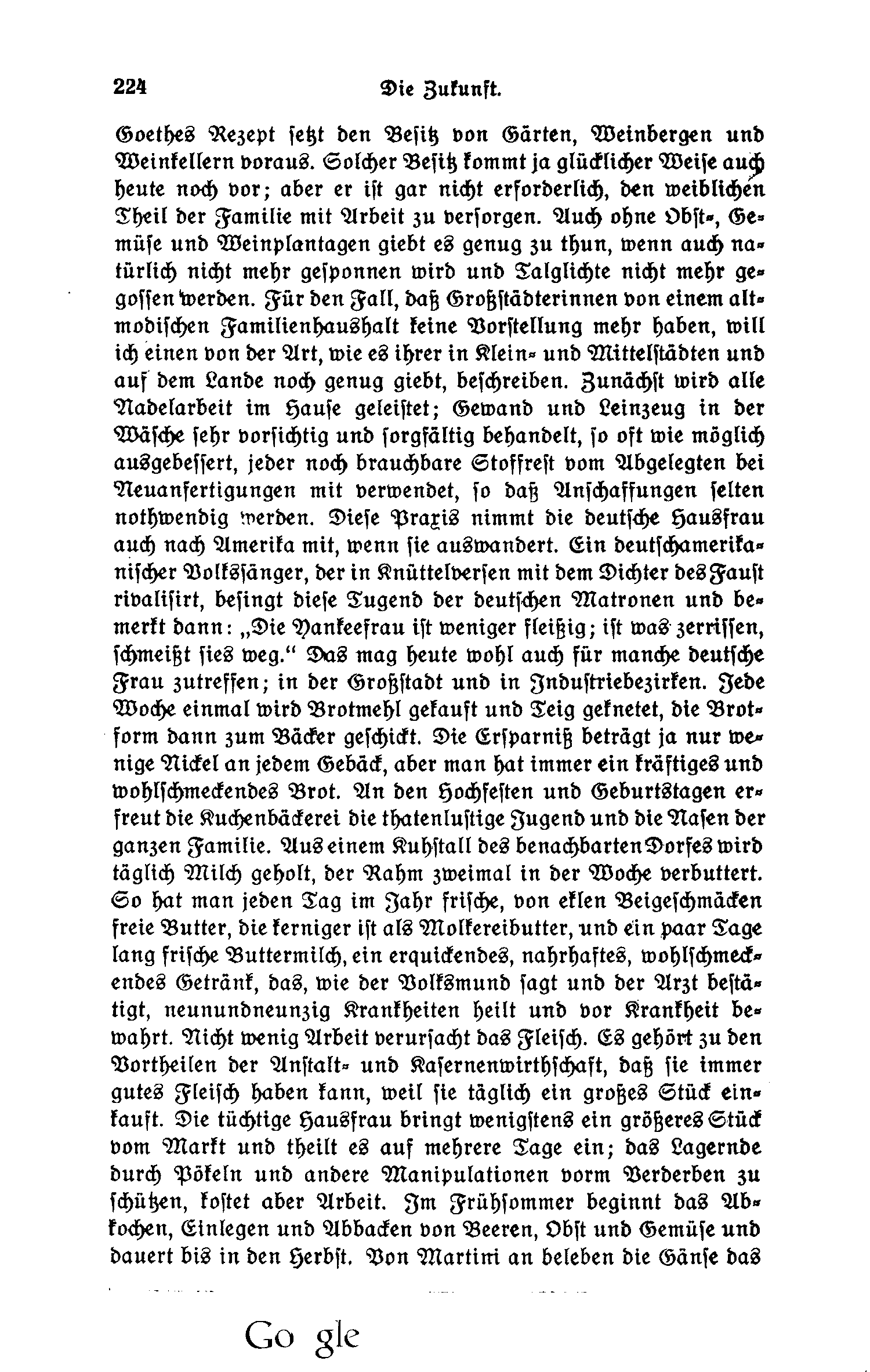
↑
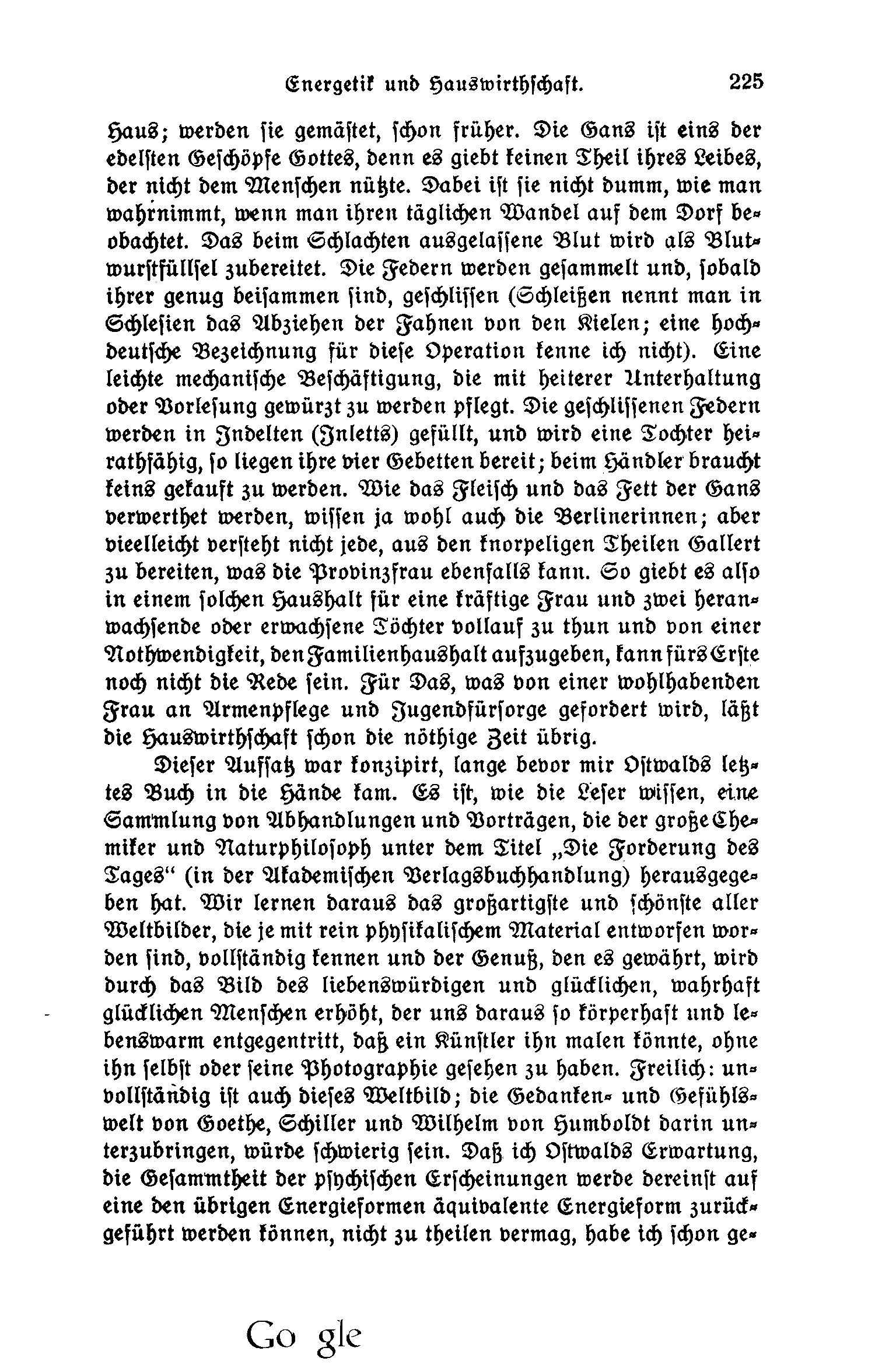
↑
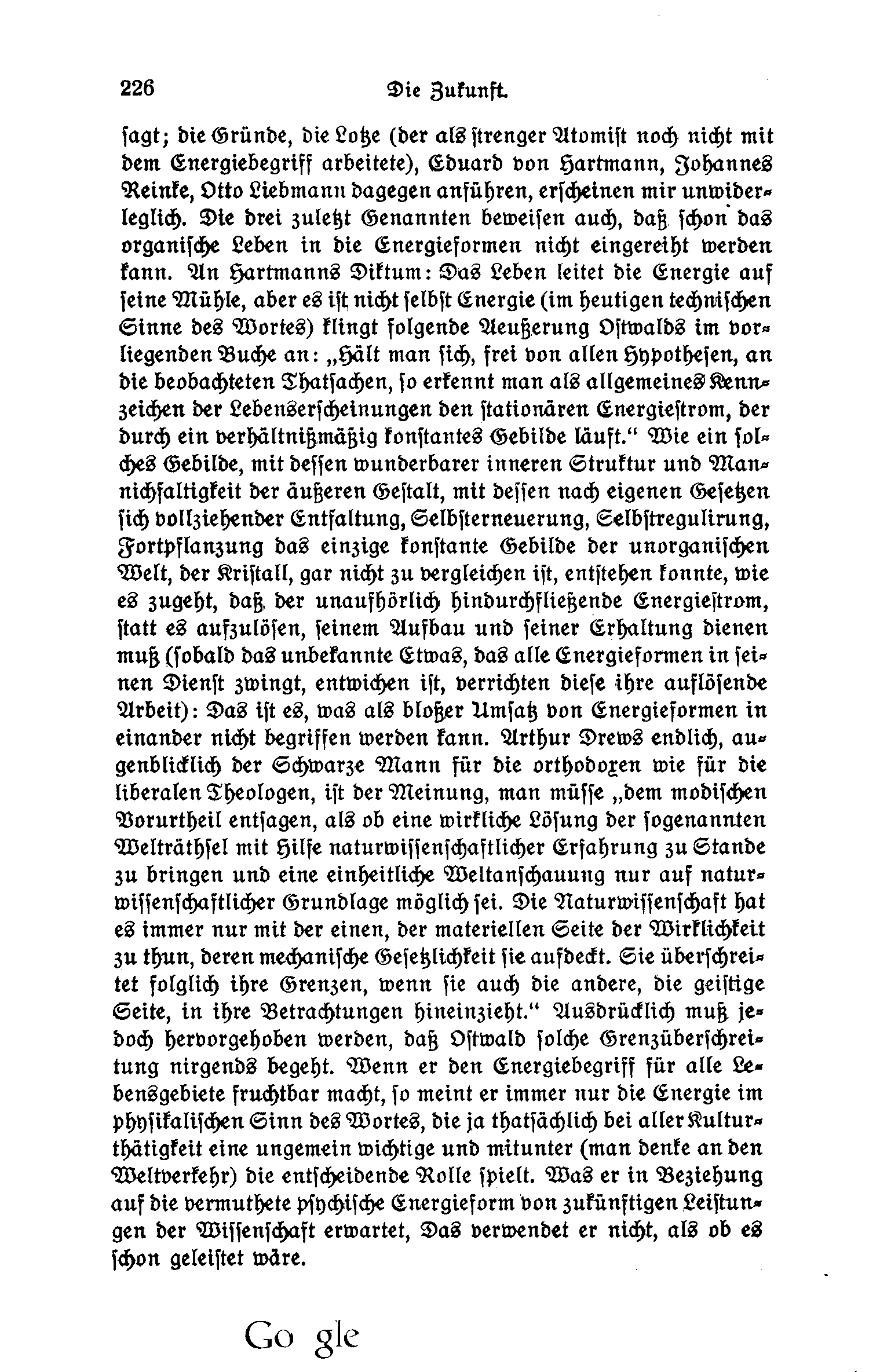
↑
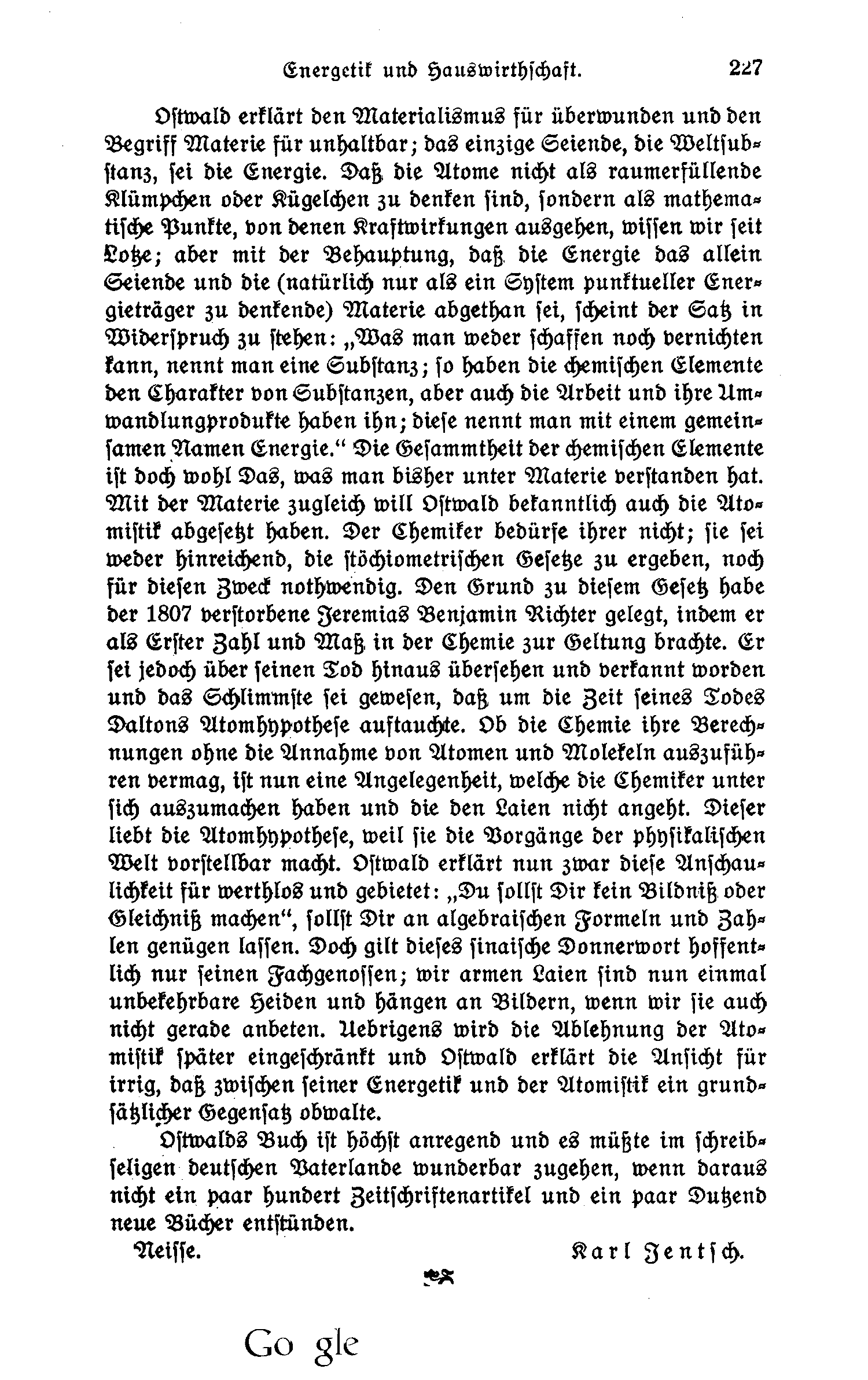
↑
nach oben
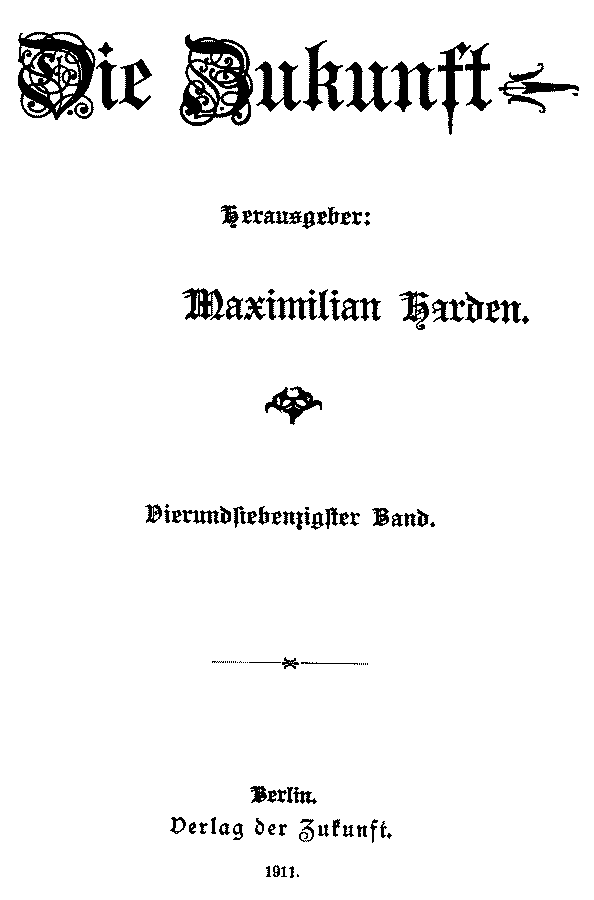
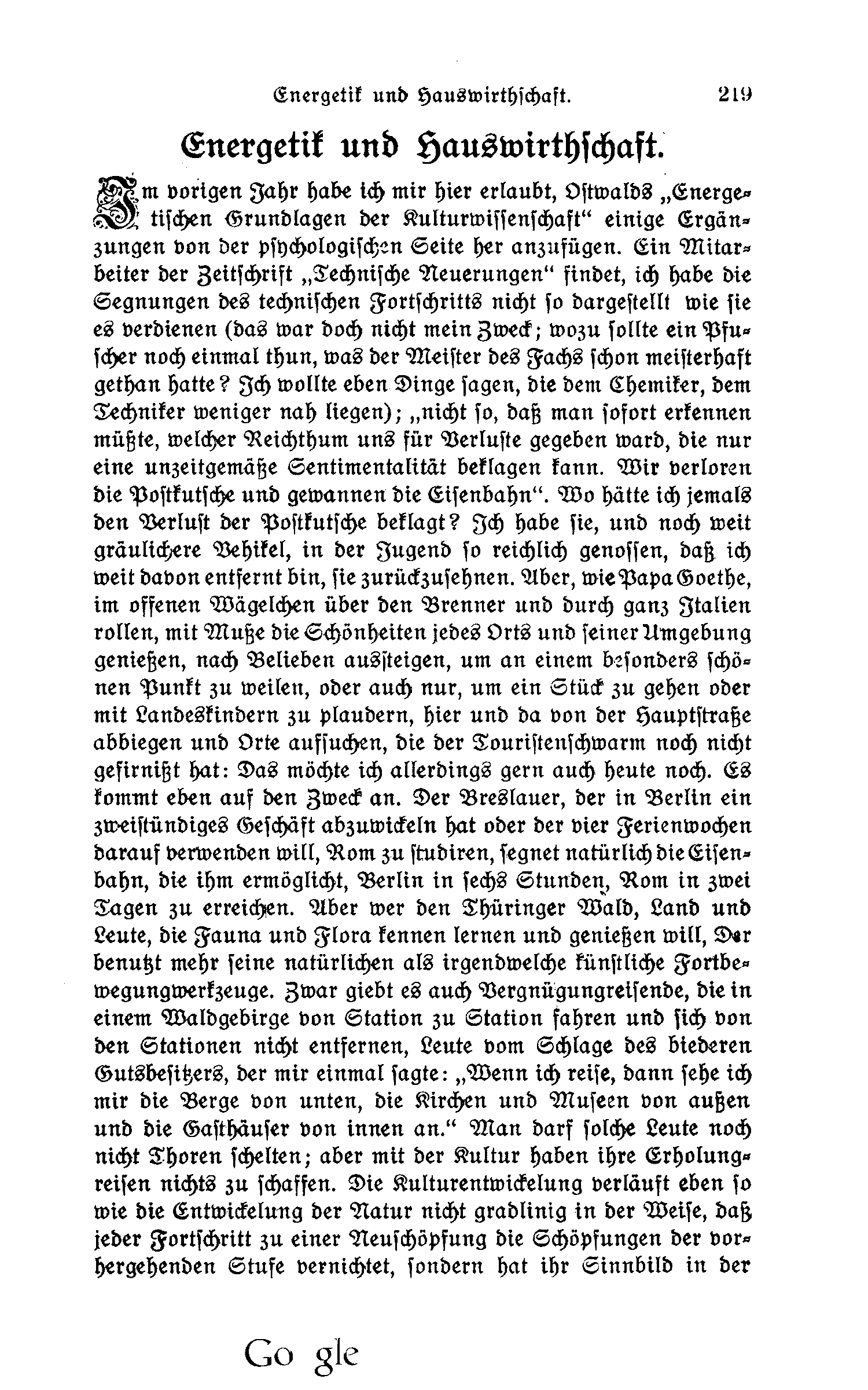
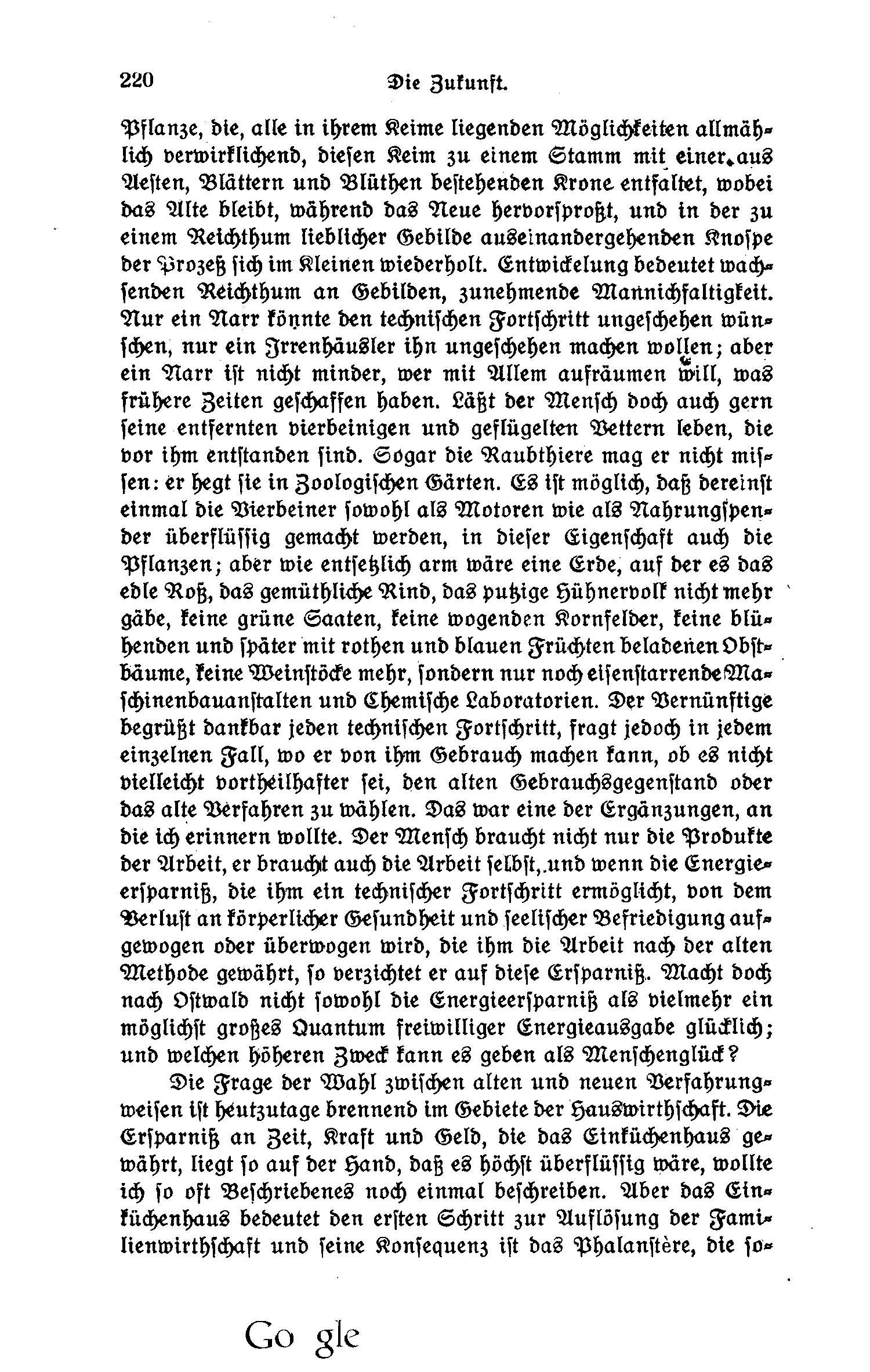
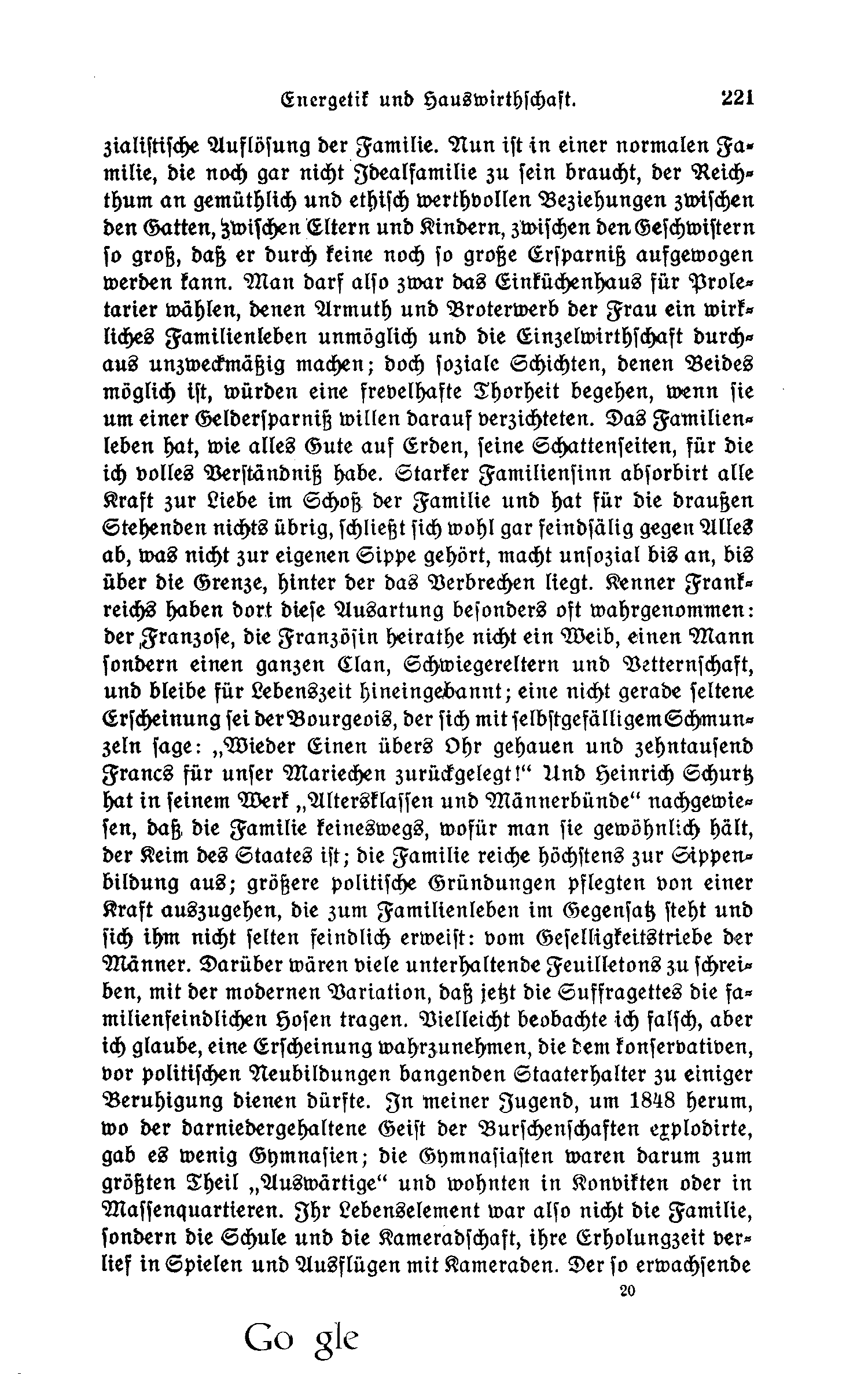
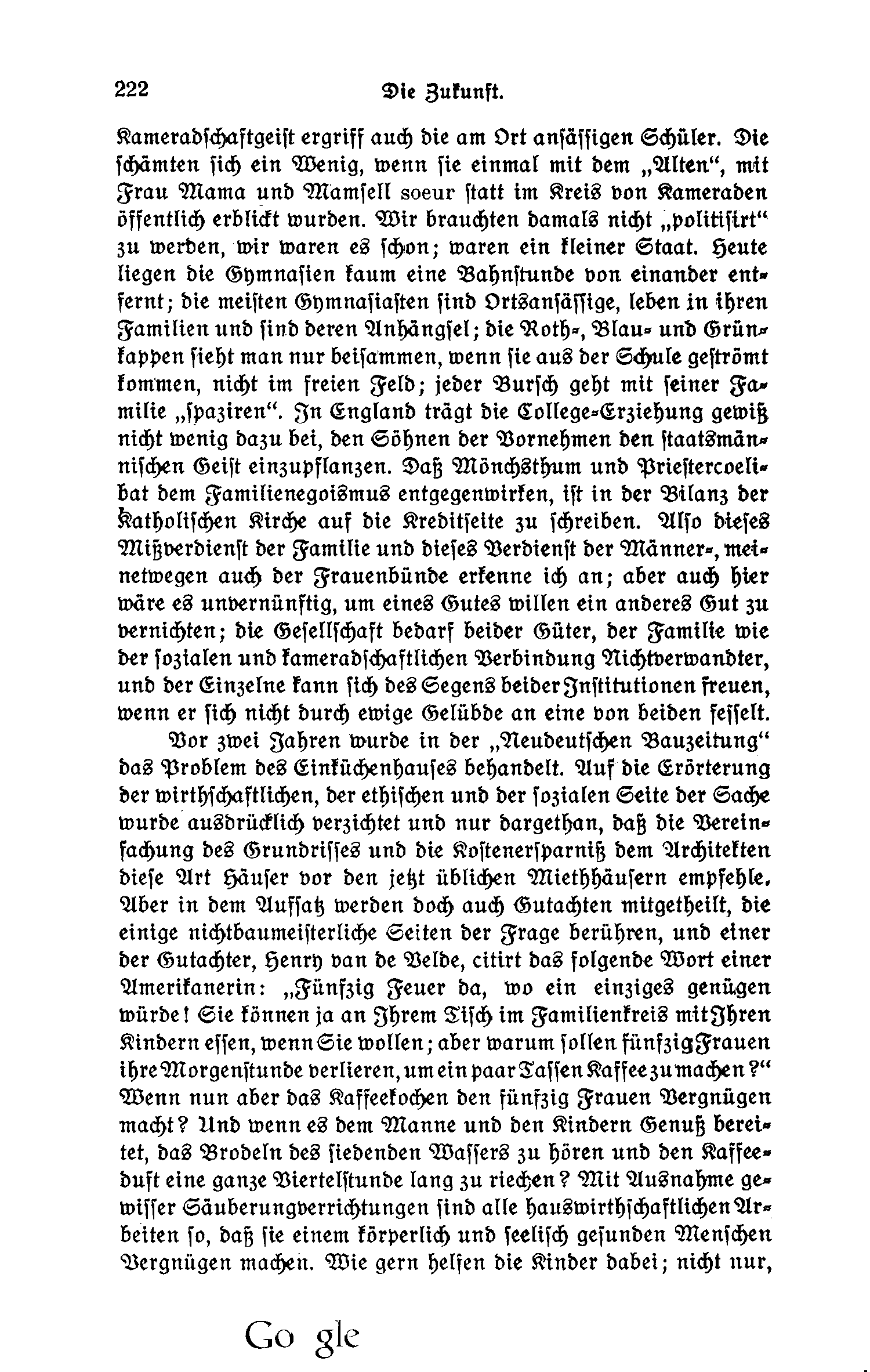
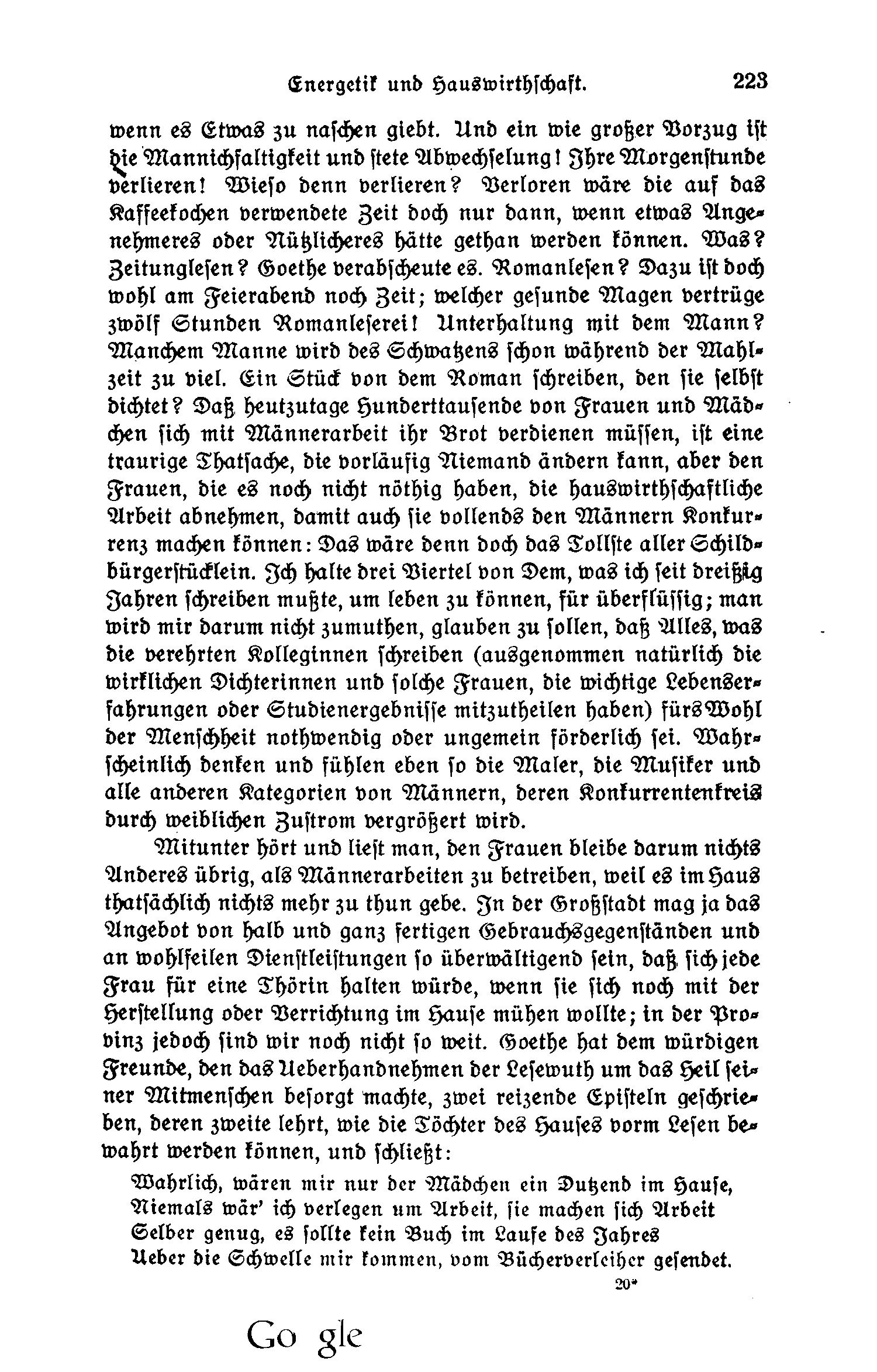
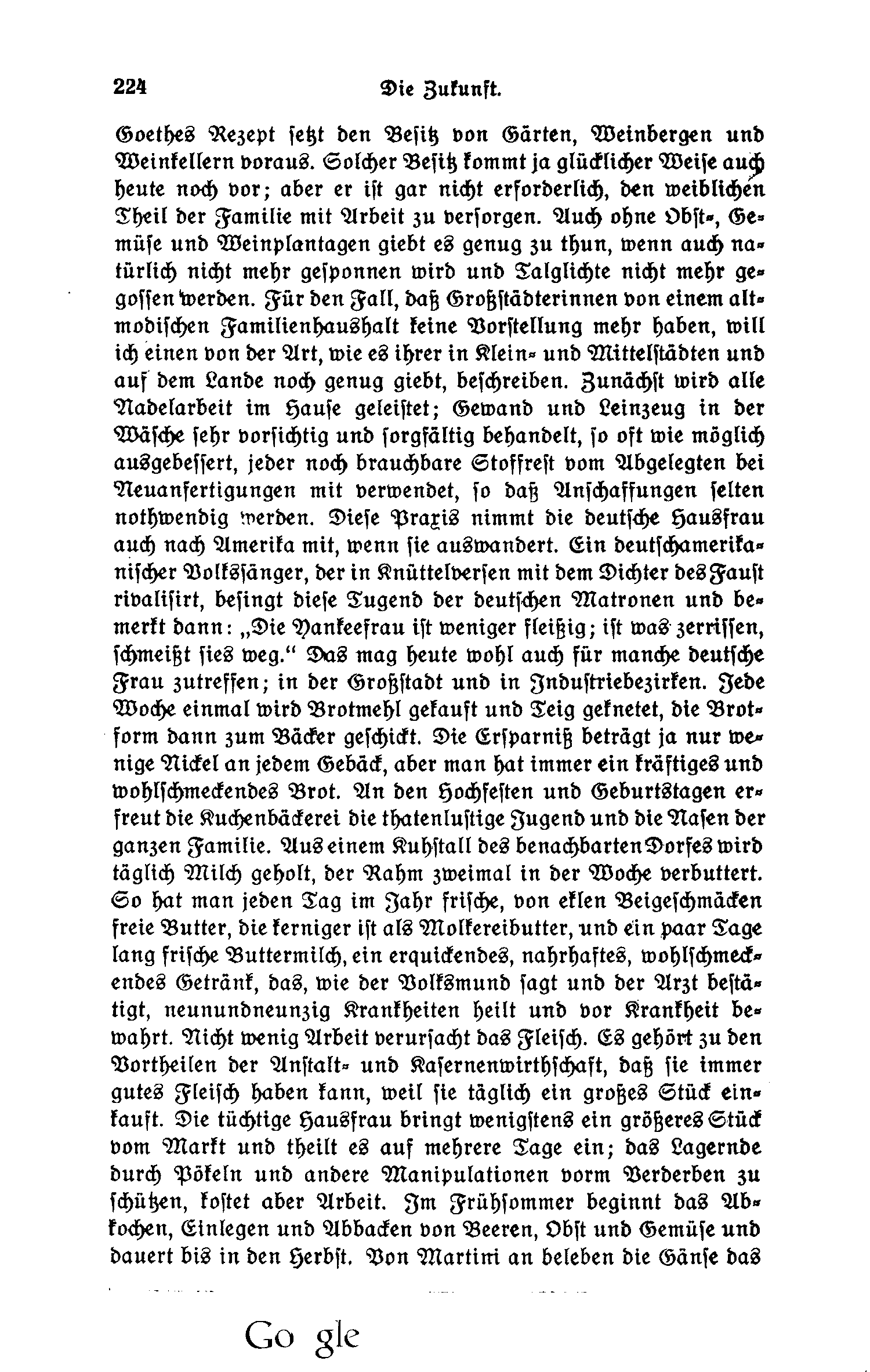
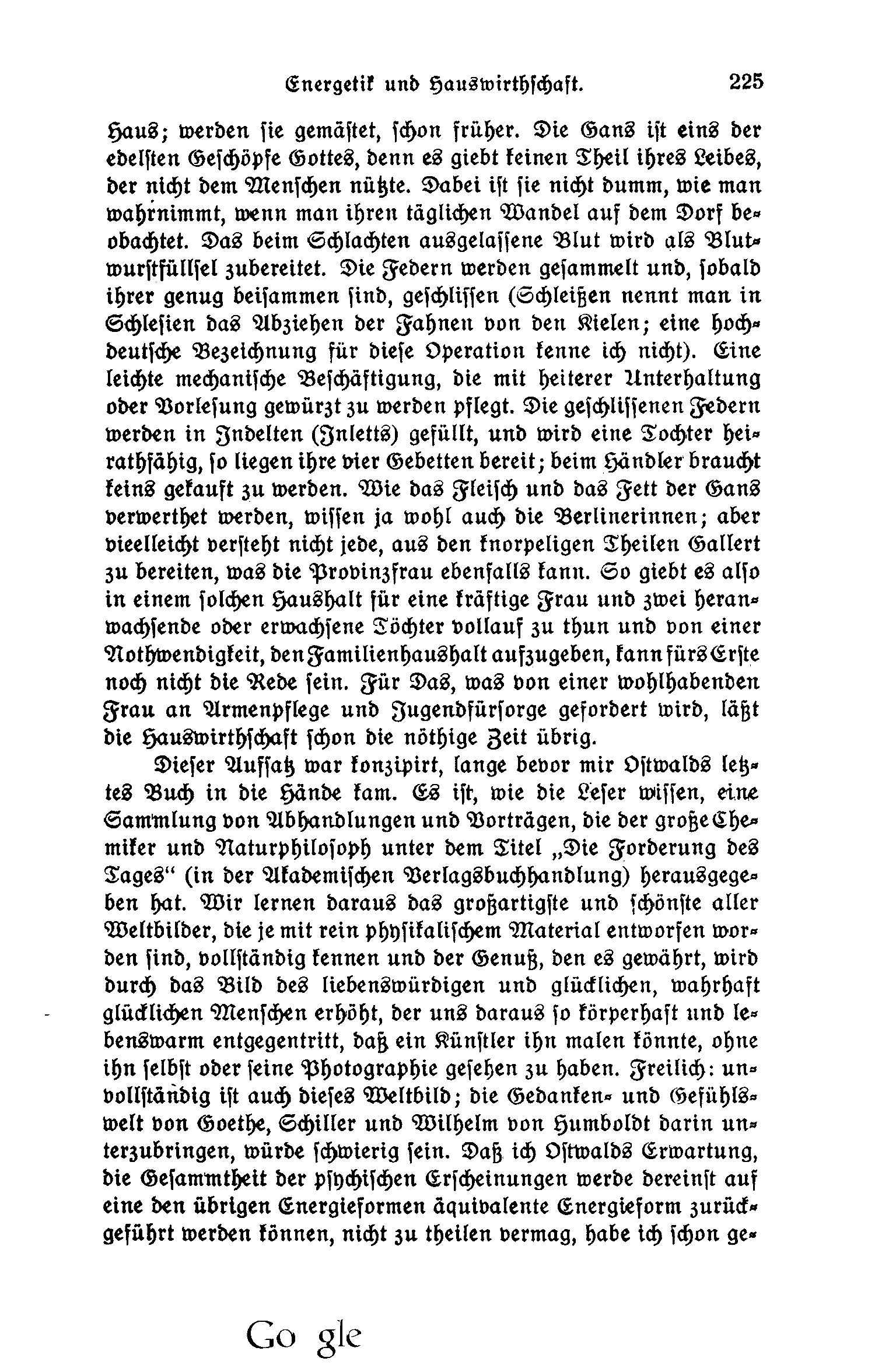
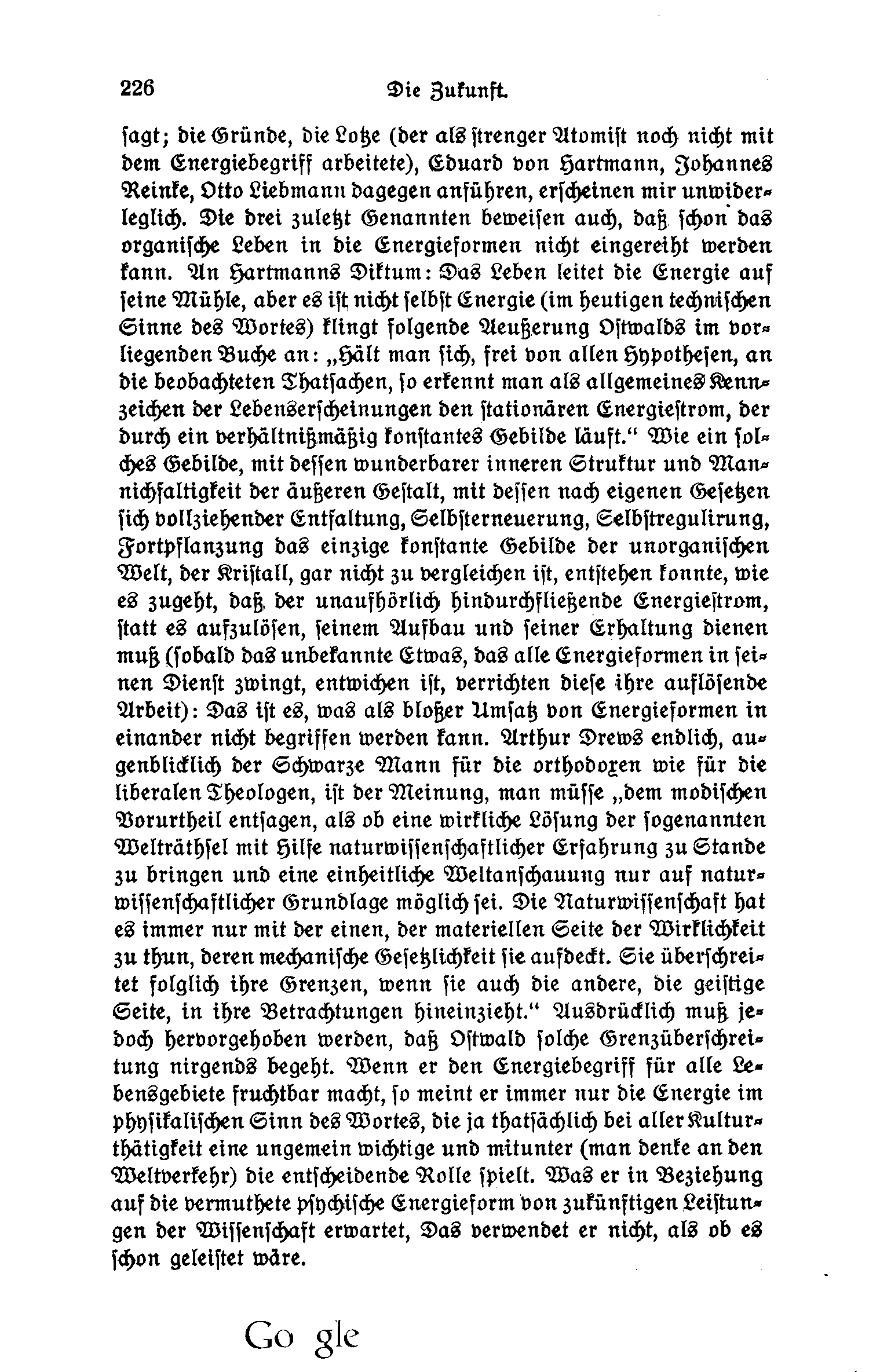
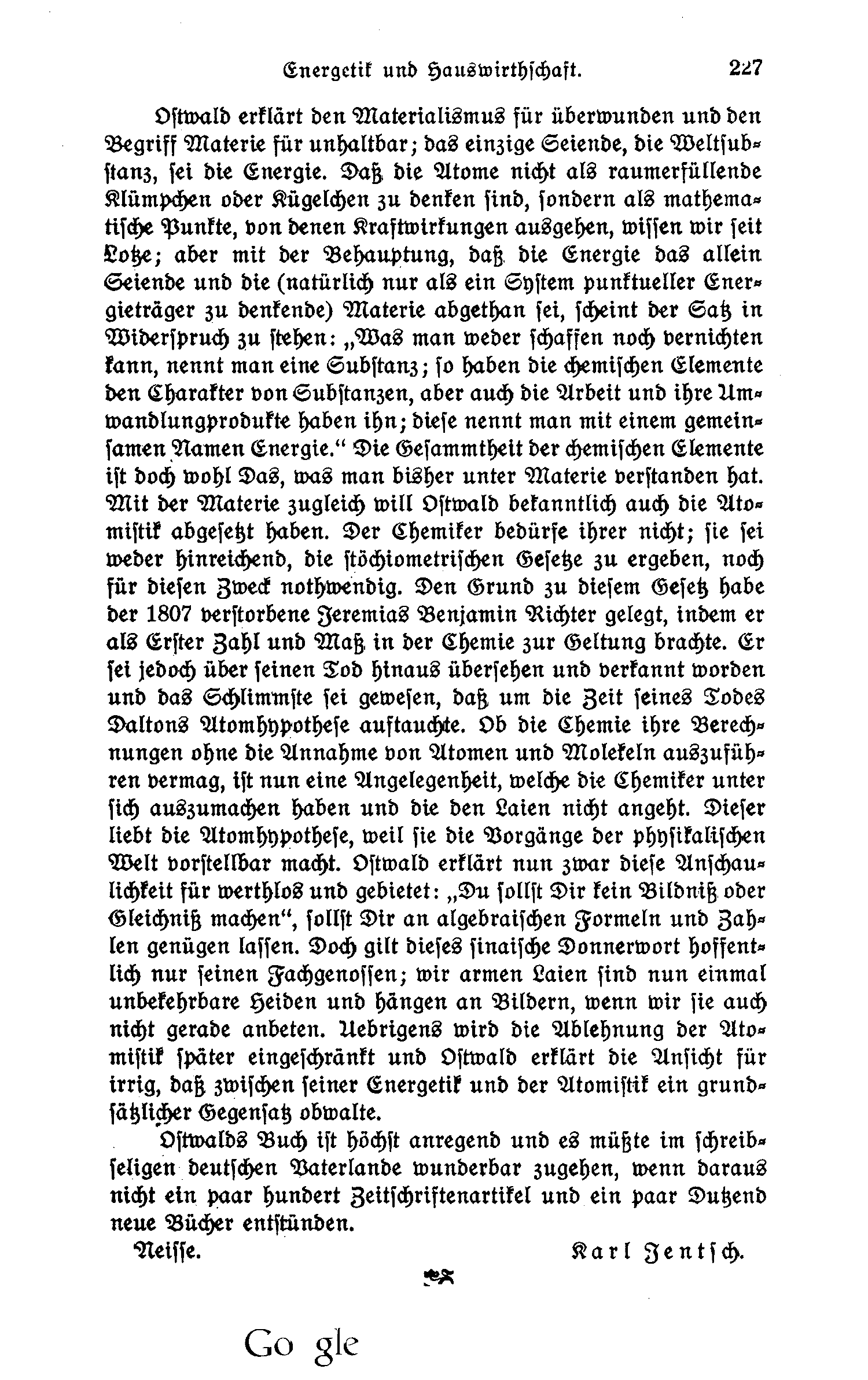 Text
Text
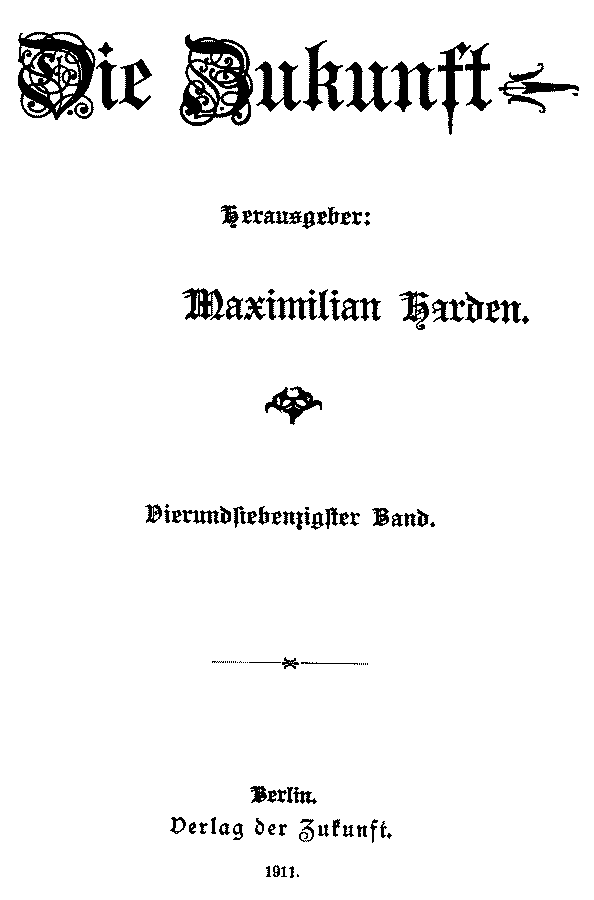
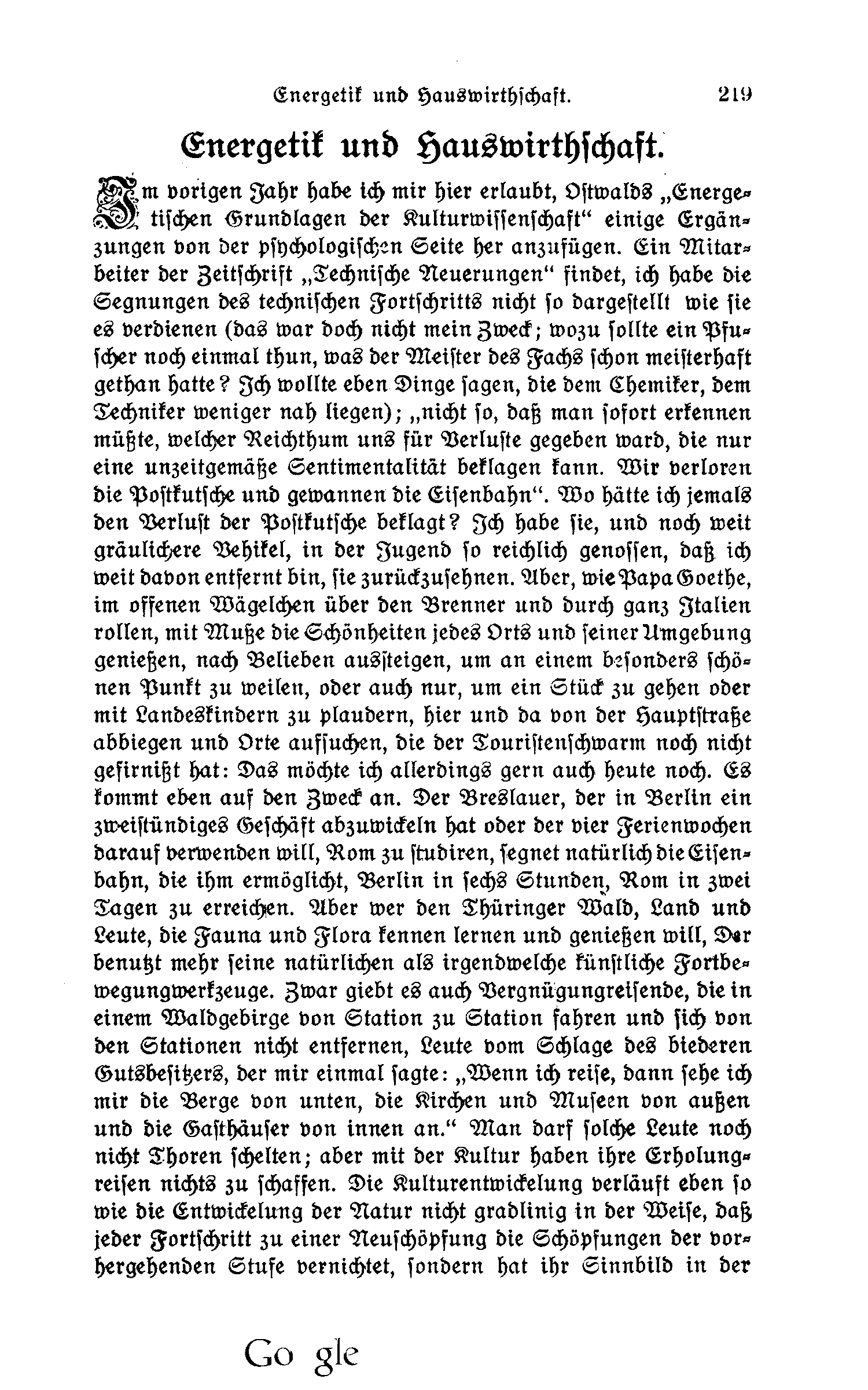
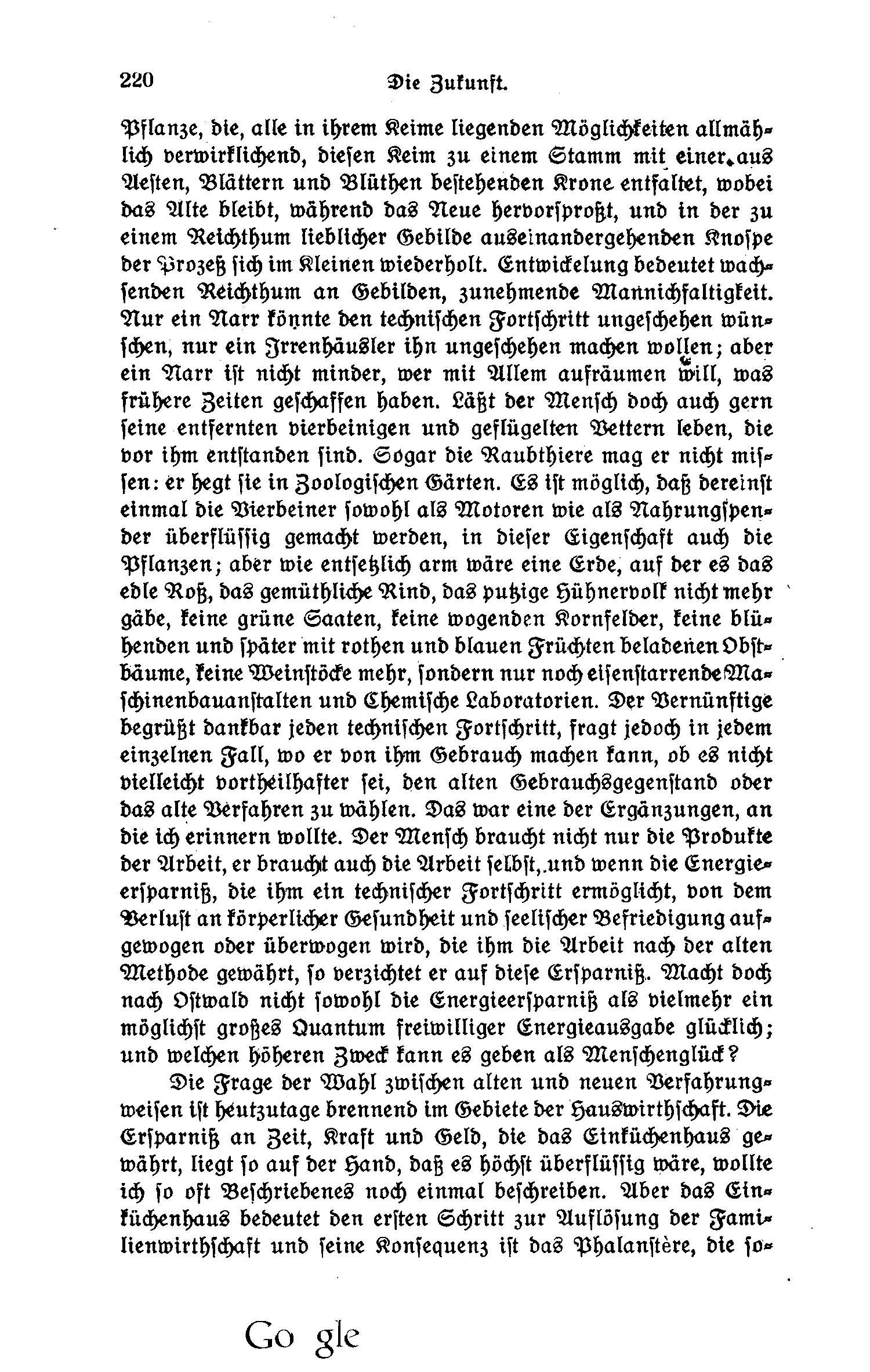
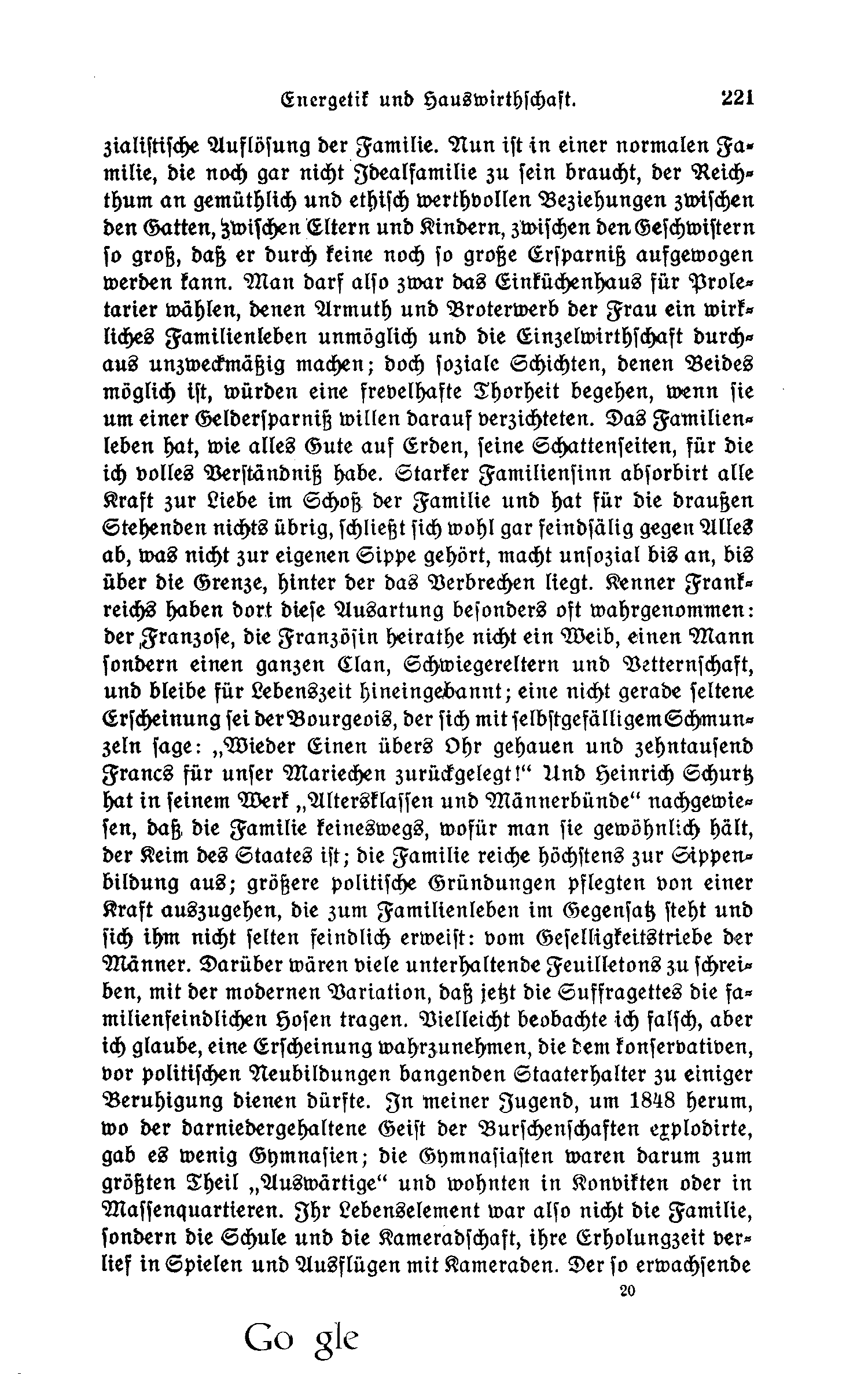
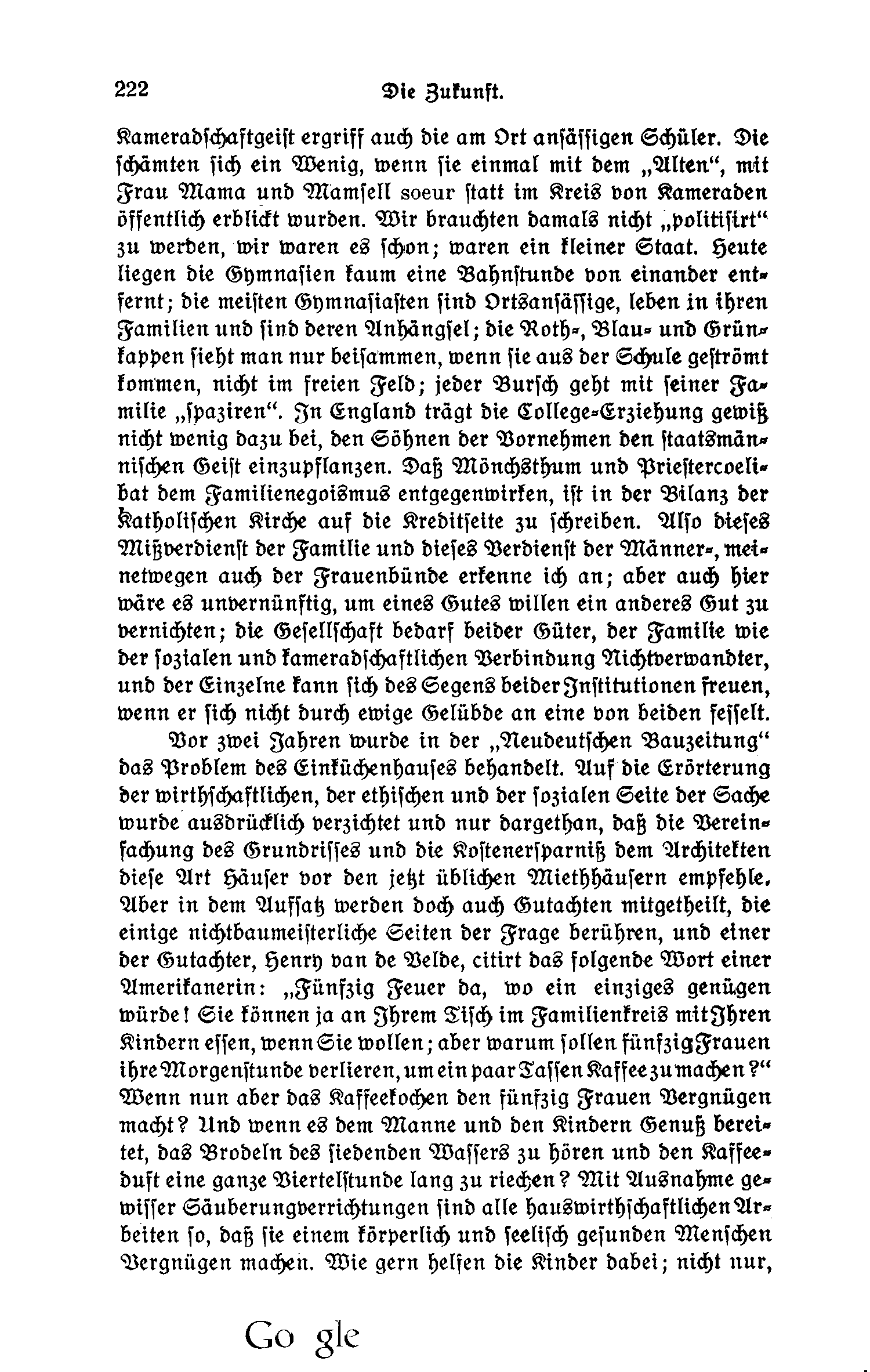
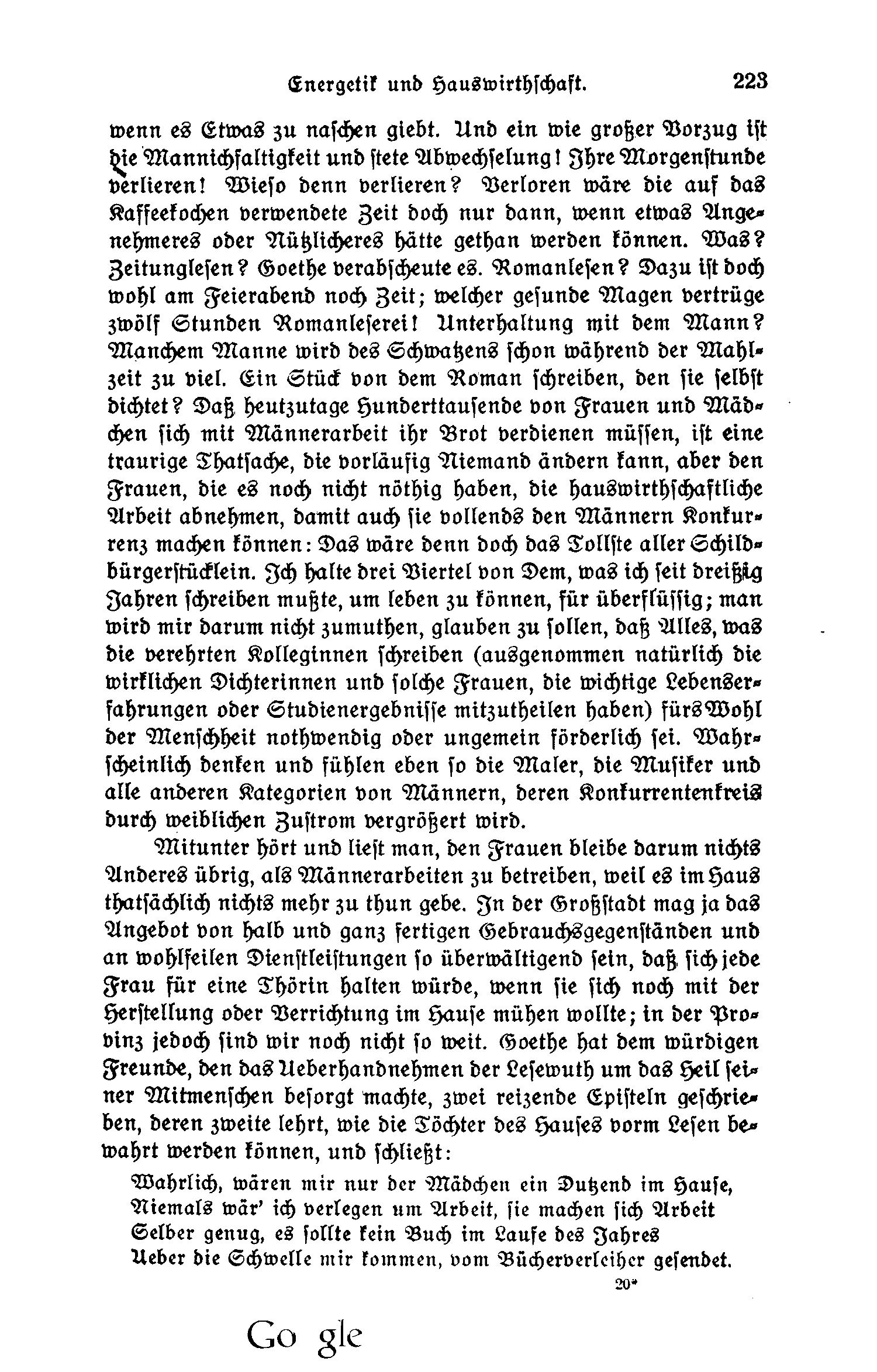
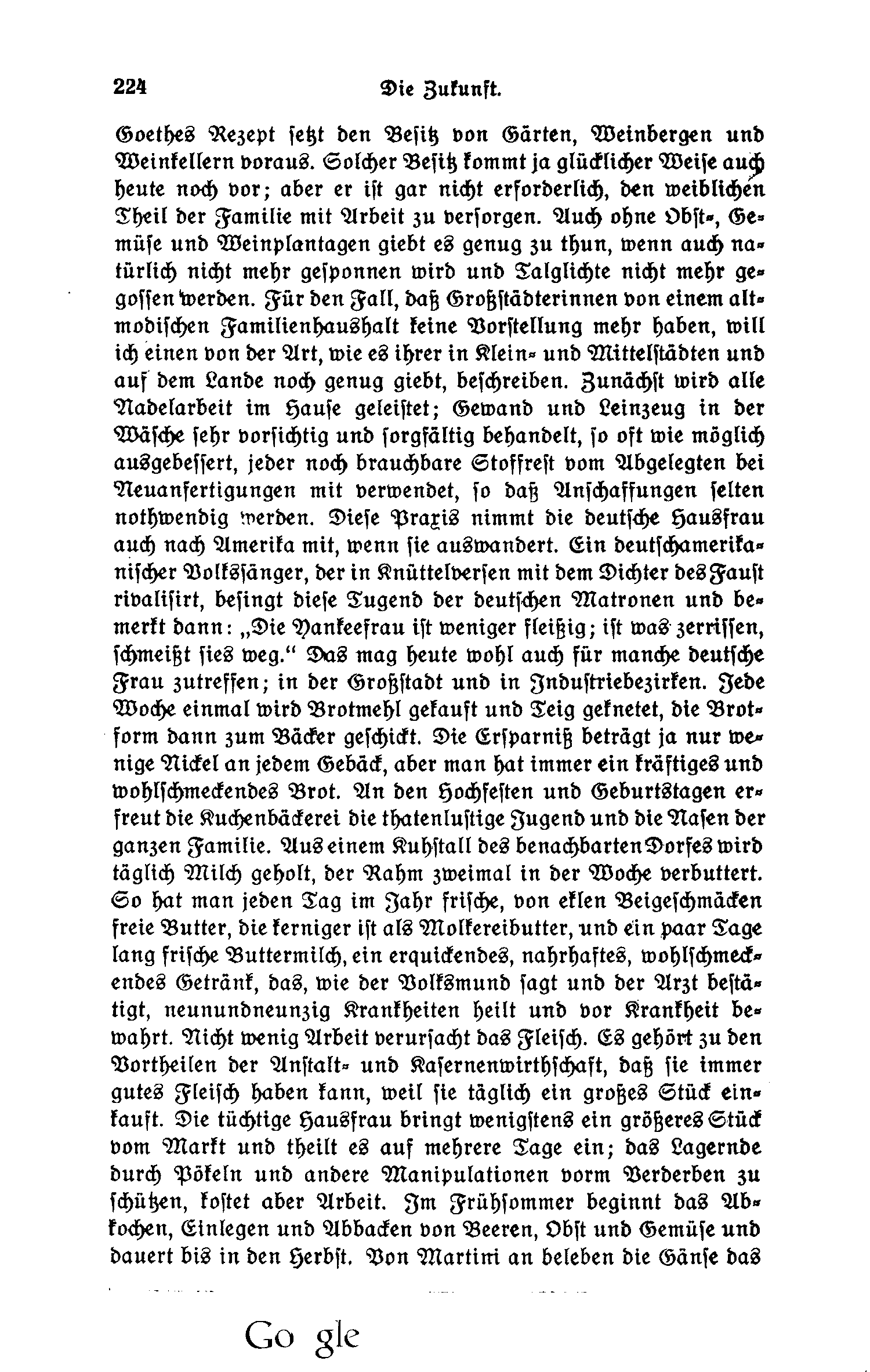
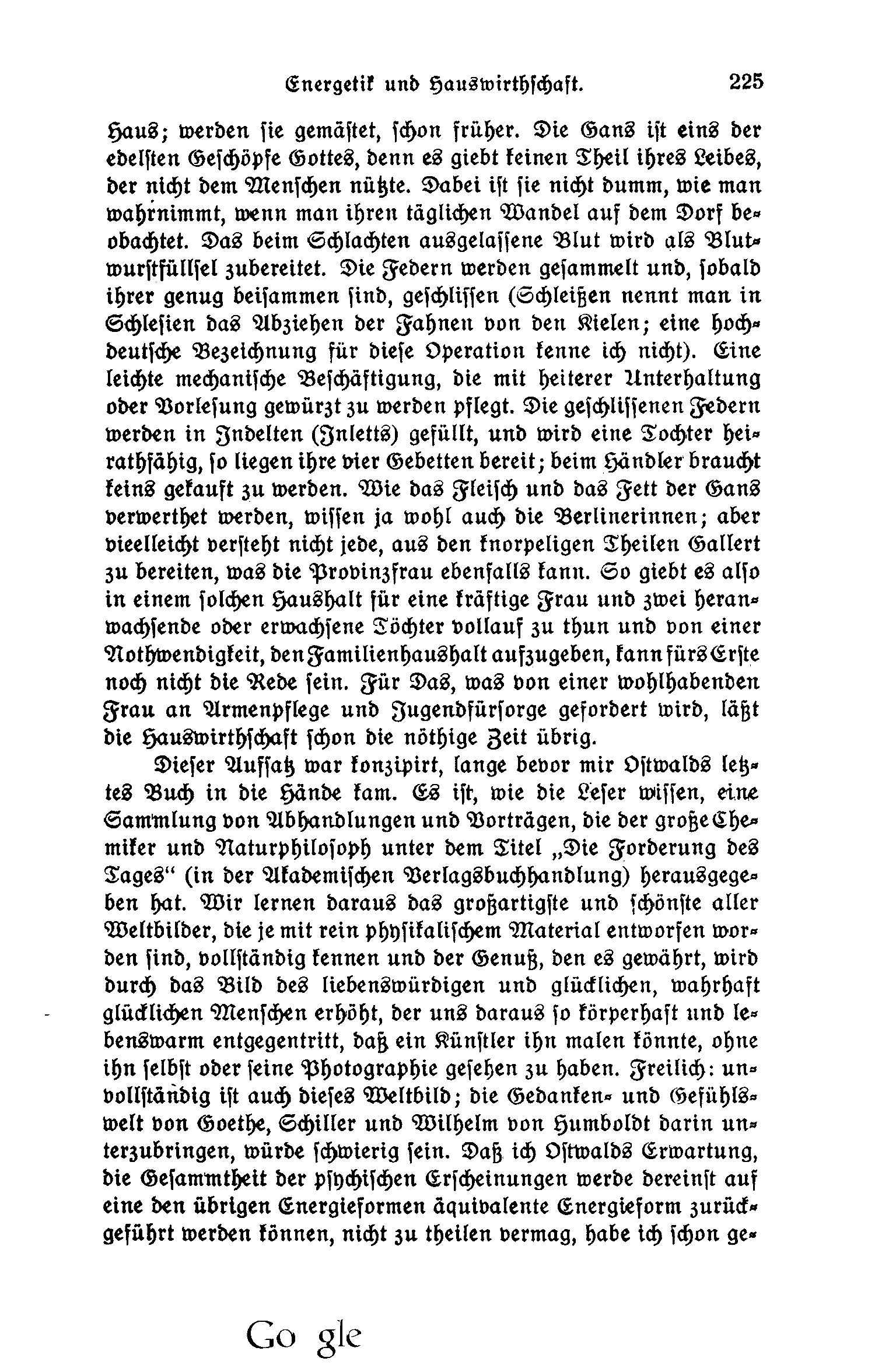
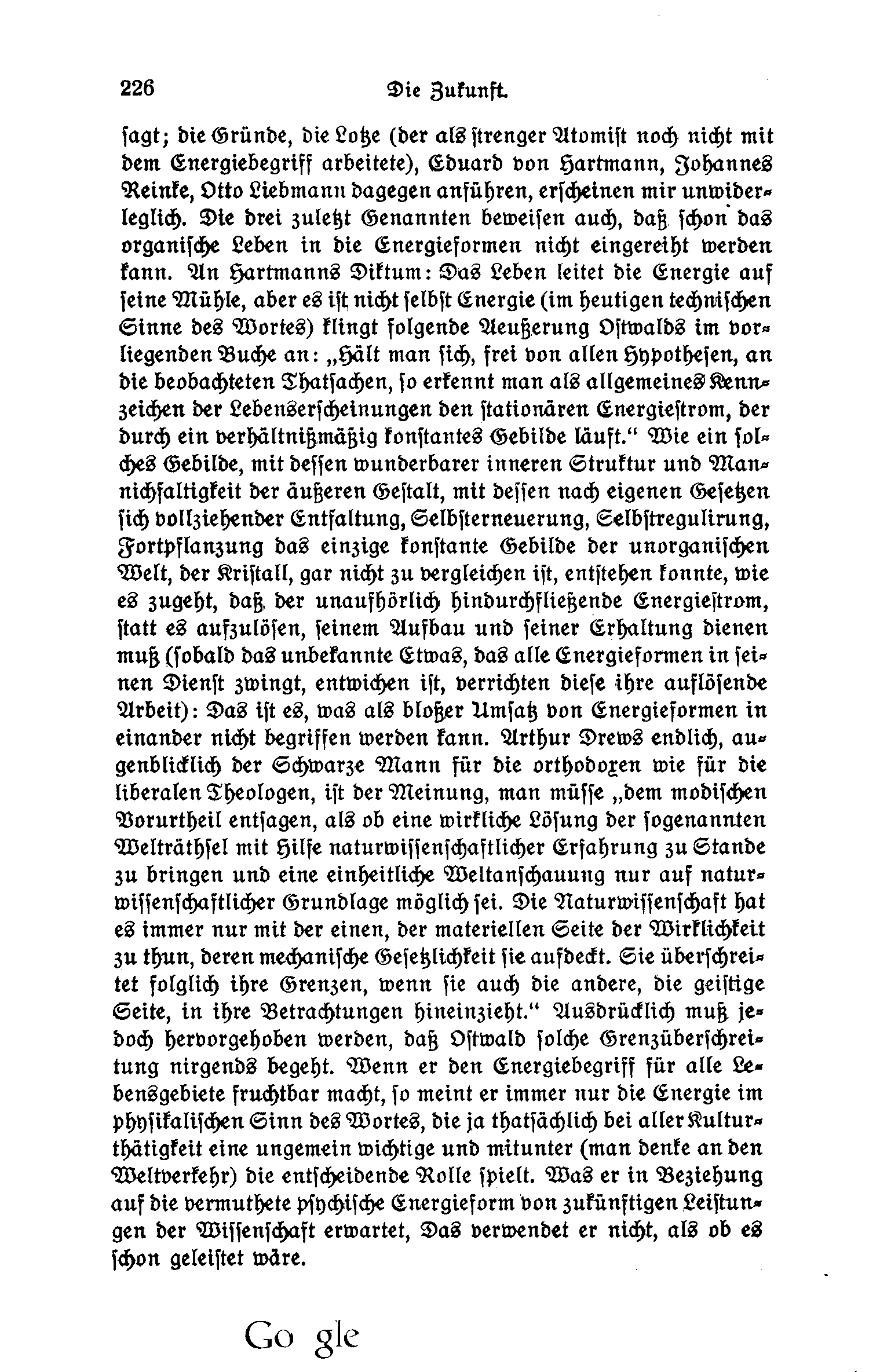
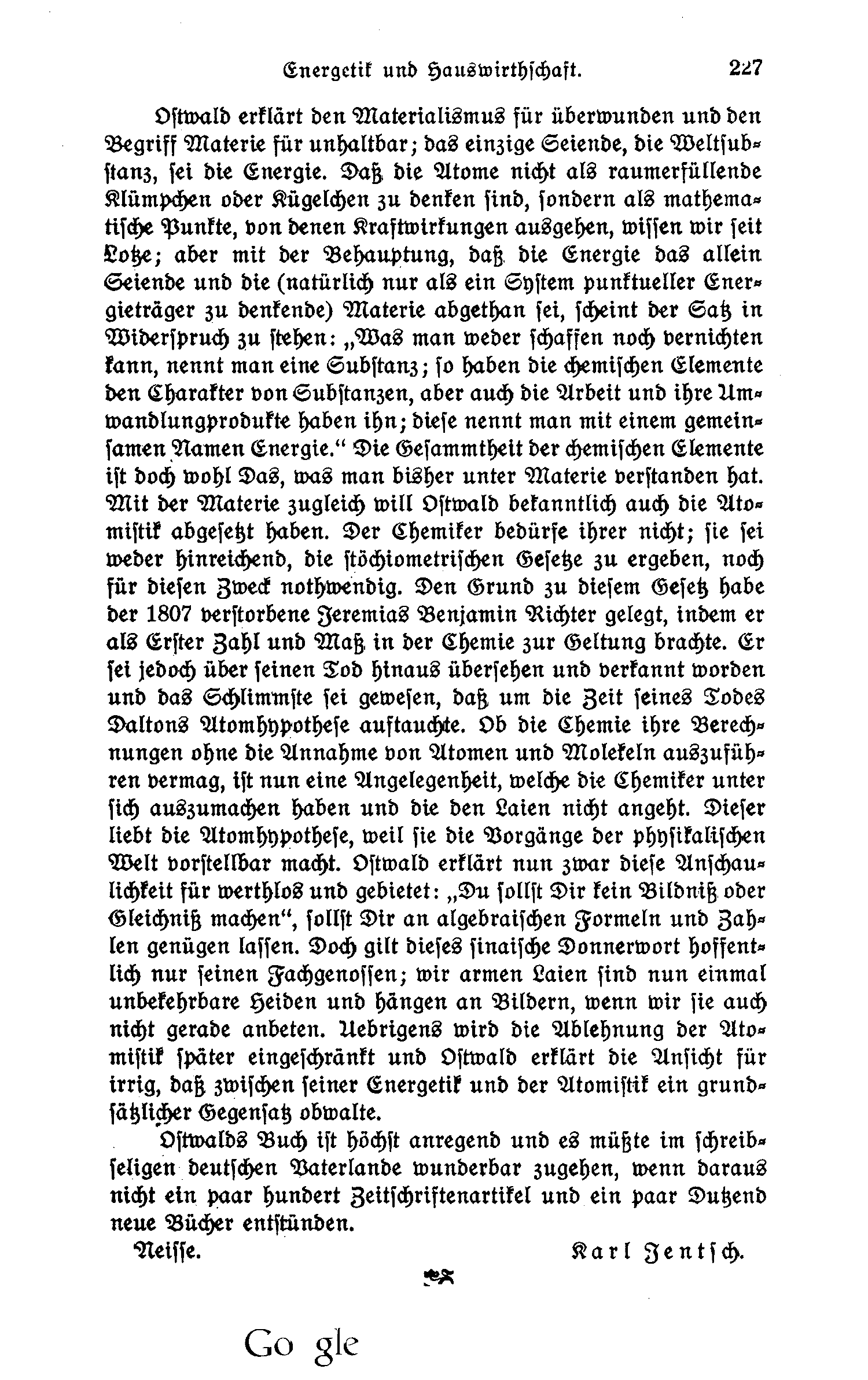
219 - Energetik und Hauswirthschaft.
Energetik und Hauswirthschaft.
Im vorigen Jahr habe ich mir hier erlaubt, Ostwalds „Energetischen Grundlagen der Kulturwissenschaft" einige Ergänzungen von der psychologischen Seite her anzufügen. Ein Mitarbeiter der Zeitschrift „Technische Neuerungen" findet, ich habe die Segnungen des technischen Fortschritts nicht so dargestellt wie sie es verdienen (das war doch nicht mein Zweck; wozu sollte ein Pfuscher noch einmal thun, was der Meister des Fachs schon meisterhaft gethan hatte? Ich wollte eben Dinge sagen, die dem Chemiker, dem Techniker weniger nah liegen); „nicht so, daß man sofort erkennen müßte, welcher Reichthum uns für Verluste gegeben ward, die nur eine unzeitgemäße Sentimentalität beklagen kann. Wir verloren die Postkutsche und gewannen die Eisenbahn". Wo hätte ich jemals den Verlust der Postkutsche beklagt? Ich habe sie, und noch weit gräulichere Vehikel, in der Jugend so reichlich genossen, daß ich weit davon entfernt bin, sie zurückzusehnen. Aber, wie Papa Goethe, im offenen Wägelchen über den Brenner und durch ganz Italien rollen, mit Muße die Schönheiten jedes Orts und seiner Umgebung genießen, nach Belieben aussteigen, um an einem besonders schönen Punkt zu weilen, oder auch nur, um ein Stück zu gehen oder mit Landeskindern zu plaudern, hier und da von der Hauptstraße abbiegen und Orte aufsuchen, die der Touristenschwarm noch nicht gefirnißt hat: Das möchte ich allerdings gern auch heute noch. Es kommt eben auf den Zweck an. Der Breslauer, der in Berlin ein zweistündiges Geschäft abzuwickeln hat oder der vier Ferienwochen darauf verwenden will, Rom zu studiren, segnet natürlich die Eisenbahn, die ihm ermöglicht, Berlin in sechs Stunden, Rom in zwei Tagen zu erreichen. Aber wer den Thüringer Wald, Land und Leute, die Fauna und Flora kennen lernen und genießen will, Der benutzt mehr seine natürlichen als irgendwelche künstliche Fortbewegungwerkzeuge. Zwar giebt es auch Vergnügungreisende, die in einem Waldgebirge von Station zu Station fahren und sich von den Stationen nicht entfernen, Leute vom Schlage des biederen Gutsbesitzers, der mir einmal sagte: „Wenn ich reise, dann sehe ich mir die Berge von unten, die Kirchen und Museen von außen und die Gasthäuser von innen an." Man darf solche Leute noch nicht Thoren schelten; aber mit der Kultur haben ihre Erholungreisen nichts zu schaffen. Die Kulturentwickelung verläuft eben so wie die Entwickeluug der Natur nicht gradlinig in der Weise, daß jeder Fortschritt zu einer Neuschöpfung die Schöpfungen der vorhergehenden Stufe vernichtet, sondern hat ihr Sinnbild in der
220 - Die Zukunft.
Pflanze, die, alle in ihrem Keime liegenden Möglichkeiten allmählich verwirklichend, diesen Keim zu einem Stamm mit einer, aus Aesten, Blättern und Blüthen bestehenden Krone entfaltet, wobei das Alte bleibt, während das Neue hervorsproßt, und in der zu einem Reichthum lieblicher Gebilde auseinandergehenden Knospe der Prozeß sich im Kleinen wiederholt. Entwickelung bedeutet wachsenden Reichthum an Gebilden, zunehmende Mannichfaltigkeit. Nur ein Narr könnte den technischen Fortschritt ungeschehen wünschen, nur ein Irrenhäusler ihn ungeschehen machen wollen; aber ein Narr ist nicht minder, wer mit Allem aufräumen will, was frühere Zeiten geschaffen haben. Läßt der Mensch doch auch gern seine entfernten vierbeinigen und geflügelten Vettern leben, die vor ihm entstanden sind. Sogar die Raubthiere mag er nicht missen: er hegt sie in Zoologischen Gärten. Es ist möglich, daß dereinst einmal die Vierbeiner sowohl als Motoren wie als Nahrungspender überflüssig gemacht werden, in dieser Eigenschaft auch die Pflanzen; aber wie entsetzlich arm wäre eine Erde, auf der es das edle Roß, das gemüthliche Rind, das putzige Hühnervolk nicht mehr gäbe, keine grüne Saaten, keine wogenden Kornfelder, keine blühenden und später mit rothen und blauen Früchten beladenen Obstbäume, keine Weinstöcke mehr, sondern nur noch eisenstarrende Maschinenbauanstalten und Chemische Laboratorien. Der Vernünftige begrüßt dankbar jeden technischen Fortschritt, fragt jedoch in jedem einzelnen Fall, wo er von ihm Gebrauch machen kann, ob es nicht vielleicht vortheilhafter sei, den alten Gebrauchsgegenstand oder das alte Verfahren zu wählen. Das war eine der Ergänzungen, an die ich erinnern wollte. Der Mensch braucht nicht nur die Produkte der Arbeit, er braucht auch die Arbeit selbst, und wenn die Energieersparniß, die ihm ein technischer Fortschritt ermöglicht, von dem Verlust an körperlicher Gesundheit und seelischer Befriedigung aufgewogen oder überwogen wird, die ihm die Arbeit nach der alten Methode gewährt, so verzichtet er auf diese Ersparniß. Macht doch nach Ostwald nicht sowohl die Energieersparniß als vielmehr ein möglichst großes Quantum freiwilliger Energieausgabe glücklich; und welchen höheren Zweck kann es geben als Menschenglück?
Die Frage der Wahl zwischen alten und neuen Verfahrungweisen ist heutzutage brennend im Gebiete der Hauswirthschaft. Die Ersparniß an Zeit, Kraft und Geld, die das Einküchenhaus gewährt, liegt so auf der Hand, daß es höchst überflüssig wäre, wollte ich so oft Beschriebenes noch einmal beschreiben. Aber das Einküchenhaus bedeutet den ersten Schritt zur Auflösung der Familienwirthschaft und seine Konsequenz ist das Phalanstère, die
221 - Energetik und Hauswirthschaft.
sozialistische Auflösung der Familie. Nun ist in einer normalen Familie, die noch gar nicht Idealfamilie zu sein braucht, der Reichthum an gemüthlich und ethisch werthvollen Beziehungen zwischen den Gatten, zwischen Eltern und Kindern, zwischen den, Geschwistern so groß, daß er durch keine noch so große Ersparnis; aufgewogen werden kann. Man darf also zwar das Einküchenhaus für Proletarier wählen, denen Armuth und Broterwerb der Frau ein wirkliches Familienleben unmöglich und die Einzelwirthschaft durchaus unzweckmäßig machen; doch soziale Schichten, denen Beides möglich ist, würden eine frevelhafte Thorheit begehen, wenn sie um einer Geldersparniß willen darauf verzichteten. Das Familienleben hat, wie alles Gute auf Erden, seine Schattenseiten, für die ich volles Verständniß habe. Starker Familiensinn absorbirt alle Kraft zur Liebe im Schoß der Familie und hat für die draußen Stehenden nichts übrig, schließt sich wohl gar feindsälig gegen Alles ab, was nicht zur eigenen Sippe gehört, macht unsozial bis an, bis über die Grenze, hinter der das Verbrechen liegt. Kenner Frankreichs haben dort diese Ausartung besonders oft wahrgenommen: der Franzose, die Französin heirathe nicht ein Weib, einen Mann sondern einen ganzen Clan, Schwiegereltern und Vetternschaft, und bleibe für Lebenszeit hineingebannt; eine nicht gerade seltene Erscheinung sei der Bourgeois, der sich mit selbstgefälligem Schmunzeln sage: „Wieder Einen übers Ohr gehauen und zehntausend Francs für unser Mariechen zurückgelegt!" Und Heinrich Schurtz hat in seinem Werk „Altersklassen und Männerbünde" nachgewiesen, daß die Familie keineswegs, wofür man sie gewöhnlich hält, der Keim des Staates ist; die Familie reiche höchstens zur Sippenbildung aus; größere politische Gründungen pflegten von einer Kraft auszugehen, die zum Familienleben im Gegensatz steht und sich ihm nicht selten feindlich erweist: vom Geselligkeitstriebe der Männer. Darüber wären viele unterhaltende Feuilletons zu schreiben, mit der modernen Variation, daß jetzt die Suffragettes die familienfeindlichen Hosen tragen. Vielleicht beobachte ich falsch, aber ich glaube, eine Erscheinung wahrzunehmen, die dem konservativen, vor politischen Neubildungen bangenden Staaterhalter zu einiger Beruhigung dienen dürfte. In meiner Jugend, um 1848 herum, wo der darniedergehaltene Geist der Burschenschaften explodirte, gab es wenig Gymnasien; die Gymnasiasten waren darum zum größten Theil „Auswärtige" und wohnten in Konvikten oder in Massenquartieren. Ihr Lebenselement war also nicht die Familie, sondern die Schule und die Kameradschaft, ihre Erholungzeit verlief in Spielen und Ausflügen mit Kameraden. Der so erwachsende
222 - Die Zukunft.
Kameradschaftgeist ergriff auch die am Ort ansässigen Schüler. Die schämten sich ein Wenig, wenn sie einmal mit dem „Alten", mit Frau Mama und Mamsell 'soeur' statt im Kreis von Kameraden öffentlich erblickt wurden. Wir brauchten damals nicht „politisirt" zu werden, wir waren es schon; waren ein kleiner Staat. Heute liegen die Gymnasien kaum eine Bahnsrunde von einander entfernt; die meisten Gymnasiasten sind Ortsansässige, leben in ihren Familien und sind deren Anhängsel; die Roth-, Blau- und Grünkappen sieht man nur beisammen, wenn sie aus der Schule geströmt kommen, nicht im freien Feld; jeder Bursch geht mit seiner Familie „spaziren". In England trägt die College-Erziehung gewiß nicht wenig dazu bei, den Söhnen der Vornehmen den staatsmännischen Geist einzupflanzen. Daß Mönchsthum und Priestercoelibat dem Familienegoismus entgegenwirken, ist in der Bilanz der Katholischen Kirche auf die Kreditseite zu schreiben. Also dieses Mißverdienst der Familie und dieses Verdienst der Männer-, meinetwegen auch der Frauenbünde erkenne ich an; aber auch hier wäre es unvernünftig, um eines Gutes willen ein anderes Gut zu vernichten; die Gesellschaft bedarf beider Güter, der Familie wie der sozialen und kameradschaftlichen Verbindung Nichtverwandter, und der Einzelne kann sich des Segens beider Institutionen freuen, wenn er sich nicht durch ewige Gelübde an eine von beiden fesselt.
Vor zwei Jahren wurde in der „Neudeutschen Bauzeitung" das Problem des Einküchenhauses behandelt. Auf die Erörterung der wirtschaftlichen, der ethischen und der sozialen Seite der Sache wurde ausdrücklich verzichtet und nur dargethan, daß die Vereinfachung des Grundrisses und die Kostenersparniß dem Architekten diese Art Häuser vor den jetzt üblichen Miethhäusern empfehle. Aber in dem Aufsatz werden doch auch Gutachten mitgetheilt, die einige nichtbaumeisterliche Seiten der Frage berühren, und einer der Gutachter, Henry van de Velde, citirt das folgende Wort einer Amerikanerin: „Fünfzig Feuer da, wo ein einziges genügen würde! Sie können ja an Ihrem Tisch im Familienkreis mit Ihren Kindern essen, wenn Sie wollen; aber warum sollen fünfzig Frauen ihre Morgenstunde verlieren, um ein paar Tassen Kaffee zumachen?" Wenn nun aber das Kaffeekochen den fünfzig Frauen Vergnügen macht? Und wenn es dem Manne und den Kindern Genuß bereitet, das Brodeln des siedenden Wassers zu hören und den Kaffeeduft eine ganze Viertelstunde lang zu riechen? Mit Ausnahme gewisser Säuberungverrichtungen sind alle hauswirthschaftlichen Arbeiten so, daß sie einem körperlich und seelisch gesunden Menschen Vergnügen machen. Wie gern helfen die Kinder dabei; nicht nur,
223 - Energetik und Hauswirthschaft.
wenn es Etwas zu naschen giebt. Und ein wie großer Vorzug ist die Mannichfaltigkeit und stete Abwechselung! Ihre Morgenstunde verlieren! Wieso denn verlieren? Verloren wäre die auf das Kaffeekochen verwendete Zeit doch nur dann, wenn etwas Angenehmeres oder Nützlicheres hätte gethan werden können. Was? Zeitunglesen? Goethe verabscheute es. Romanlesen? Dazu ist doch wohl am Feierabend noch Zeit; welcher gesunde Magen vertrüge zwölf Stunden Romanleserei! Unterhaltung mit dem Mann? Manchem Manne wird des Schwatzens schon während der Mahlzeit zu viel. Ein Stück von dem Roman schreiben, den sie selbst dichtet? Daß heutzutage Hunderttausende von Frauen und Mädchen sich mit Männerarbeit ihr Brot verdienen müssen, ist eine traurige Thatsache, die vorläufig Niemand ändern kann, aber den Frauen, die es noch nicht nöthig haben, die hauswirthschaftliche Arbeit abnehmen, damit auch sie vollends den Männern Konkurrenz machen können: Das wäre denn doch das Tollste aller Schildbürgerstücklein. Ich halte drei Viertel von Dem, was ich seit dreißig Jahren schreiben mußte, um leben zu können, für überflüssig; man wird mir darum nicht zumuthen, glauben zu sollen, daß Alles, was die verehrten Kolleginnen schreiben (ausgenommen natürlich die wirklichen Dichterinnen und solche Frauen, die wichtige Lebenserfahrungen oder Studienergebnisse mitzutheilen haben) fürs Wohl der Menschheit nothwendig oder ungemein förderlich sei. Wahrscheinlich denken und fühlen eben so die Maler, die Musiker und alle anderen Kategorien von Männern, deren Konkurrentenkreis durch weiblichen Zustrom vergrößert wird.
Mitunter hört und liest man, den Frauen bleibe darum nichts Anderes übrig, als Männerarbeiten zu betreiben, weil es im Haus thatsächlich nichts mehr zu thun gebe. In der Großstadt mag ja das Angebot von halb und ganz fertigen Gebrauchsgegenständen und an wohlfeilen Dienstleistungen so überwältigend sein, daß sich jede Frau für eine Thörin halten würde, wenn sie sich noch mit der Herstellung oder Verrichtung im Hause mühen wollte; in der Provinz jedoch sind wir noch nicht so weit. Goethe hat dem würdigen Freunde, den das Überhandnehmen der Lesewuth um das Heil seiner Mitmenschen besorgt machte, zwei reizende Episteln geschrieben, deren zweite lehrt, wie die Töchter des Hauses vorm Lesen bewahrt werden können, und schließt:
Wahrlich, wären mir nur der Mädchen ein Dutzend im Hause,
Niemals wär' ich verlegen um Arbeit, sie machen sich Arbeit
Selber genug, es sollte kein Buch im Laufe des Jahres
Ueber die Schwelle mir kommen, vom Bücherverleiher gesendet.
224 - Die Zukunft.
Goethes Rezept setzt den Besitz von Gärten, Weinbergen und Weinkellern voraus. Solcher Besitz kommt ja glücklicher Weise auch heute noch vor; aber er ist gar nicht erforderlich, den weiblichen Theil der Familie mit Arbeit zu versorgen. Auch ohne Obst-, Gemüse und Weinplantagen giebt es genug zu thun, wenn auch natürlich nicht mehr gesponnen wird und Talglichte nicht mehr gegossen werden. Für den Fall, daß Großstädterinnen von einem altmodischen Familienhaushalt keine Vorstellung mehr haben, will ich einen von der Art, wie es ihrer in Klein- und Mittelstädten und auf dem Lande noch genug giebt, beschreiben. Zunächst wird alle Nadelarbeit im Hause geleistet; Gewand und Leinzeug in der Wäsche sehr vorsichtig und sorgfältig behandelt, so oft wie möglich ausgebessert, jeder noch brauchbare Stoffrest vom Abgelegten bei Neuanfertigungen mit verwendet, so daß Anschaffungen selten nothwendig werden. Diese Praxis nimmt die deutsche Hausfrau auch nach Amerika mit, wenn sie auswandert. Ein deutschamerikanischer Volkssänger, der in Knüttelversen mit dem Dichter des Faust rivalisirt, besingt diese Tugend der deutschen Matronen und bemerkt dann: „Die Yankeefrau ist weniger fleißig; ist was zerrissen, schmeißt sies weg." Das mag heute wohl auch für manche deutsche Frau zutreffen; in der Großstadt und in Industriebezirken. Jede Woche einmal wird Brotmehl gekauft und Teig geknetet, die Brotform dann zum Bäcker geschickt. Die Ersparniß beträgt ja nur wenige Nickel an jedem Gebäck, aber man hat immer ein kräftiges und wohlschmeckendes Brot. An den Hochfesten und Geburtstagen erfreut die Kuchenbäckerei die thatenlustige Jugend und die Nasen der ganzen Familie. Aus einem Kuhstall des benachbarten Dorfes wird täglich Milch geholt, der Rahm zweimal in der Woche verbuttert. So hat man jeden Tag im Jahr frische, von eklen Beigeschmäcken freie Butter, die kerniger ist als Molkereibutter, und ein paar Tage lang frische Buttermilch, ein erquickendes, nahrhaftes, wohlschmeckendes Getränk, das, wie der Volksmund sagt und der Arzt bestätigt, neunundneunzig Krankheiten heilt und vor Krankheit bewahrt. Nicht wenig Arbeit verursacht das Fleisch. Es gehört zu den Vortheilen der Anstalt- und Kasernenwirthschaft, daß sie immer gutes Fleisch haben kann, weil sie täglich ein großes Stück einkauft. Die tüchtige Hausfrau bringt wenigstens ein größeres Stück vom Markt und theilt es auf mehrere Tage ein; das Lagernde durch Pökeln und andere Manipulationen vorm Verderben zu schützen, kostet aber Arbeit. Im Frühsommer beginnt das Abkochen, Einlegen und Abbacken von Beeren, Obst und Gemüse und dauert bis in den Herbst. Von Martini an beleben die Gänse das
225 - Energetik und Hauswirthschaft.
Haus; werden sie gemästet, schon früher. Die Gans ist eins der edelsten Geschöpfe Gottes, denn es giebt keinen Theil ihres Leibes, der nicht dem Menschen nützte. Dabei ist sie nicht dumm, wie man wahrnimmt, wenn man ihren täglichen Wandel auf dem Dorf beobachtet. Das beim Schlachten ausgelassene Blut wird als Blutwurstfüllsel zubereitet. Die Federn werden gesammelt und, sobald ihrer genug beisammen sind, geschlissen (Schleißen nennt man in Schlesien das Abziehen der Fahnen von den Kielen; eine hochdeutsche Bezeichnung für diese Operation kenne ich nicht). Eine leichte mechanische Beschäftigung, die mit heiterer Unterhaltung oder Vorlesung gewürzt zu werden pflegt. Die geschlissenen Federn werden in Indelten (Inletts) gefüllt, und wird eine Tochter heirathfähig, so liegen ihre vier Gebetten bereit; beim Händler braucht keins gekauft zu werden. Wie das Fleisch und das Fett der Gans verwerthet werden, wissen ja wohl auch die Berlinerinnen; aber vielleicht versteht nicht jede, aus den knorpeligen Theilen Gallert zu bereiten, was die Provinzfrau ebenfalls kann. So giebt es also in einem solchen Haushalt für eine kräftige Frau und zwei heranwachsende oder erwachsene Töchter vollauf zu thun und von einer Nothwendigkeit, den Familienhaushalt aufzugeben, kann fürs Erste noch nicht die Rede sein. Für Das, was von einer wohlhabenden Frau an Armenpflege und Jugendfürsorge gefordert wird, läßt
die Hauswirthschaft schon die nöthige Zeit übrig.
Dieser Aufsatz war konzipirt, lange bevor mir Ostwalds letztes Buch in die Hände kam. Es ist, wie die Leser wissen, eine Sammlung von Abhandlungen und Vorträgen, die der große Chemiker und Naturphilosoph unter dem Titel „Die Forderung des Tages" (in der Akademischen Verlagsbuchhandlung) herausgegeben hat. Wir lernen daraus das großartigste und schönste aller Weltbilder, die je mit rein physikalischem Material entworfen worden sind, vollständig kennen und der Genuß, den es gewährt, wird durch das Bild des liebenswürdigen und glücklichen, wahrhaft glücklichen Menschen erhöht, der uns daraus so körperhaft und lebenswarm entgegentritt, daß ein Künstler ihn malen könnte, ohne ihn selbst oder seine Photographie gesehen zu haben. Freilich: unvollständig ist auch dieses Weltbild; die Gedanken- und Gefühlswelt von Goethe, Schiller und Wilhelm von Humboldt darin unterzubringen, würde schwierig sein. Daß ich Ostwalds Erwartung, die Gesammtheit der psychischen Erscheinungen werde dereinst auf eine den übrigen Energieformen äquivalente Energieform zurückgeführt werden können, nicht zu theilen vermag, habe ich schon
226 - Die Zukunft.
gesagt; die Gründe, die Lotze (der als strenger Atomist noch nicht mit dem Energiebegriff arbeitete), Eduard von Hartmann, Johannes Reinke, Otto Liebmann dagegen anführen, erscheinen mir unwiderleglich. Die drei zuletzt Genannten beweisen auch, daß schon das organische Leben in die Energieformen nicht eingereiht werden kann. An Hartmanns Diktum: Das Leben leitet die Energie auf seine Mühle, aber es ist nicht selbst Energie (im heutigen technischen Sinne des Wortes) klingt folgende Aeußerung Ostwalds im vorliegenden Buche an: „Hält man sich, frei von allen Hypothesen, an die beobachteten Thatsachen, so erkennt man als allgemeines Kennzeichen der Lebenserscheinungen den stationären Energiestrom, der durch ein verhältnißmäßig konstantes Gebilde läuft." Wie ein solches Gebilde, mit dessen wunderbarer inneren Struktur und Mannichfaltigkeit der äußeren Gestalt, mit dessen nach eigenen Gesetzen sich vollziehender Entfaltung, Selbsterneuerung, Selbstregulirung, Fortpflanzung das einzige konstante Gebilde der unorganischen Welt, der Kristall, gar nicht zu vergleichen ist, entstehen konnte, wie es zugeht, daß der unaufhörlich hindurchflietzende Energiestrom, statt es aufzulösen, seinem Aufbau und seiner Erhaltung dienen muß (sobald das unbekannte Etwas, das alle Energieformen in seinen Dienst zwingt, entwichen ist, verrichten diese ihre auflösende Arbeit): Das ist es, was als bloßer Umsatz von Energieformen in einander nicht begriffen werden kann. Arthur Drews endlich, augenblicklich der Schwarze Mann für die orthodoxen wie für die liberalen Theologen, ist der Meinung, man müsse „dem modischen Vorurtheil entsagen, als ob eine wirkliche Lösung der sogenannten Welträthsel mit Hilfe naturwissenschaftlicher Erfahrung zu Stande zu bringen und eine einheitliche Weltanschauung nur auf naturwissenschaftlicher Grundlage möglich sei. Die Naturwissenschaft hat es immer nur mit der einen, der materiellen Seite der Wirklichkeit zu thun, deren mechanische Gesetzlichkeit sie aufdeckt. Sie überschreitet folglich ihre Grenzen, wenn sie auch die andere, die geistige Seite, in ihre Betrachtungen hineinzieht." Ausdrücklich muß jedoch hervorgehoben werden, daß Ostwald solche Grenzüberschreitung nirgends begeht. Wenn er den Energiebegriff für alle Lebensgebiete fruchtbar macht, so meint er immer nur die Energie im physikalischen Sinn des Wortes, die ja thatsächlich bei aller Kulturthätigkeit eine ungemein wichtige und mitunter (man denke an den Weltverkehr) die entscheidende Rolle spielt. Was er in Beziehung auf die vermuthete psychische Energieform von zukünftigen Leistungen der Wissenschaft erwartet, Das verwendet er nicht, als ob es schon geleistet wäre.
227 - Energetik und Hauswirthschaft.
Ostwald erklärt den Materialismus für überwunden und den Begriff Materie für unhaltbar; das einzige Seiende, die Weltsubstanz, sei die Energie. Daß die Atome nicht als raumerfüllende Klümpchen oder Kügelchen zu denken sind, sondern als mathematische Punkte, von denen Kraftwirkungen ausgehen, wissen wir seit Lotze; aber mit der Behauptung, daß die Energie das allein Seiende und die (natürlich nur als ein System punktueller Energieträger zu denkende) Materie abgethan sei, scheint der Satz in Widerspruch zu stehen: „Was man weder schaffen noch vernichten kann, nennt man eine Substanz; so haben die chemischen Elemente den Charakter von Substanzen, aber auch die Arbeit und ihre Umwandlungprodukte haben ihn; diese nennt man mit einem gemeinsamen Namen Energie." Die Gesammtheit der chemischen Elemente ist doch wohl Das, was man bisher unter Materie verstanden hat. Mit der Materie zugleich will Ostwald bekanntlich auch die Atomistik abgesetzt haben. Der Chemiker bedürfe ihrer nicht; sie sei weder hinreichend, die stöchiometrischen Gesetze zu ergeben, noch für diesen Zweck nothwendig. Den Grund zu diesem Gesetz habe der 1807 verstorbene Jeremias Benjamin Richter gelegt, indem er als Erster Zahl und Maß in der Chemie zur Geltung brachte. Er sei jedoch über seinen Tod hinaus übersehen und verkannt worden und das Schlimmste sei gewesen, daß um die Zeit seines Todes Daltons Atomhypothese auftauchte. Ob die Chemie ihre Berechnungen ohne die Annahme von Atomen und Molekeln auszuführen vermag, ist nun eine Angelegenheit, welche die Chemiker unter sich auszumachen haben und die den Laien nicht angeht. Dieser liebt die Atomhypothese, weil sie die Vorgänge der physikalischen Welt vorstellbar macht. Ostwald erklärt nun zwar diese Anschaulichkeit für werthlos und gebietet: „Du sollst Dir kein Bildniß oder Gleichniß machen", sollst Dir an algebraischen Formeln und Zahlen genügen lassen. Doch gilt dieses filmische Donnerwort hoffentlich nur seinen Fachgenossen; wir armen Laien sind nun einmal unbekehrbare Heiden und hängen an Bildern, wenn wir sie auch nicht gerade anbeten. Uebrigens wird die Ablehnung der Atomistik später eingeschränkt und Ostwald erklärt die Ansicht für irrig, daß zwischen seiner Energetik und der Atomistik ein grundsätzlicher Gegensatz obwalte.
Ostwalds Buch ist höchst anregend und es müßte im schreibseligen deutschen Vaterlande wunderbar zugehen, wenn daraus nicht ein paar hundert Zeitschriftenartikel und ein paar Dutzend neue Bücher entstünden.
Neisse. Karl Jentsch.