
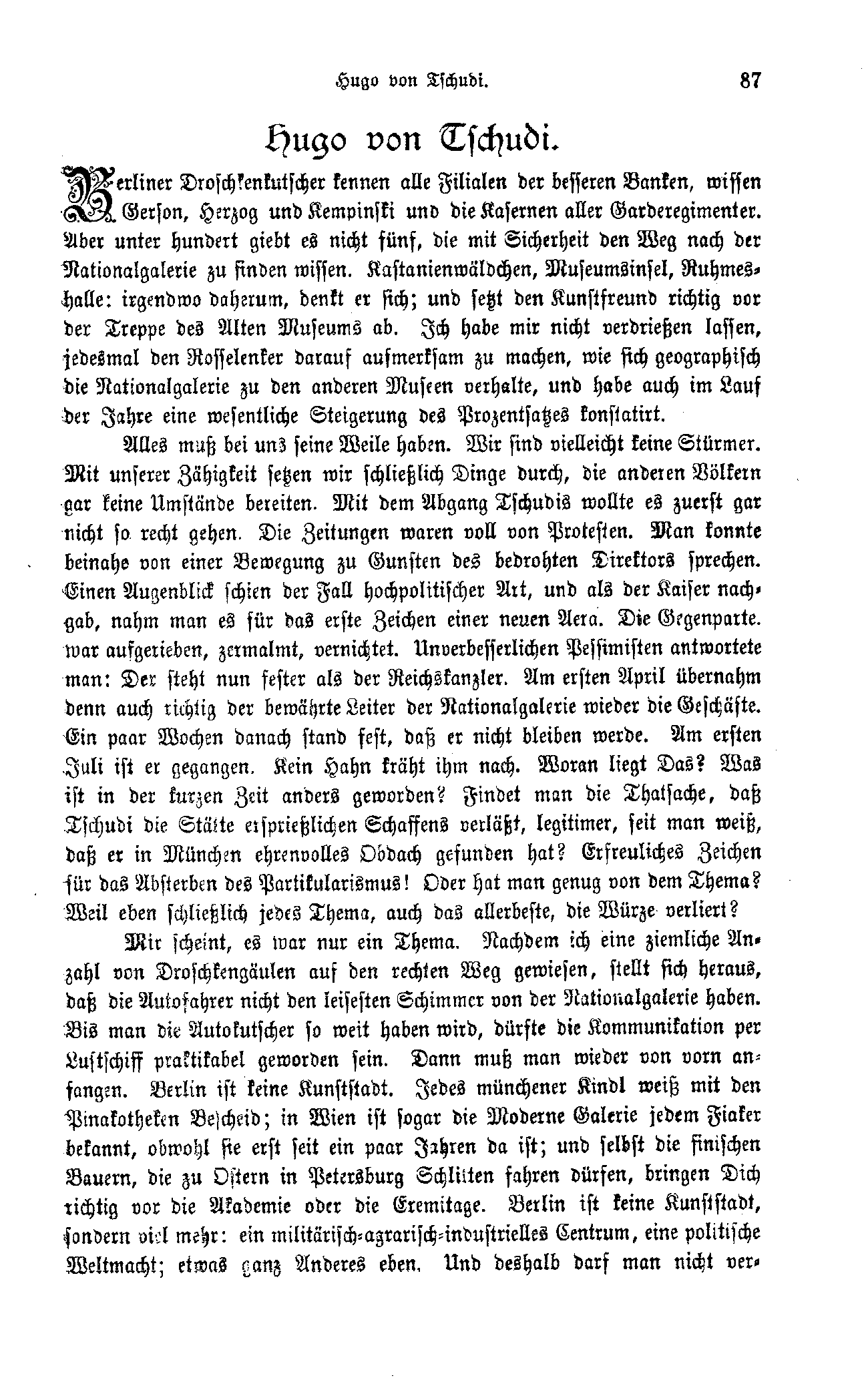
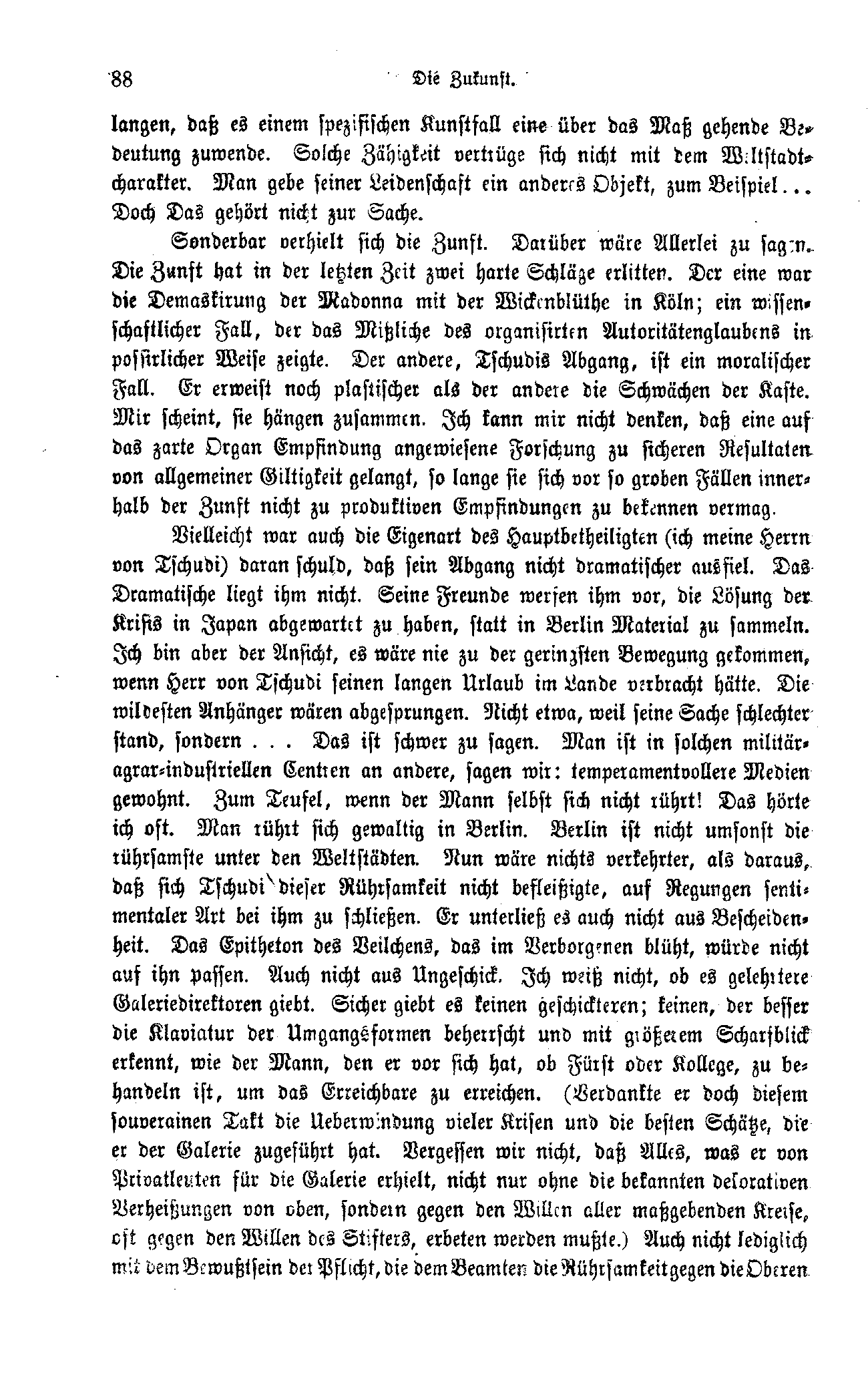
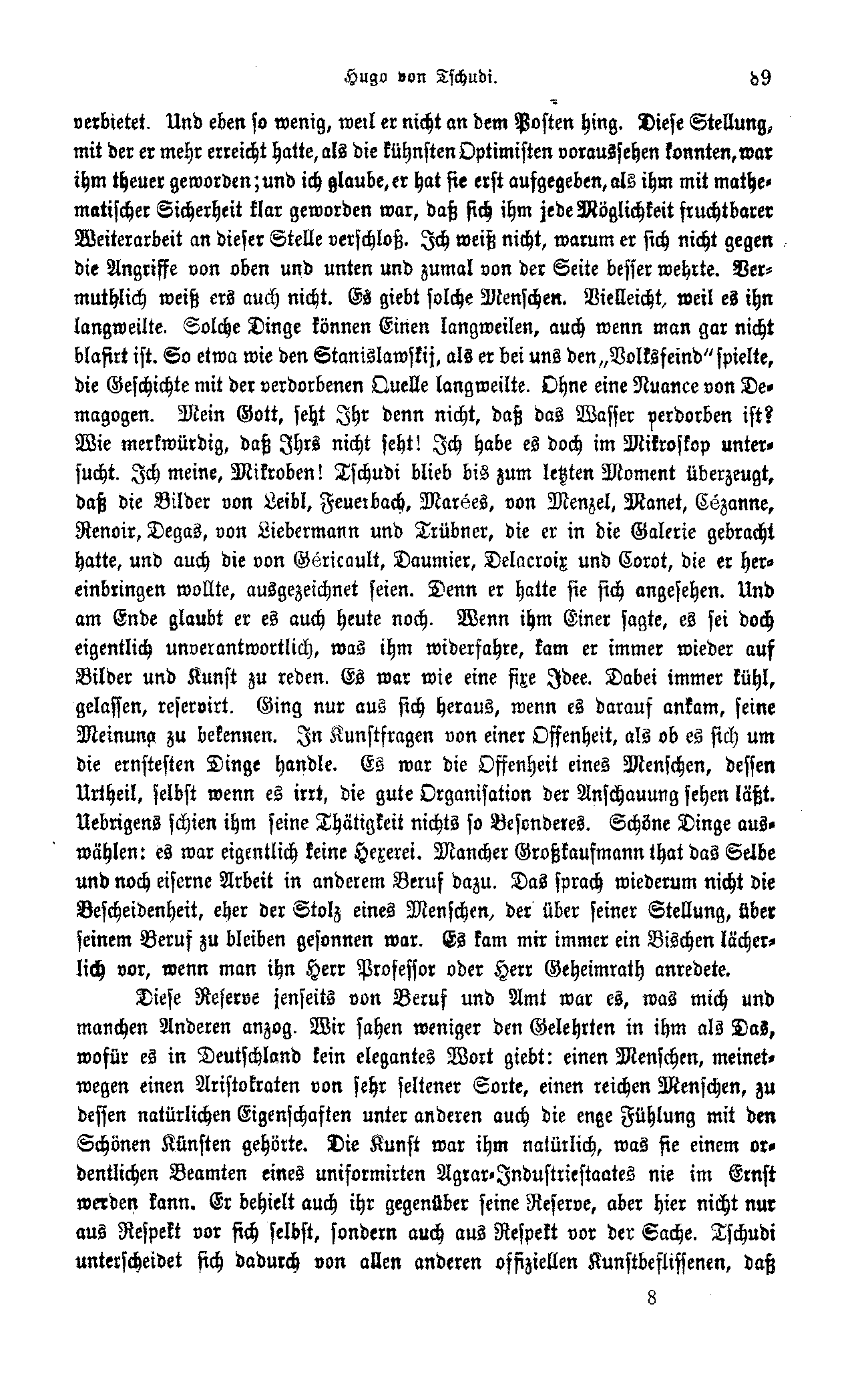
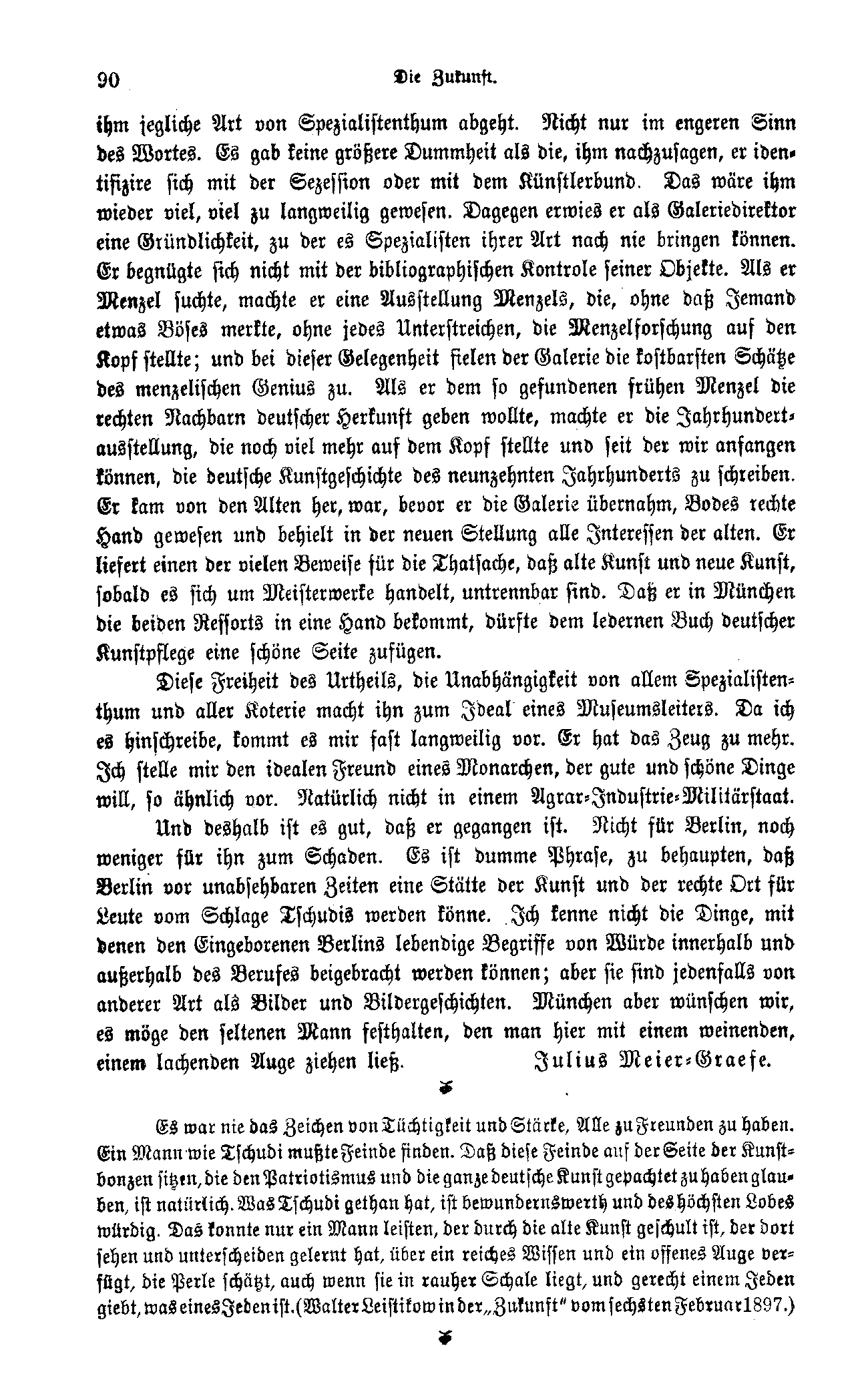 von Bode:
von Bode:
 Text
WDR
Kipphoff
Presler
Text
WDR
Kipphoff
Presler

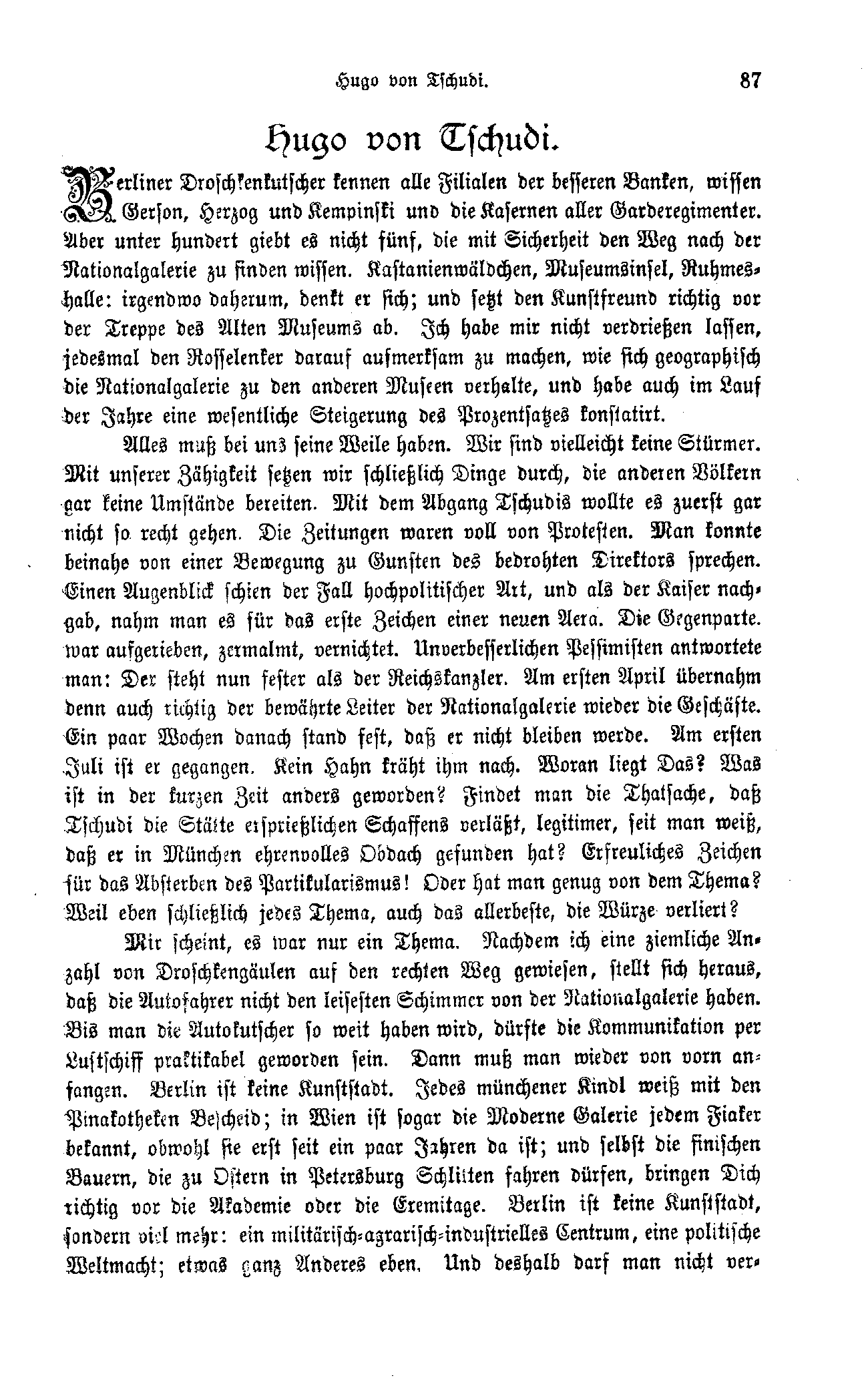
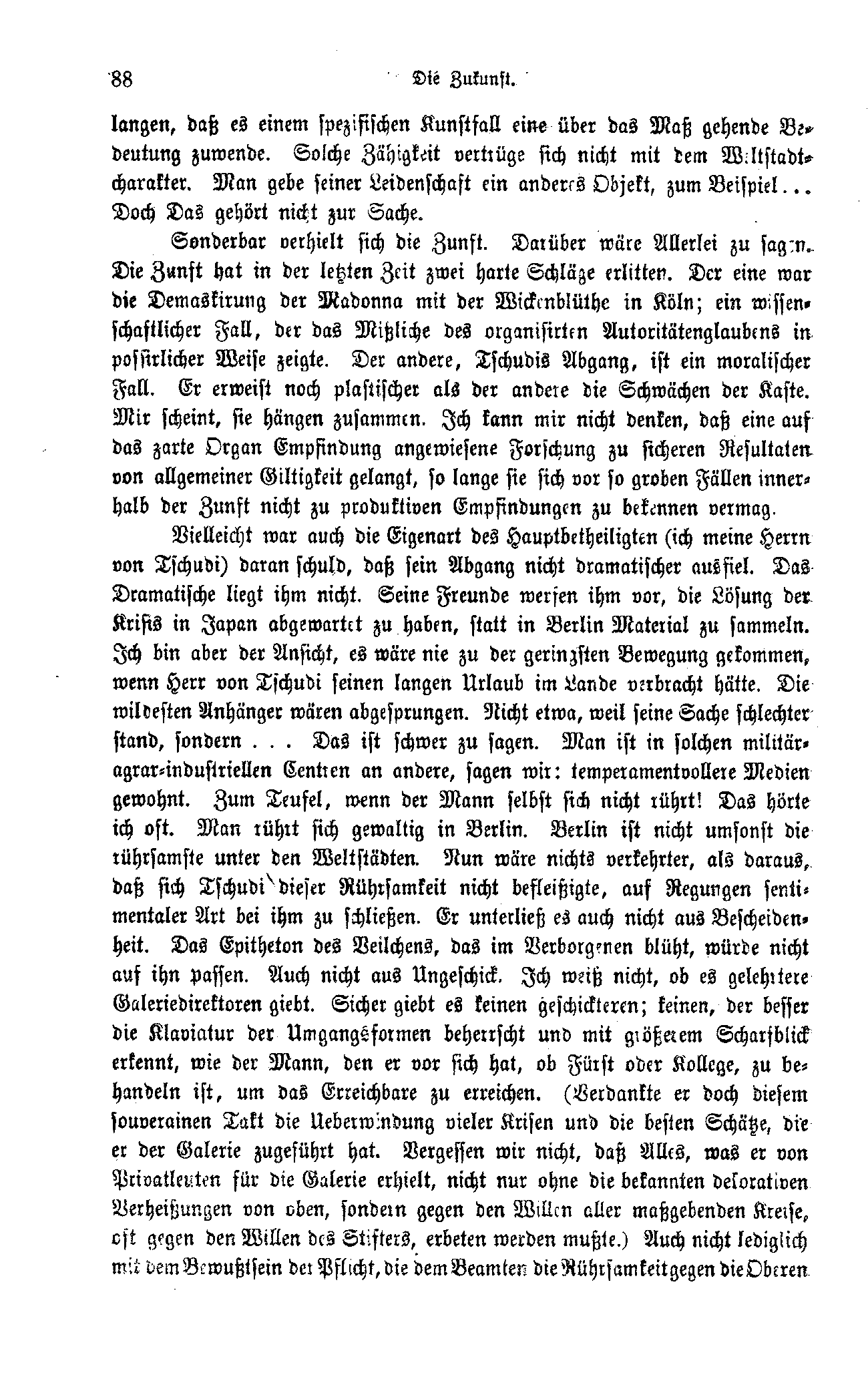
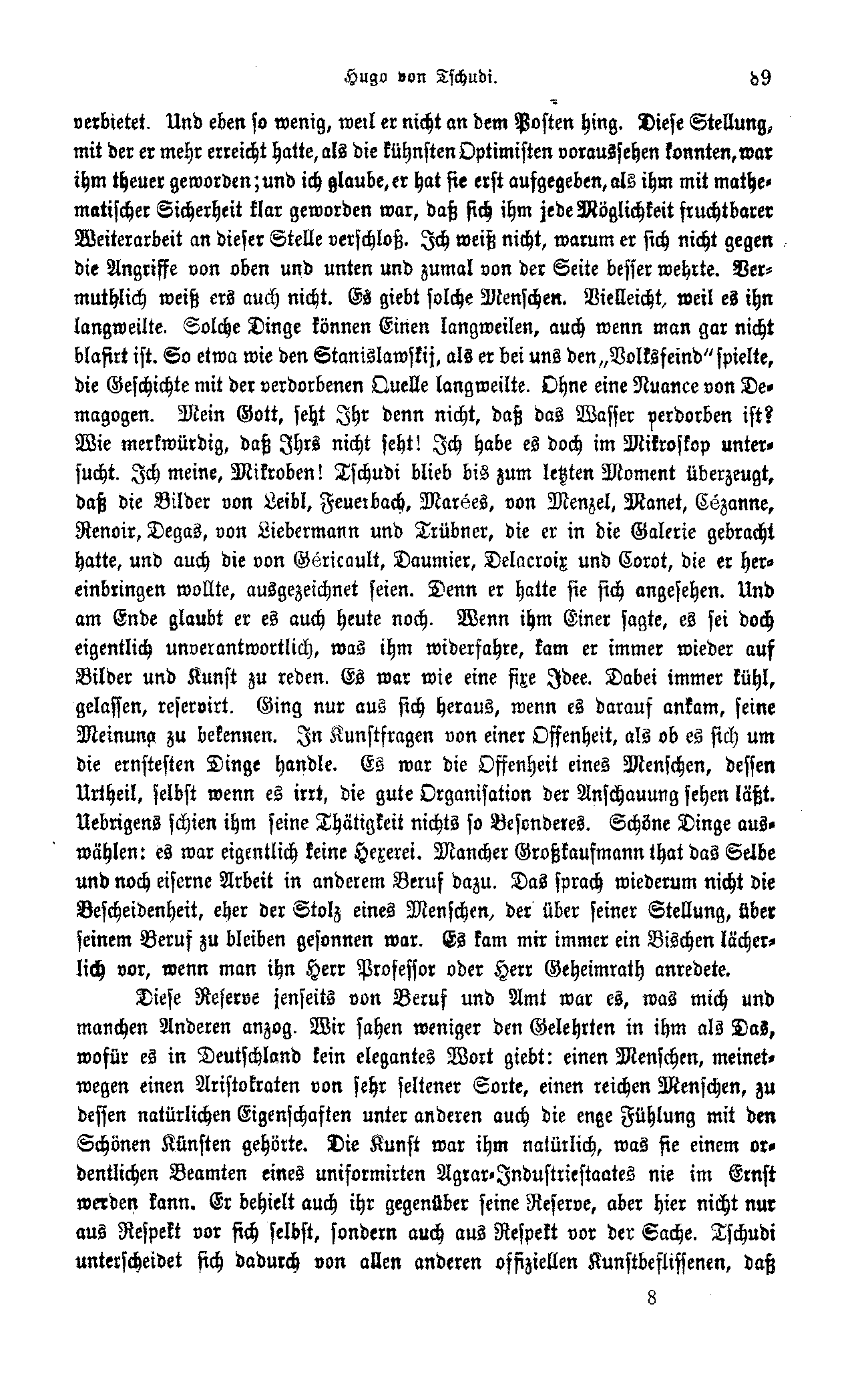
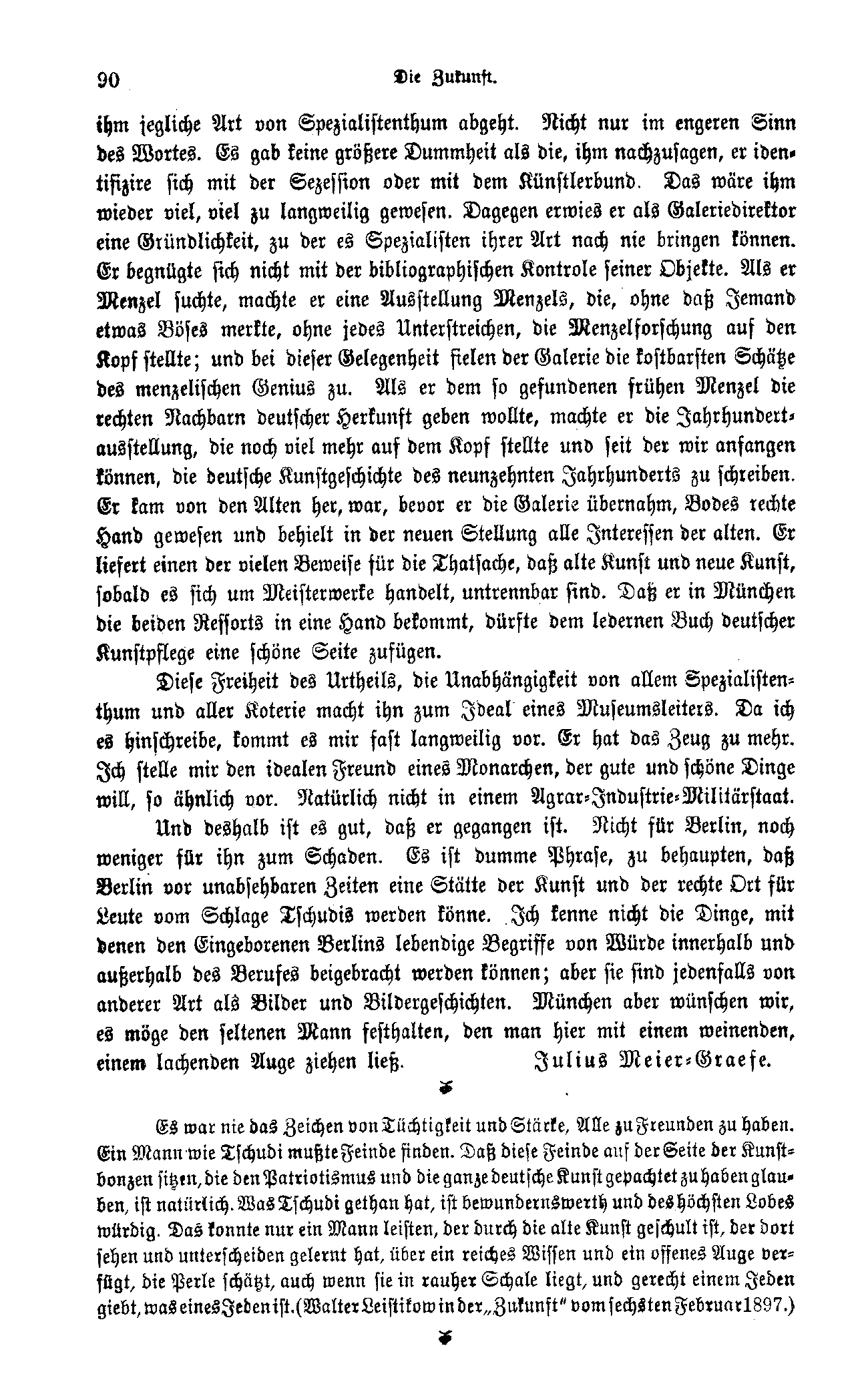 von Bode:
von Bode:
 Text
WDR
Kipphoff
Presler
Text
WDR
Kipphoff
Presler

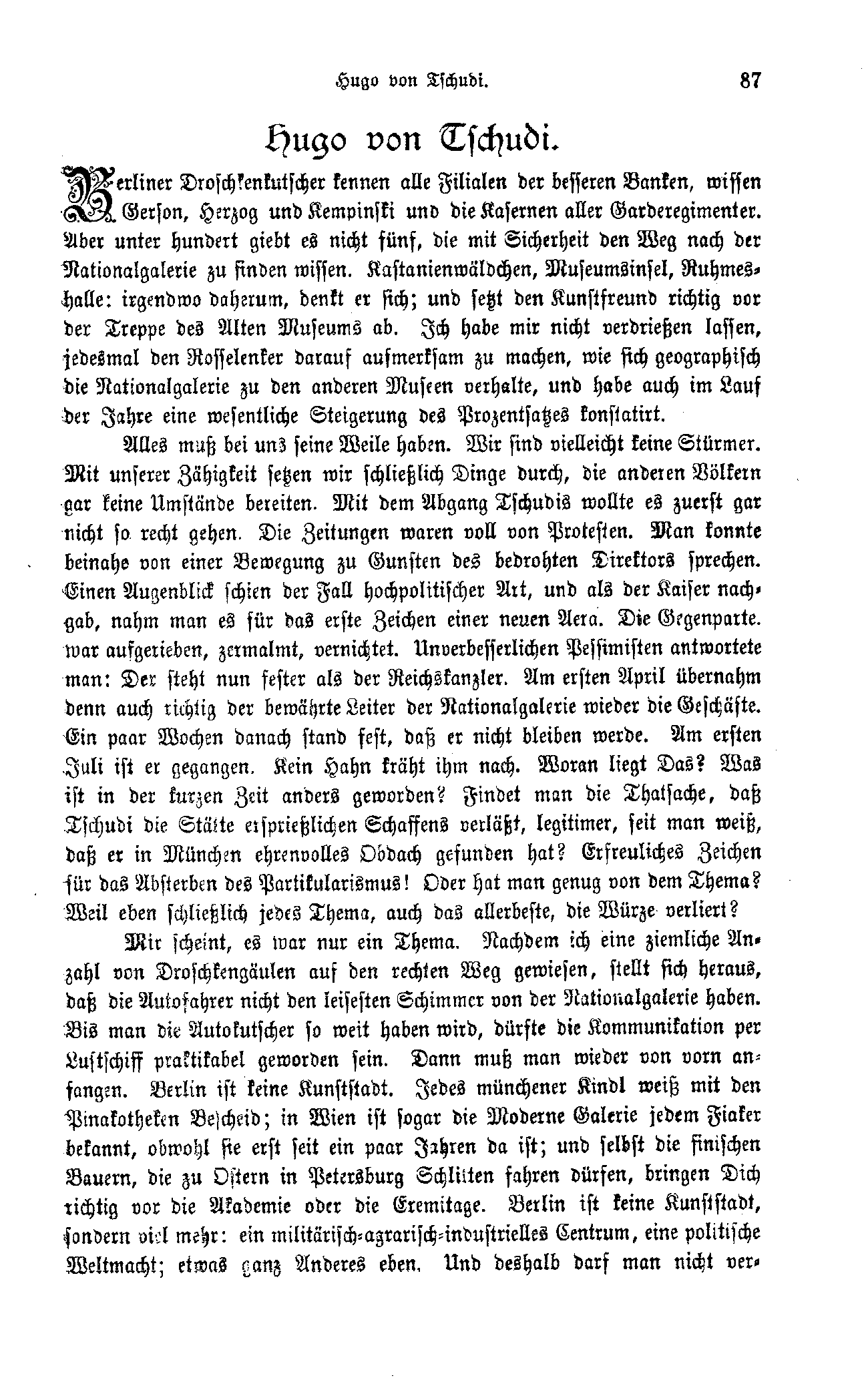
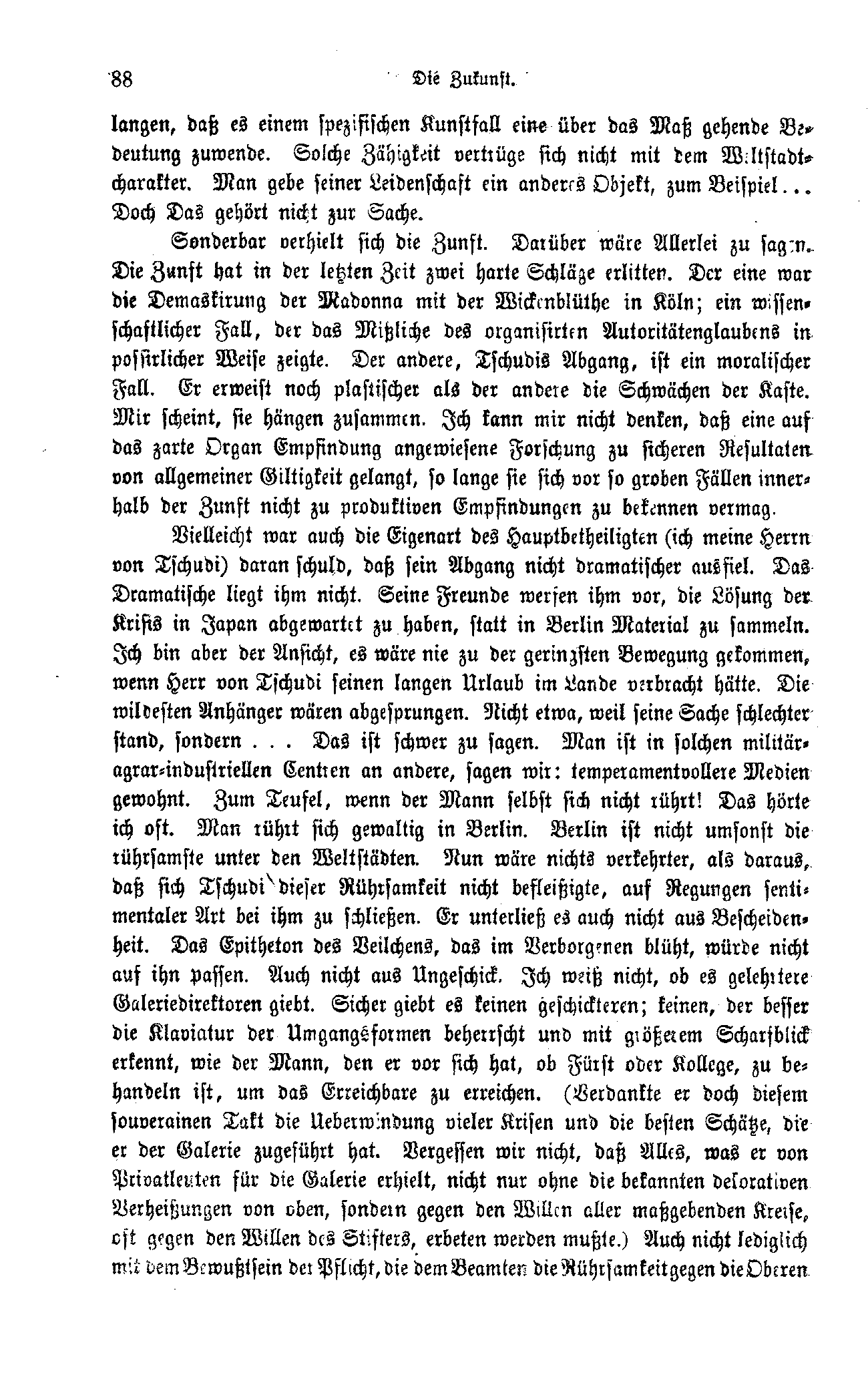
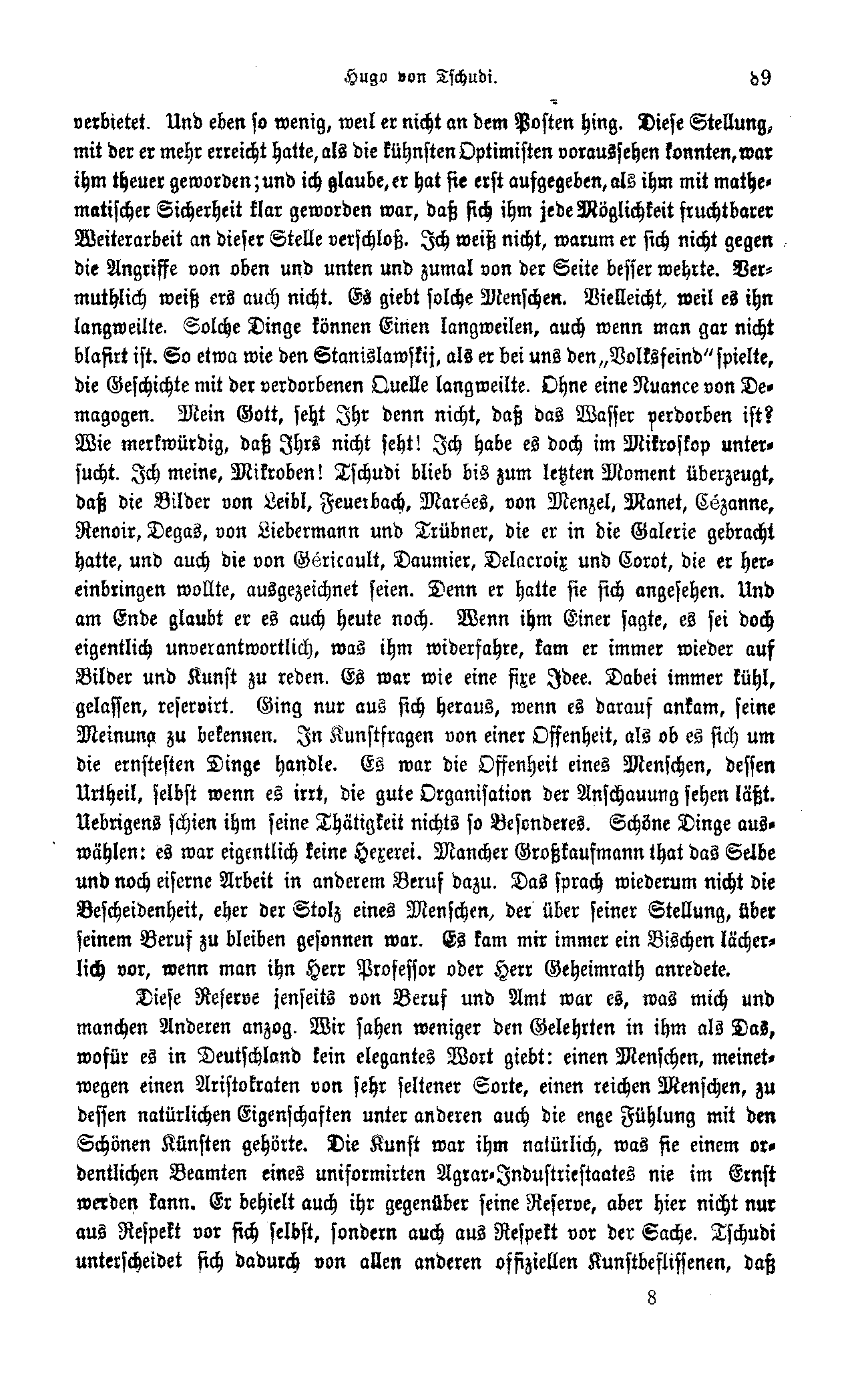
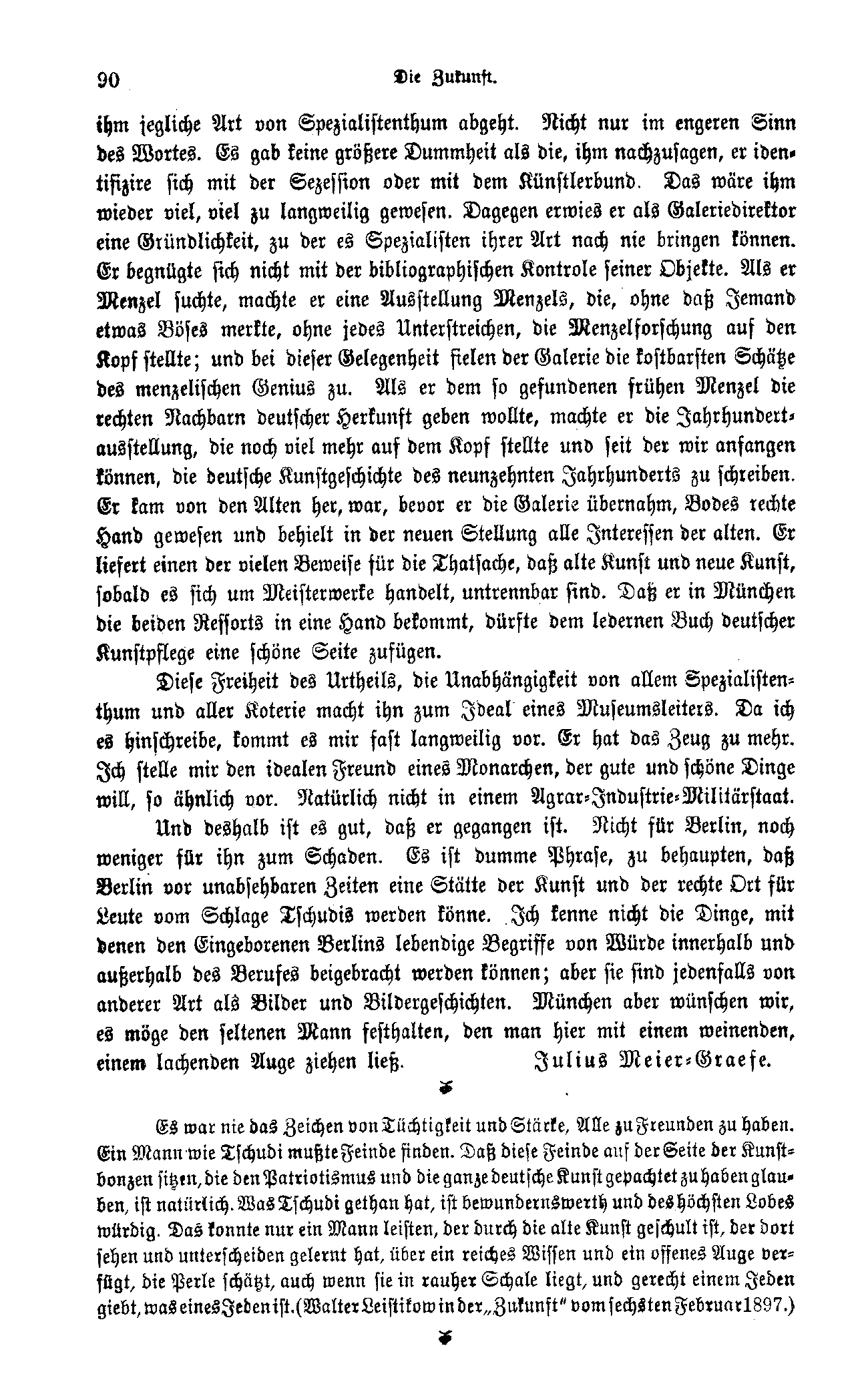

Aus der Zeitschrift "Zukunft" herausgegeben von Maximilian Hardenberg, 1909, S. 87-90.
Hugo von Tschudi.
87 - Hugo von Tschudi.
Berliner Droschkenkutscher kennen alle Filialen der besseren Banken, wissen Gerson, Herzog und Kempinski und die Kasernen aller Garderegimenter. Aber unter hundert giebt es nicht fünf, die mit Sicherheit den Weg nach der
Nationalgalerie zu finden wissen. Kastanienwäldchen, Museumsinsel, Ruhmeschalle: irgendwo daherum, denkt er sich; und setzt den Kunstfreund richtig vor der Treppe des Alten Museums ab. Ich habe mir nicht verdrießen lassen, jedesmal den Rosselenker darauf aufmerksam zu machen, wie sich geographisch die Nationalgalerie zu den anderen Museen verhalte, und habe auch im Lauf der Jahre eine wesentliche Steigerung des Prozentsatzes konstatirt.
Alles muß bei uns seine Weile haben. Wir sind vielleicht keine Stürmer. Mit unserer Zähigkeit setzen wir schließlich Dinge durch, die anderen Völkern gar keine Umstände bereiten. Mit dem Abgang Tschudis wollte es zuerst gar nicht so recht gehen. Die Zeitungen waren voll von Protesten. Man konnte beinahe von einer Bewegung zu Gunsten des bedrohten Direktors sprechen. Einen Augenblick schien der Fall hochpolitischer Art, und als der Kaiser nachgab, nahm man es für das erste Zeichen einer neuen Aera. Die Gegenparte war aufgerieben, zermalmt, vernichtet. Unverbesserlichen Pessimisten antwortete man: Der steht nun fester als der Reichskanzler. Am ersten April übernahm denn auch richtig der bewährte Leiter der Nationalgalerie wieder die Geschäfte. Ein paar Wochen danach stand fest, daß er nicht bleiben werde. Am ersten Juli ist er gegangen. Kein Hahn kräht ihm nach. Woran liegt Das? Was ist in der kurzen Zeit anders geworden? Findet man die Thatsache, daß Tschudi die Stätte ersprießlichen Schaffens verläßt, legitimer, seit man weiß, daß er in München ehrenvolles Obdach gefunden hat? Erfreuliches Zeichen für das Absterben des Partikularismus! Oder hat man genug von dem Thema? Weil eben schließlich jedes Thema, auch das allerbeste, die Würze verliert?
Mir scheint, es war nur ein Thema. Nachdem ich eine ziemliche Anzahl von Droschkengäulen auf den rechten Weg gewiesen, stellt sich heraus, daß die Autofahrer nicht den leisesten Schimmer von der Nationalgalerie haben. Bis man die Autokutscher so weit haben wird, dürfte die Kommunikation per Lustschiff praktikabel geworden fein. Dann muß man wieder von vorn anfangen. Berlin ist keine Kunststadt. Jedes münchener Kindl weiß mit den Pinakotheken Bescheid; in Wien ist sogar die Moderne Galerie jedem Fiaker bekannt, obwohl sie erst seit ein paar Jahren da ist; und selbst die finischen Bauern, die Zu Ostern in Petersburg Schlitten fahren dürfen, bringen Dich richtig vor die Akademie oder die Eremitage. Berlin ist keine Kunststadt, sondern viel mehr: ein militärisch-agrarisch-industrielles Centrum, eine politische Weltmacht; etwas ganz Anderes eben. Und deshalb darf man nicht ver-
88 - Die Zukunft.
langen, daß es einem spezifischen Kunstfall eine über das Maß gehende Bedeutung zuwende. Solche Zähigkeit vertrüge sich nicht mit dem Weltstadtcharakter. Man gebe seiner Leidenschaft ein anderes Objekt, zum Beispiel... Doch Das gehört nicht zur Sache.
Sonderbar verhielt sich die Zunft. Darüber wäre Allerlei zu sagen. Die Zunft hat in der letzten Zeit zwei harte Schläge erlitten. Der eine war die Demaskirung der Madonna mit der Wickenblüthe in Köln; ein wissenschaftlicher
Fall, der das Mißliche des organisirten Autoritätenglaubens in possirlicher Weise zeigte. Der andere, Tschudis Abgang, ist ein moralischer Fall. Er erweist noch plastischer als der andere die Schwächen der Kaste. Mir scheint, sie hängen zusammen. Ich kann mir nicht denken, daß eine auf das zarte Organ Empfindung angewiesene Forschung zu sicheren Resultaten von allgemeiner Giltigkeit gelangt, so lange sie sich vor so groben Fällen innerhalb der Zunft nicht zu produktiven Empfindungen zu bekennen vermag.
Vielleicht war auch die Eigenart des Hauptbetheiligten (ich meine Herrn von Tschudi) daran schuld, daß sein Abgang nicht dramatischer ausfiel. Das Dramatische liegt ihm nicht. Seine Freunde werfen ihm vor, die Lösung der Krisis in Japan abgewartet zu haben, statt in Berlin Material zu sammeln. Ich bin aber der Ansicht, es wäre nie zu der geringsten Bewegung gekommen, wenn Herr von Tschudi seinen langen Urlaub im Lande verbracht hätte. Die wildesten Anhänger wären abgesprungen. Nicht etwa, weil seine Sache schlechter stand, sondern ... Das ist schwer zu sagen. Man ist in solchen militäragrar-industriellen Centren an andere, sagen wir: temperamentvollere Medien gewohnt. Zum Teufel, wenn der Mann selbst sich nicht rührt! Das hörte ich oft. Man rührt sich gewaltig in Berlin. Berlin ist nicht umsonst die rührsamste unter den Weltstädten. Nun wäre nichts verkehrter, als daraus, daß sich Tschudi dieser Rührsamkeit nicht befleißigte, auf Regungen sentimentaler Art bei ihm zu schließen. Er unterließ es auch nicht aus Bescheidenheit. Das Epitheton des Veilchens, das im Verborgenen blüht, würde nicht auf ihn passen. Auch nicht aus Ungeschick. Ich weiß nicht, ob es gelehrtere Galeriedirektoren giebt. Sicher giebt es keinen geschickteren; keinen, der besser die Klaviatur der Umgangsformen beherrscht und mit größerem Scharfblick erkennt, wie der Mann, den er vor sich hat, ob Fürst oder Kollege, zu behandeln ist, um das Erreichbare zu erreichen. (Verdankte er doch diesem souverainen Takt die Ueberwindung vieler Krisen und die besten Schätze, die er der Galerie zugeführt hat. Vergessen wir nicht, daß Alles, was er von Privatleuten für die Galerie erhielt, nicht nur ohne die bekannten dekorativen Verheißungen von oben, sondern gegen den Willen aller maßgebenden Kreise, oft gegen den Willen des Stifters, erbeten werden mußte.) Auch nicht lediglich mit dem Bewußtsein der Pflicht,die dem Beamten die Rührsamkeit gegen die Oberen
89 - Hugo von Tschudi.
verbietet. Und eben so wenig, weil er nicht an dem Posten hing. Diese Stellung, mit der er mehr erreicht hatte, als die kühnsten Optimisten voraussehen konnten, war ihm theuer geworden; und ich glaube, er hat sie erst aufgegeben, als ihm mit mathematischer Sicherheit klar geworden war, daß sich ihm jede Möglichkeit fruchtbarer Weiterarbeit an dieser Stelle verschloß. Ich weiß nicht, warum er sich nicht gegen die Angriffe von oben und unten und zumal von der Seite besser wehrte. Vermutlich weiß ers auch nicht. Es giebt solche Menschen. Vielleicht, weil es ihn langweilte. Solche Dinge können Einen langweilen, auch wenn man gar nicht blasirt ist. So etwa wie den Stanislawskij, als er bei uns den „Volksfeind" spielte, die Geschichte mit der verdorbenen Quelle langweilte. Ohne eine Nuance von Demagogen. Mein Gott, seht Ihr denn nicht, daß das Wasser verdorben ist? Wie merkwürdig, daß Ihrs nicht seht! Ich habe es doch im Mikroskop untersucht. Ich meine, Mikroben! Tschudi blieb bis zum letzten Moment überzeugt, daß die Bilder von Leibl, Feuerbach, Marées, von Menzel, Manet, Cézanne, Renoir, Degas, von Liebermann und Trübner, die er in die Galerie gebracht hatte, und auch die von Géricault, Daumier, Delacroix und Corot, die er hereinbringen wollte, ausgezeichnet seien. Denn er hatte sie sich angesehen. Und am Ende glaubt er es auch heute noch. Wenn ihm Einer sagte, es sei doch eigentlich unverantwortlich, was ihm widerfahre, kam er immer wieder auf Bilder und Kunst zu reden. Es war wie eine fixe Idee. Dabei immer kühl, gelassen, reservirt. Ging nur aus sich heraus, wenn es darauf ankam, seine Meinung zu bekennen. In Kunstfragen von einer Offenheit, als ob es sich um die ernstesten Dinge handle. Es war die Offenheit eines Menschen, dessen Urtheil, selbst wenn es irrt, die gute Organisation der Anschauung sehen läßt. Uebrigens schien ihm seine Thätigkeit nichts so Besonderes. Schöne Dinge auswählen: es war eigentlich keine Hexerei. Mancher Großkaufmann that das Selbe und noch eiserne Arbeit in anderem Beruf dazu. Das sprach wiederum nicht die Bescheidenheit, eher der Stolz eines Menschen, der über seiner Stellung, über seinem Beruf zu bleiben gesonnen war. Es kam mir immer ein Bischen lächerlich vor, wenn man ihn Herr Professor oder Herr Geheimrath anredete.
Diese Reserve jenseits von Beruf und Amt war es, was mich und manchen Anderen anzog. Wir sahen weniger den Gelehrten in ihm als Das, wofür es in Deutschland kein elegantes Wort giebt: einen Menschen, meinetwegen einen Aristokraten von sehr seltener Sorte, einen reichen Menschen, zu dessen natürlichen Eigenschaften unter anderen auch die enge Fühlung mit den Schönen Künsten gehörte. Die Kunst war ihm natürlich, was sie einem ordentlichen Beamten eines uniformirten Agrar-Industriestaates nie im Ernst werden kann. Er behielt auch ihr gegenüber seine Reserve, aber hier nicht nur aus Respekt vor sich selbst, sondern auch aus Respekt vor der Sache. Tschudi unterscheidet sich dadurch von allen anderen offiziellen Kunftbeflissenen, daß
90 - Die Zukunft.
ihm jegliche Art von Spezialistenthum abgeht. Nicht nur im engeren Sinn des Wortes. Es gab keine größere Dummheit als die, ihm nachzusagen, er identifizire sich mit der Sezession oder mit dem Künstlerbund. Das wäre ihm wieder viel, viel zu langweilig gewesen. Dagegen erwies er als Galeriedirektor eine Gründlichkeit, zu der es Spezialisten ihrer Art nach nie bringen können. Er begnügte sich nicht mit der bibliographischen Kontrole seiner Objekte. Als er Menzel suchte, machte er eine Ausstellung Menzels, die, ohne daß Jemand etwas Böses merkte, ohne jedes Unterstreichen, die Menzelforschung auf den Kopf stellte; und bei dieser Gelegenheit fielen der Galerie die kostbarsten Schätze des menzelischen Genius zu. Als er dem so gefundenen frühen Menzel die rechten Nachbarn deutscher Herkunft geben wollte, machte er die Jahrhundertausstellung, die noch viel mehr auf dem Kopf stellte und seit der wir anfangen können, die deutsche Kunstgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts zu schreiben. Er kam von den Alten her, war, bevor er die Galerie übernahm, Bodes rechte Hand gewesen und behielt in der neuen Stellung alle Interessen der alten. Er liefert einen der vielen Beweise für die Thatsache, daß alte Kunst und neue Kunst, sobald es sich um Meisterwerke handelt, untrennbar sind. Daß er in München die beiden Ressorts in eine Hand bekommt, dürfte dem ledernen Buch deutscher Kunstpflege eine schöne Seite zufügen.
Diese Freiheit des Urtheils, die Unabhängigkeit von allem Spezialistenthum und aller Koterie macht ihn zum Ideal eines Museumsleiters. Da ich es hinschreibe, kommt es mir fast langweilig vor. Er hat das Zeug zu mehr. Ich stelle mir den idealen Freund eines Monarchen, der gute und schöne Dinge will, so ähnlich vor. Natürlich nicht in einem Agrar-Industrie-Militärstaat.
Und deshalb ist es gut, daß er gegangen ist. Nicht für Berlin, noch weniger für ihn zum Schaden. Es ist dumme Phrase, zu behaupten, daß Berlin vor unabsehbaren Zeiten eine Stätte der Kunst und der rechte Ort für
Leute vom Schlage Tschudis werden könne. Ich kenne nicht die Dinge, mit denen den Eingeborenen Berlins lebendige Begriffe von Würde innerhalb und außerhalb des Berufes beigebracht werden können; aber sie sind jedenfalls von anderer Art als Bilder und Bildergeschichten. München aber wünschen wir, es möge den seltenen Mann festhalten, den man hier mit einem weinenden, einem lachenden Auge ziehen ließ.
Julius Meier-Graefe.
Es war nie das Zeichen von Tüchtigkeit und Stärke, Alle zu Freunden zu haben. Ein Mann wie Tschudi mußte Feinde finden. Daß diese Feinde auf der Seite der Kunstbonzen sitzen, die den Patriotismus und die ganze deutsche Kunst gepachtet zu haben glauben, ist natürlich. Was Tschudi gethan hat, ist bewundernswerth und deshöchsten Lobes würdig. Das konnte nur ein Mann leisten, der durch die alte Kunst geschult ist, der dort sehen und unterscheiden gelernt hat, über ein reiches Wissen und ein offenes Auge verfügt, die Perle schätzt, auch wenn sie in rauher Schale liegt, und gerecht einem Jeden giebt, was eines Jeden ist.(Walter Leistikow in der »Zukunft« vom sechsten Februar 1897)
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/zeitzeichen/audio-hugo-von-tschudi-kunsthistoriker-geburtstag--100.html
Hugo von Tschudi, Kunsthistoriker (Geburtstag 07.02.1851)
WDR ZeitZeichen. 07.02.2016. 14:54 Min.. Verfügbar bis 04.02.2026. WDR 5.
In der Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel sollte die deutsche Kunst gefeiert werden. Wilhelm II wollte die nationalen Werte hochhalten: Familie, Heimatliebe, Patriotismus. Aber der Direktor, der dort 1896 die Leitung übernommen hatte, sah das alles ganz anders. Der Schweizer Hugo von Tschudi brachte von seiner ersten Dienstreise nach Paris aufsehenerregende Bilder der modernen Maler Edouard Manet, Claude Monet, Auguste Renoir und Paul Cezanne mit nach Berlin. Es entbrannte ein erbitterter Meinungsstreit um die Kunst. Autorin: Ulrike Gondorf © WDR 2016
https://www.zeit.de/1996/42/Schoen_diese_Unklugheit
https://www.zeit.de/1996/42/Schoen_diese_Unklugheit/seite-2
https://www.zeit.de/1996/42/Schoen_diese_Unklugheit/seite-3
Schön, diese Unklugheit
Ausstellung in Berlin: "Manet bis van Gogh - Hugo von Tschudi und der Kampf um die Moderne"
Von Petra Kipphoff
11. Oktober 1996 Quelle: DIE ZEIT, 42/1996
Aus der ZEIT Nr. 42/1996
In Berlin-Mitte gibt es zur Zeit zwei berühmte Baustellen. Die eine ist am Potsdamer Platz, ohne Ladenschlußzeiten, nachts arbeitet man im Scheinwerferlicht. Von seiner schieren Dimension und den Investitionen her ein Superlativ unserer Zeit, ist dieser Bauplatz mit seinem Wald von eleganten Kränen über Baugrubenabgründen, mit den Schuten auf dem Grundwassersee, den in der logistisch präzise verplanten Chaosgeographie hin und her eilenden Zementmischwagen mit ihren kreisenden Bauchbinden auch eine ästhetische Sensation.
Schade um jeden Krimi, der hier nicht gedreht wird.
Die andere Baustelle ist auf der Museumsinsel. Kein Krimi, sondern ein Trauerspiel. Denn an dem Ort, der, beginnend mit dem Bau von Schinkels Altem Museum, zwischen den Jahren 1830 und 1930 zum größten zusammenhängenden Museumskomplex der Welt wuchs, der durch den Krieg und die DDR-Nachkriegszeit dann zum größten Sanierungsfall der Kulturnation wurde, tut sich fast nichts. Nur die Alte Nationalgalerie wird instand gesetzt, aber es kann noch länger dauern. Beim Neuen Museum, dessen Wiederaufbau aus der Dreiviertelruine eigentlich gleich nach dem Fall der Mauer geplant war, und den anderen Häusern muß man sich mit der Sicherung der ruinösen Zustände begnügen.
Die Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz haben nicht annähernd das Geld, das sie zur Sanierung der Museumsinsel bräuchten, und die paar Millionen, die es gibt, werden in der Bonner Bürokratie so gründlich verwaltet, daß sie in Berlin nicht rechtzeitig ankommen, um ausgegeben werden zu können. Erst wenn Bonn nach Berlin zieht, würde sich wohl etwas ändern, meint der resigniert realistische Generaldirektor Wolf-Dieter Dube. Eine Feststellung, die ein kulturpolitisches Armutszeugnis beschreibt.
Aber frei nach dem Motto, das Dubes Vorkriegsvorgänger Wilhelm Waetzoldt einem Führer der Staatlichen Museen zu Berlin 1930 voranstellte, arbeitet man auch jetzt: "Der Staat muß durch geistige Kräfte ersetzen, was er an physischen verloren hat" (Friedrich Wilhelm III., 1807). Also nutzen die staatlich beamteten Kunsthistoriker mit ihrem Kopf die Gebäude, die draußen andere Staatsdiener wegbröckeln lassen, und bewirken durch diese positive Evidenz vielleicht mehr als durch die Rhetorik des Notstands.
Im vergangenen Winter erinnerte man mit Ausstellungen und einem Colloquium an Wilhelm von Bode, der, über fünfzig Jahre auf der Museumsinsel tätig, als erster General und genialischer Autokrat von bismarckschem Format während des Kaiserreichs das Fundament der später staatlichen preußischen Museen legte, kunsthistorisch und museumspolitisch. Zu Bodes Mitarbeitern gehörte seit 1884 Hugo von Tschudi, ein Schweizer Aristokrat, der, das war damals fast die Regel, zunächst Jura studiert hatte, seine Kunstkarriere als Assistent an der Berliner Gemäldegalerie begann und in dem Maße, in dem er von Bode lernte, mit diesem in Konkurrenz und schließlich in Konflikt geriet. Tschudis Ernennung zum Direktor der Nationalgalerie im Jahr 1896 löste das Problem und verschärfte es, denn nun umwarb auch er die Sammler, die Bode sich als Mäzene entdeckt hatte.
An Hugo von Tschudi, der vor hundert Jahren zum Direktor des Hauses ernannt wurde, erinnert die Nationalgalerie mit einer Ausstellung, die, zusammen mit dem hervorragenden Katalog, das Panorama einer Kulturmetropole entwirft, von deren (oft neureichem) Glanz noch die vielzitierten zwanziger Jahre profitierten, und sei es im Widerspruch. Dabei gehört zur Aura des Hugo von Tschudi nicht nur sein im Ausstellungsuntertitel genannter "Kampf um die Moderne", sondern auch sein siegreiches Scheitern. 1908 verließ er Berlin, nach endlosen Kontroversen mit dem Kaiser, dessen Zustimmung für die Erwerbungen der Nationalgalerie nötig war. In München, wo Tschudi ein Jahr später zum Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ernannt wurde, ging es ihm mit dem konservativen Prinzregenten nicht viel besser. Sein früher Tod, 1911, beendete die Kunstkriege.
Es war ein Künstler und Sammler, der noble und neugierige Max Liebermann, der Tschudi im Jahr seiner Amtsübernahme in Berlin mit nach Paris nahm und ihm, der die moderne Kunst bisher kaum wahrgenommen hatte, durch einen Besuch des Kunsthändlers Durand-Ruel den Blick auf seine Zukunft öffnete. Manets Bild "Im Wintergarten" war ausgestellt, man sicherte es sich für die Nationalgalerie, es war der erste Manet, der je von einem Museum gekauft wurde.
Eine Seine-Landschaft von Monet, das dunkel verträumte Pastell "Unterhaltung" von Degas, Landschaften von Courbet und Constable, Skulpturen von Rodin und Meunier kamen noch im Laufe des Jahres hinzu, und ein Jahr später erwarb Tschudi, dem mit dieser neuen Leidenschaft auch ein neues Selbstverständnis zugewachsen war, Cézannes "Mühle von Pontoise", es war der erste Cézanne, der je in ein Museum gelangte. Daß die Nationalgalerie nicht nur das erste staatliche Museum in Deutschland war, das eine Sammlung französischer Kunst der Moderne aufbaute, sondern mit dieser Aktivität auch fortschrittlicher war als die Museumskollegen in Frankreich, ist eine Tatsache, die eine andere Ausstellung in Berlin, "Marianne und Germania", in ihrer bekannten These von der kulturellen Dominanz Frankreichs widerspruchsvoll ergänzt.
Manets "Im Wintergarten", diese stille Unentschlossenheitsszene zwischen Mann und Frau, in der alle Poesie und alles Unglück von Fontane bis zu Ibsen liegt, und eines der Wunderbilder der Nationalgalerie überhaupt, hängt normalerweise so, daß man es beim Blick durch die Säle im Obergeschoß als erstes wahrnimmt. Für die Dauer der Ausstellung zu Tschudis Ehren ist es an die Längswand gerückt, hat es dem anderen Zauberbild von Manet Platz gemacht, dem "Frühstück im Atelier", das aus dem Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen stammt. Darum herum all die anderen Tages- und Landschaftslichtbilder, mit denen die Künstler die Inszenierungen im Atelier hinter sich ließen, die nach Tschudis Vorstellung aber, der alles andere war als ein Revolutionär, als "wahre Kunst" kaum von der Menge begriffen werden konnten, sondern nur von den "Wenigen, die fähig sind, das Beste zu empfinden".
All die anderen Bilder oder auch fast alle. Denn ausgerechnet München, der zweite Ort dieser Ausstellung, hat acht kapitale Arbeiten, zum Beispiel van Goghs "Sonnenblumen", nicht ausgeliehen.
Was deshalb besonders pikant ist, weil sich die Bilder der sogenannten Tschudi-Spende der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen allein der Generosität jener Berliner Mäzene verdanken, die es nach Tschudis Tod der Witwe freistellten, die von ihnen bezahlten Bilder, die natürlich für Berlin angeschafft waren, aber den kaiserlichen Segen noch nicht erhalten hatten, nach München zu geben. Daß es sich mit dem kaiserlichen Segen nicht ganz so eindimensional verhält, wie die Karikatur es gern hatte, ist eine der vielen interessanten Ergebnisse der Recherchen für den Katalog. Über Wilhelm II. hatte Harry Graf Keßler, der in Weimar dieselben Schwierigkeiten hatte und ein ähnliches Schicksal erlitt wie Tschudi in Berlin, in seinem Tagebuch geschrieben: "Er war ein schüchtern-forscher Mensch, der laut schrie und aufgeregt redete, um seine Verlegenheit zu verbergen." Wie das dann bei einem Ausstellungsbesuch aussah, hat der Kunsthistoriker Meier-Gräfe brillant beschrieben: "In der Mitte des Saales stand Tschudi im dunklen Cutaway, und um ihn herum bewegte sich in Weiß-Gold der andere und hatte einen Vogel auf dem goldenen Helm, der beständig nickte . . ."
In seinem Katalogbeitrag, in dem er diesen Auftritt zitiert, beschreibt Peter-Klaus Schuster die komplizierten Frontlinien und resümiert, was auch in dieser schwarzweißgoldenen Farce sichtbar wird: "Das eigentlich Fatale an Wilhelm II. war sein wirkliches Interesse für die Kunst." Als Haus- und Schirmherr besonders der Nationalgalerie aber hatte er nicht nur das Sagen, sondern auch die Verantwortung für das, was gezeigt wurde. Und da ging die Fatalität in der Aktivität der kaiserlichen Ordres weiter.
Hugo von Tschudi war keine Ein-Mann-Veranstaltung. In Hamburg stand ihm Lichtwark, dessen Briefen wir unendlich viel Informationen und gescheiten Klatsch verdanken, als Freund und Kollege zur Seite, in Bremen arbeitete Gustav Pauli, in Frankfurt Georg Swarzenski, in Weimar Harry Graf Keßler, in Hagen Karl Ernst Osthaus, in Mannheim Franz Wichert auf demselben Terrain. In einem Eingangskabinett der Berliner Ausstellung, in dem "der andere" an eine schmale Wand gequetscht ist, stehen und hängen diese Herren in eindrücklichen Portraits und Büsten, ihre eigene Arbeit für die Kunst der Moderne ist in teils hervorragenden Bildern in dem zweiten großen Ausstellungsraum präsent. Im Kabinettumgang gibt es Trouvaillen eigener Art, wie zum Beispiel Drouets Photos von Rodins Skulpturen und Beispiele jener erotischen Zeichnungen von Rodin, die Keßlers Fall in Weimar besiegelten.
Gut hundertzwanzig Gemälde, Skulpturen, Aquarelle und Zeichnungen der Impressionisten haben Schuster und Angelika Wesenberg zusammengebracht für diese Ausstellung, die in Berlin auch noch um lokale bildnerische Vor- und Nebenspiele ergänzt ist. In der Mitte des großen Tschudi-Raumes steht Rodins "Ehernes Zeitalter", und genau so, nur ein Stockwerk höher, stand der junge Mann aus dem Geiste Rilkes schon 1908, wie man auf einem Photo sehen kann, im Hintergrund Manets "Im Wintergarten".
"Wie schön war diese Unklugheit Tschudis", schrieb Pauli nach dem Tod des Kollegen. Das ist richtig. Aber was man durch diese Ausstellung und den Katalog auch lernt, ist die Möglichkeit einer Parallelwidmung. Tschudi, natürlich. Aber ohne die grandiosen Berliner Sammlermäzene, die oft das, was sie bereits in ihren Salons hängen hatten, auch gern einem größeren Publikum eröffnen wollten, hätte Tschudi keine Chance gehabt zur Unklugheit. Ohne die Arnholt, Mendelssohn, Bernheim, Gerstenberg und Oppenheim zum Beispiel, Multimillionäre alle und, anders als Goldhagen es will, hoch geachtet und in Positionen der Macht, wäre der Impressionismus vielleicht nie in Berlin angekommen. Sie alle waren, das war auch eine Statusfrage, Kunstsammler. Und eine der berühmtesten Gemäldesammlungen der Moderne befand sich im Haus von Julius Stern, dem Direktor der Nationalbank: Cézanne, Monet, Manet, van Gogh, Gauguin, Picasso.
"Wer das Weinen verlernt hat", schreibt Stefan Pucks in seinem Aufsatz über diese Sammler, einen Satz von Gerhart Hauptmann angesichts des zerstörten Dresden aufgreifend, "der erlernt es erneut angesichts des Untergangs der hier beschriebenen großbürgerlichen Kultur Berlins." (Nationalgalerie bis zum 6. Januar 1997, 24. Januar bis 11. Mai 1997 Neue Pinakothek München Katalog: Prestel Verlag München, 42,- DM an der Museumskasse)
Hugo von Tschudi (1851-1911)
von Gerd Presler
(https://presler.de/data/Hugo_v_Tschudi.pdf)
Die Szene war aufschlussreich, prallten doch Welten aufeinander: Hugo von Tschudi, seit dem 3. Februar 1896 Direktor der Nationalgalerie Berlin, hatte alle Vorbereitungen getroffen, um den eigentlichen Hausherrn zu empfangen. Wilhelm II., seit 1888 Deutscher Kaiser und König von Preußen, war gerade vom nahen Stadtschloss aufgebrochen. Noch sprach Tschudi mit zwei Freunden über eine kürzlich erworbene Kleinplastik. Dann zogen sich Julius Meier-Graefe, der Kunsthistoriker, und Henry van de Velde, der Architekt – nicht zufällig anwesend – auf die Empore im zweiten Geschoss zurück. Tschudi eilte ins Vestibül. Seine kaiserliche Majestät entstieg der Kalesche. Der unsichtbare Zeuge Julius Meier-Graefe beschrieb später, was dann geschah: „In der Mitte des Saales stand Tschudi im dunklen Cutaway, und um ihn herum bewegte sich in Weiß-Gold der andere und hatte einen Vogel auf dem goldenen Helm, der beständig nickte. Der Schwarze rührte sich nicht .., während der Goldene .. [herumschwirrte]. Man hätte ihn gern einmal festgehalten, um den Vogel richtig zu betrachten.“ Die Ironie des Freundes zielt auf jene Gefechte, welche die Kontrahenten nun schon seit zehn Jahren austrugen. „Von den beiden im Saal war der Mann im Cut .. der bessere Schlag. Man erkannte sofort den Aristokraten. Die Szene .. ging ohne merkbare Abnahme des Fortissimo weiter. Manchmal sah es aus, als pralle der Goldene tosend an den Schwarzen .. Plötzlich segelte der Goldene mit dem Vogel zur Türe hinaus.“ Das Gebäude, in dem die Auseinandersetzung stattfand, trug am Giebel die Inschrift: „Der Deutschen Kunst“. Als nationale Galerie gebaut, sollte es dem Kaiserreich ein sichtbares kulturelles Zentrum geben. Hugo von Tschudi aber war nicht bereit, „patriotische Rücksichten zu nehmen.“ Er gehörte von Anfang an zu den „Beamten Wilhelms II., die ihm nicht nachgaben – selten wie Trüffeln in unseren Wäldern – .. Direktor eines Museums, das bis 1895 .. die pathetischen Wallungen deutscher Künstler .. beherbergte.“ (Julius Meier-Graefe)
Tschudis Souveränität, die Wilhelm II. zur Raserei und schließlich zum lautstarken Abgang trieb, stieg auf aus einer tausendjährigen Familiensaga, die ihre Anfänge bis zum 31. Mai 906 zurückverfolgen konnte. In der Schweiz hat das Geschlecht einige Kapitel der eidgenössischen Geschichte mitbestimmt, in Aegidius von Tschudi (1505-1572) einen geachteten Geschichtsschreiber gestellt. Hugo von Tschudi (1851-1911) erhielt bei der Taufe dessen Namen. Sein Vater, Johann von Tschudi, verkörperte alles, was sich in einem solchen Geschlecht vererbt: Naturforscher, der schon im Alter von zwanzig Jahren nach Chile reiste, in einen Krieg geriet, sieben Monate im Urwald überlebte, in Lima Medizin studierte, das Examen ablegte, um dann Botschafter seines Landes in Brasilien zu werden. Kaum weniger imposant das mütterliche Erbe. Ottilie Schnorr von Carolsfeld entstammte einer hochgestellten Familie, Tochter des Leiters der Belvedere Galerie in Wien, Nichte des berühmten Malers Julius Schnorr von Carolsfeld. An so viel Kampfkraft und Kultur müssen auch Kaiserliche Hoh(l)heiten mit Adlerhelm scheitern.
Nachdem Hugo von Tschudi ein Jurastudium mit Promotion beendet und zugleich die Kunstgeschichte zum Zentrum seines Lebens gemacht hatte, bat ihn Wilhelm Bode, Direktor an den Königlichen Museen zu Berlin, 1884 um Mitarbeit. „Sein Wissen, seine Gründlichkeit in der Forschung, sein Geschmack und sein ruhiges Wesen machten ihn mir gleich sympathisch .. so dass ich ihm vorschlug, als Assistent .. einzutreten.“ Zwölf Jahre, bis 1896, schrieb, las, forschte er in dieser Position, wurde zum Professor ernannt, erhielt eine „gesonderte Vergütung“, besuchte die großen Museen zwischen Madrid und Petersburg, London, Paris, Prag und Rom, reiste mit dem Nachtzug, um die Stunden eines ganzen Tag vor den Gemälden zu verbringen. Und immer mehr wuchs in ihm jenseits der Aufgaben seines Amtes die Liebe zu den neuesten Entwicklungen der Malerei, die ihm vor allem in Frankreich begegneten. Als er am 3. Februar 1896 die Leitung der Gemäldegalerie übernahm, brach diese Liebe durch. „Zur Überraschung“, wie der Maler Max Liebermann später festhielt, „ .. selbst seiner Freunde, [denen diese Liebe] bis dahin verborgen geblieben war.“ Wird es dem inzwischen Fünfundvierzigjährigen gelingen, französischer Malerei den Einzug in die deutsche Nationalgalerie zu verschaffen? Das „kulturpolitische Minenfeld“ (Peter-Klaus Schuster, Katalog Berlin 1996/7, S.26) war betreten. Tschudi tat nichts, um die offene Provokation zu vermeiden. Kaum ernannt, reiste er nach Frankreich, kaufte in der Galerie Durand-Ruel das großformatige Gemälde „Im Wintergarten“ von Eduard Manet und stellte es im Allerheiligsten der Nationalgalerie, dem Zweiten Cornelius-Saal, aus. „Eine köstliche Weihnachtsbescherung für Berlin und damit gewissermaßen für das Reich“, kommentierte sein hamburger Museumskollege Alfred Lichtwark.
Den Maßstab seines Handelns fand Tschudi nicht bei den alten, gesicherten, sondern bei den neuen, gewagten Positionen. Er wandte sich gegen das Sammeln von Werken und Malern, die von der Kunstgeschichte längst akzeptiert waren, „nobilitiert“, wie er es nannte. Zu einfach ! Andere mochten das tun. Seine Aufgabe sah er darin, neuen Gestaltungen schöpferischer Intelligenz Wand und Wohnung zu schaffen gerade auch in den heiligen Hallen des von ihm geleiteten Hauses. Sein Credo: „Galerien von ältestem Adel gewinnen eine aufregende Aktualisierung“ durch die Konfrontation mit neuer Kunst. Der Maßstab: „Das Beste für die Besten.“ Das musste dem Kaiser eigentlich gefallen, entsprach es doch seiner Selbsteinschätzung und, wie er glaubte, der Stellung des deutschen Volkes. Was Tschudi, der Schweizer, als „das Beste“ ansah, wurde schon bald sichtbar. In kürzester Zeit erwarb er mit Stiftungsgeldern dreißig „ausländische Werke“, darunter „Unterhaltung“ von Edgar Degas. Im Juli 1897 gelangte mit der „Mühle an der Couleuvre bei Pontoise“ erstmals ein Werk Cezannes in ein Museum.
Die Reaktion kam nicht unerwartet. Nach kurzer Schonfrist formierten sich die Gegenkräfte. Wilhelm Bode, der Tschudi 1884 ins Haus geholt hatte, sah in seinem ehemaligen Assistenten nun den Konkurrenten. Vor allem aber bliesen die Berliner Künstler zum Widerstand, allen voran der einflussreiche Kunstakademiedirektor Anton von Werner. Er hatte schon bei der Schließung einer Ausstellung mit Werken von Edvard Munch am 12. November 1892 (ART 2/2001, S.12-25) als Besitzstandwahrer und Gremienfuchs eine unrühmliche Rolle gespielt. Sein Gemälde „Kaiserproklamation zu Versailles“, 1871, eine photographisch genau gemalte Apotheose des Herrscherhauses, sicherte ihm die Gunst Wilhelms II. Seit zwei Jahrzehnten hatte der „geringere Maler .. [ohne] jegliche .. Phantasie“ (Rosenberg, Handbuch der Kunstgeschichte, Bielefeld o.J. S.623) dafür gesorgt, dass bei Ankäufen der Nationalgalerie seine und die Werke seiner Akademiekollegen berücksichtigt wurden. Nun sah er seinen Einfluss schwinden – und steckte sich hinter den „marinemalernden Goldenen mit Vogel.“ Wilhelm II. besuchte am 11. April 1899 die Nationalgalerie, begleitet von seinem „künstlerischen Berater“ – Anton von Werner. Die Folgen: Am 29. August ordnete der Kaiser an, „Bildwerke der modernen Kunstrichtung zum Teil ausländischen Ursprungs“ seien in zwei Räumen des 3. Obergeschosses zusammenzufassen, um Platz zu machen für die patriotischen Werke, die .. durch ihren künstlerischen Wert die nationale Kunst in hervorragender Weise repräsentieren.“ Nicht genug. Tschudi musste für alle Erwerbungen „allerhöchste Zustimmung“ einholen. Von solchen Kabalen unberührt, gelang es ihm dennoch Mal um Mal, die kaiserlichen Genehmigungen trickreich zu umgehen. Höhepunkt: Zwei Stilleben von Paul Cezanne, die 1906 als Stiftung des Industriellen Eduard Arnhold und des Bankiers Robert von Mendelssohn zugelassen und angenommen wurden.
In diesen kampferfüllten Jahren trug Hugo von Tschudi eine weitere Last. Den mit allen Talenten einer tausend Jahre alten Familie ausgestatteten Mann von klassischer Schönheit, die ihm den Namen „Adonis“ eintrug, traf im Alter von nur 25 Jahren eine unheilbare Krankheit: Lupus. Unbekannt bis heute, wendet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper, führt zu chronischen Entzündungen des gesamten Organismus. Er musste oft eine Maske tragen, um sein wie verbrannt wirkendes Gesicht zu verdecken. Der gleichwohl begehrte Junggeselle heiratete am 1. Oktober 1900, fast 50jährig, die Spanierin Angela Fausta Caridad Gonzales Olivares. „ .. es war ein Donnerschlag, .. [als] die Kunde durch Berlin lief, Tschudi sei .. aus Spanien zurückgekehrt – Verheiratet ! Eine – der Neid musste es ihr lassen – sehr gut aussehende, rassige Spanierin trat vor das Parkett der Berliner Gesellschaft.“Im Jahr darauf gebar die fast zwanzig Jahre jüngere Katholikin von Adel und Vermögen den Sohn Hans Gilg [Aegidius]. Ein kleines Glück für den, der nirgends wirklich dazugehörte, gefürchtet wegen seines Sarkasmus, unerreichbar für alles Mittelmäßige, unfähig, die Rolle des „Untertanen“ anzunehmen. Lichtwark notierte: „Man wird nicht wagen, ihn anzurühren. Jetzt gibt es nur noch ein Mittel, ihn zu beseitigen, das ist die Beförderung.“ Tatsächlich ernannte ihn Wilhelm II. 1907 zum „Geheimen Regierungsrat“. Kurz darauf wurde er beurlaubt. In seiner Abwesenheit knüpfte man Kontakte zur bayerischen Regierung, lobte Tschudi weg. Am 5. Juli 1909 übernahm er mit einem Jahresgehalt von 10 800.- Mark die Leitung der Staatlichen Galerien zu München. Prinzregent Luitpold und Kultusminister Anton von Wehner hatten ihm größere Entscheidungsfreiheit zugesichert. Vom Rollstuhl aus ordnete Tschudi die Bestände neu. Als er „Das Drama“ von Honore Daumier erwerben wollte, zog der Kultusminister – nur durch einen Buchstaben von Tschudis berliner Widersacher unterschieden – alle Zusagen zurück. Die Polit-Inszenierung wiederholte sich. Museen hatten der nationalen Selbstdarstellung zu dienen. In diesen Trostlosigkeiten erlebte Hugo von Tschudi dann etwas, das in die Zukunft wies. Wassily Kandinsky und Franz Marc baten ihn, bei der Vorbereitung des Almanachs „Der Blaue Reiter“ mitzuarbeiten. Am 24. Oktober 1911 sandten sie ihm das Manuskript. Tschudi konnte nicht mehr Stellung nehmen. Von Operationen geschwächt, starb er am 23. November. Aber: Der Almanach, Dokument des Aufbruches, war ihm gewidmet.
Auf der ganzen Linie unterlegen? Gescheitert? Nach seinem Tode gelangten zahlreiche Gemälde, von Tschudi mit privaten Spendengeldern für die Nationalgalerie in Berlin erworben und abgelehnt, als „Tschudi-Spende“ in die Pinakothek. Darunter „Selbstbildnis“, „Blick auf Arles“ und ein Sonnenblumenbild von Vincent van Gogh, „Der Bahndurchstich“ und ein „Selbstbildnis“ von Paul Cezanne. Ebenso Gauguins „Bretonische Bäuerinnen“ und „Die Geburt“, Daumiers, „Don Quichotte“, Manets „Frühstück im Atelier“, Monets „Seinebrücke von Argenteuil“, zentrale Werke von Renoir, Toulouse-Lautrec, Bonnard und ein „Stilleben mit Geranien“ von Henri Matisse.
Heute gehören seine Entscheidungen zu den glücklichsten der Museumsgeschichte. Hunderttausende besuchen jährlich die Nationalgalerie und die Neue Pinakothek um jener Werke willen, die Hugo von Tschudi gegen größte Widerstände ins Haus holte. Den Kampf gegen Ignoranz und Intrige hat er gewonnen. In Berlin und in München. Den Kampf gegen eine Krankheit, die schließlich den ganzen Körper ergriff, hat er sechzigjährig verloren. Max Liebermann schrieb: „Was hätte der seltene Mann noch schaffen können ! Was hätte er uns allen noch sein können ! .. Aber sein Wirken wird unvergänglich bleiben, denn er war Förderer und Mehrer unserer Kultur.“
Gerd Presler
https://presler.de/person.html
Zur Person
Prof. Dr. Dr. Gerd Presler, ("Mr. Sketchbook")
Kunsthistoriker, Buchautor, Religionswissenschaftler und Journalist erarbeitete Werkverzeichnisse der Skizzenbücher von Ernst Ludwig Kirchner, Edvard Munch, Asger Jorn, Max Beckmann, Willi Baumeister, Walter Stöhrer, Ludwig Meidner und Karl Hofer.
geboren 1937 in Hannover
1958-1966 Studium: Germanistik, Philosophie, Ev. Theologie, Pädagogik, Kunstgeschichte an den Universitäten Münster/W., FU Berlin, Kopenhagen
1970 Dr. theol. Universität Münster/W.
1996 Dr. phil. Universität Heidelberg
1972-2003 Professur für Evangelische Theologie