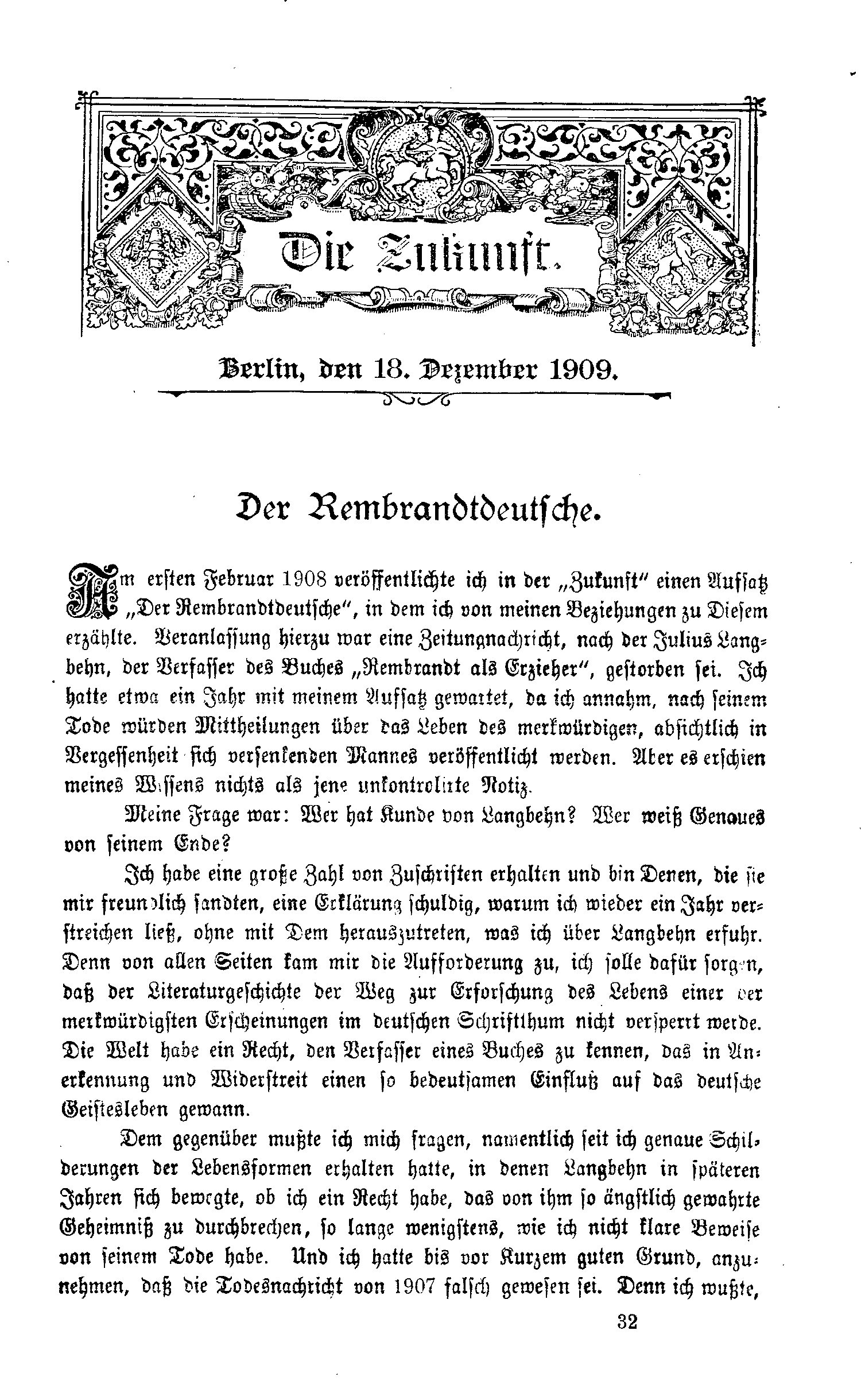
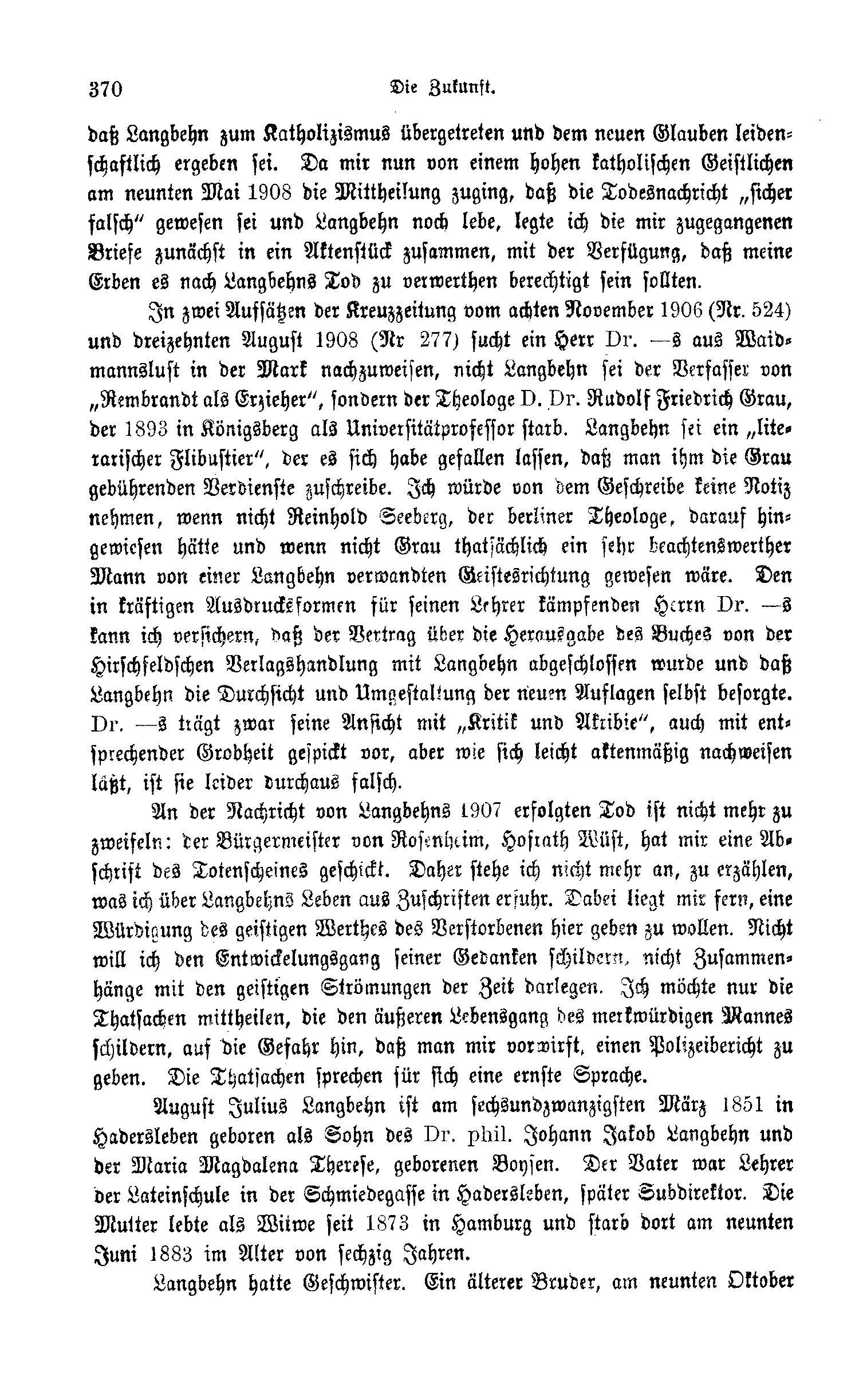
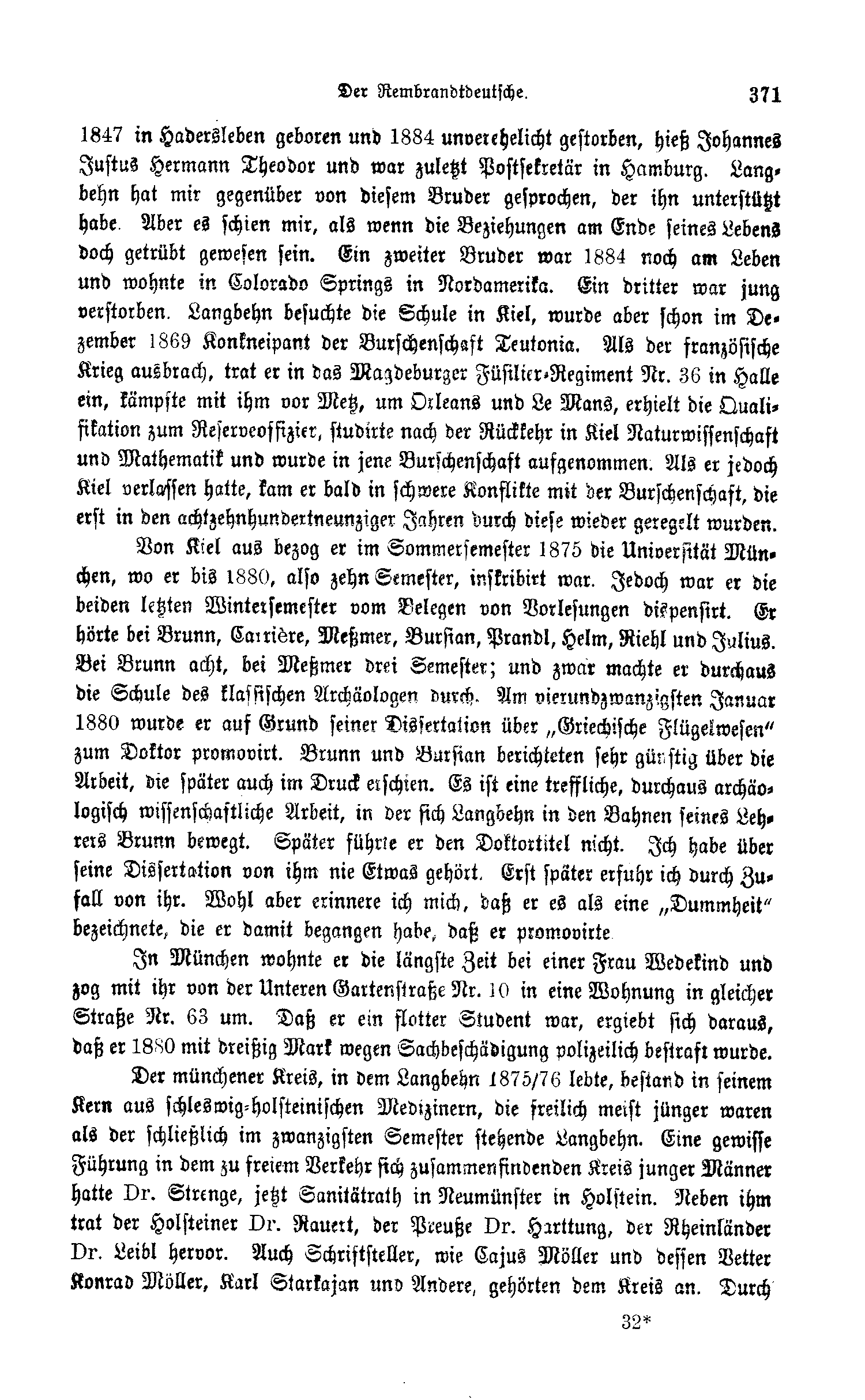
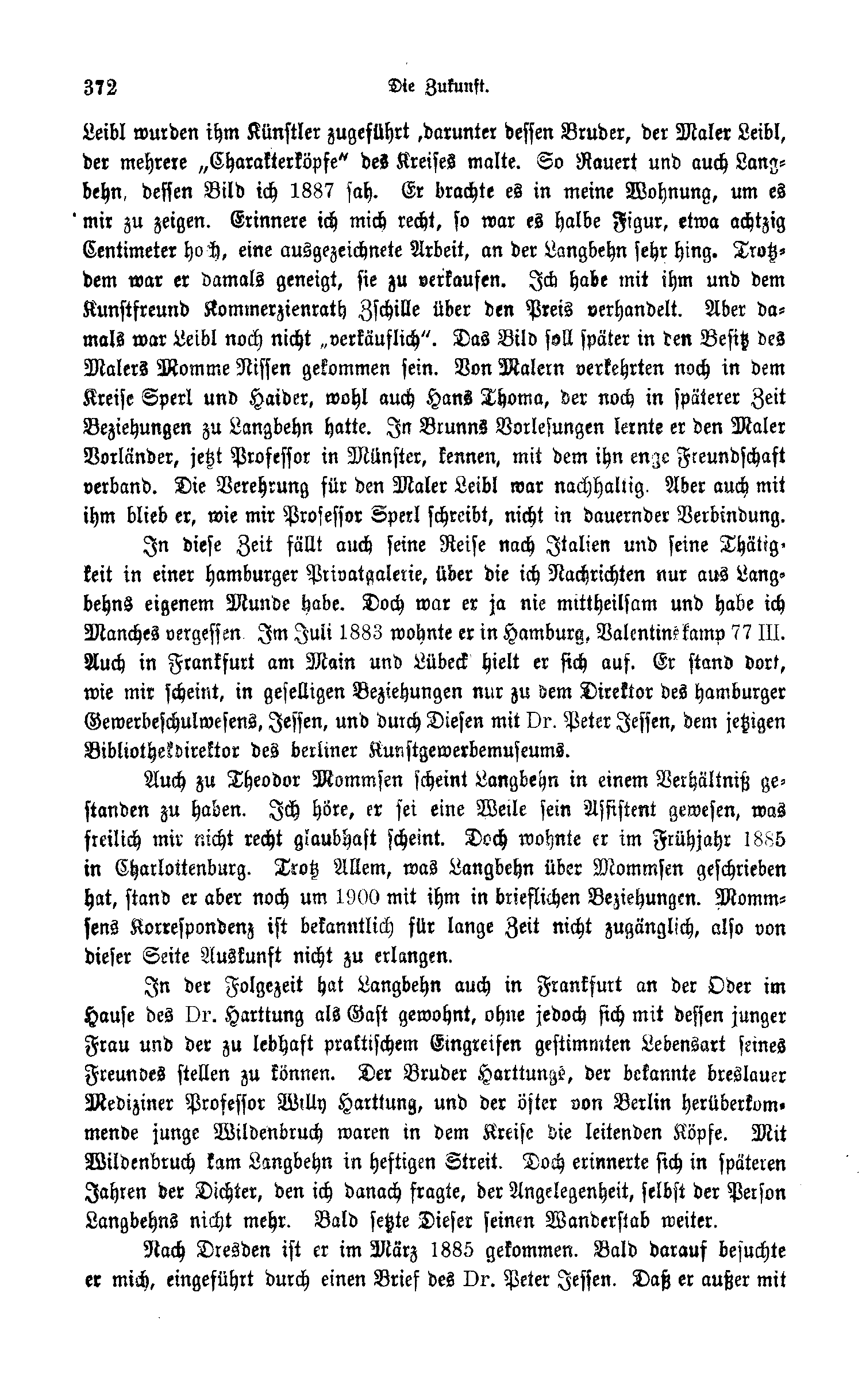
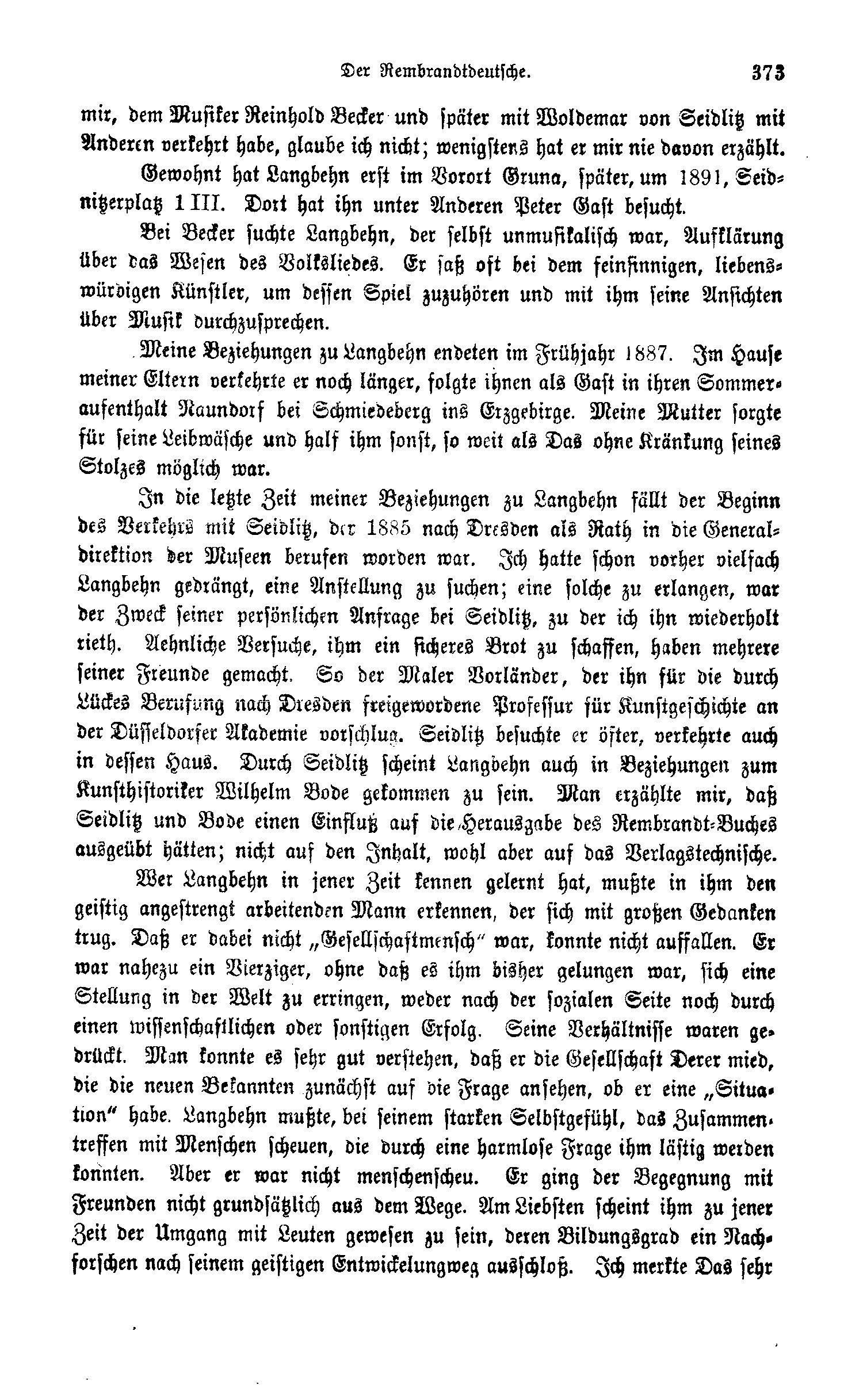
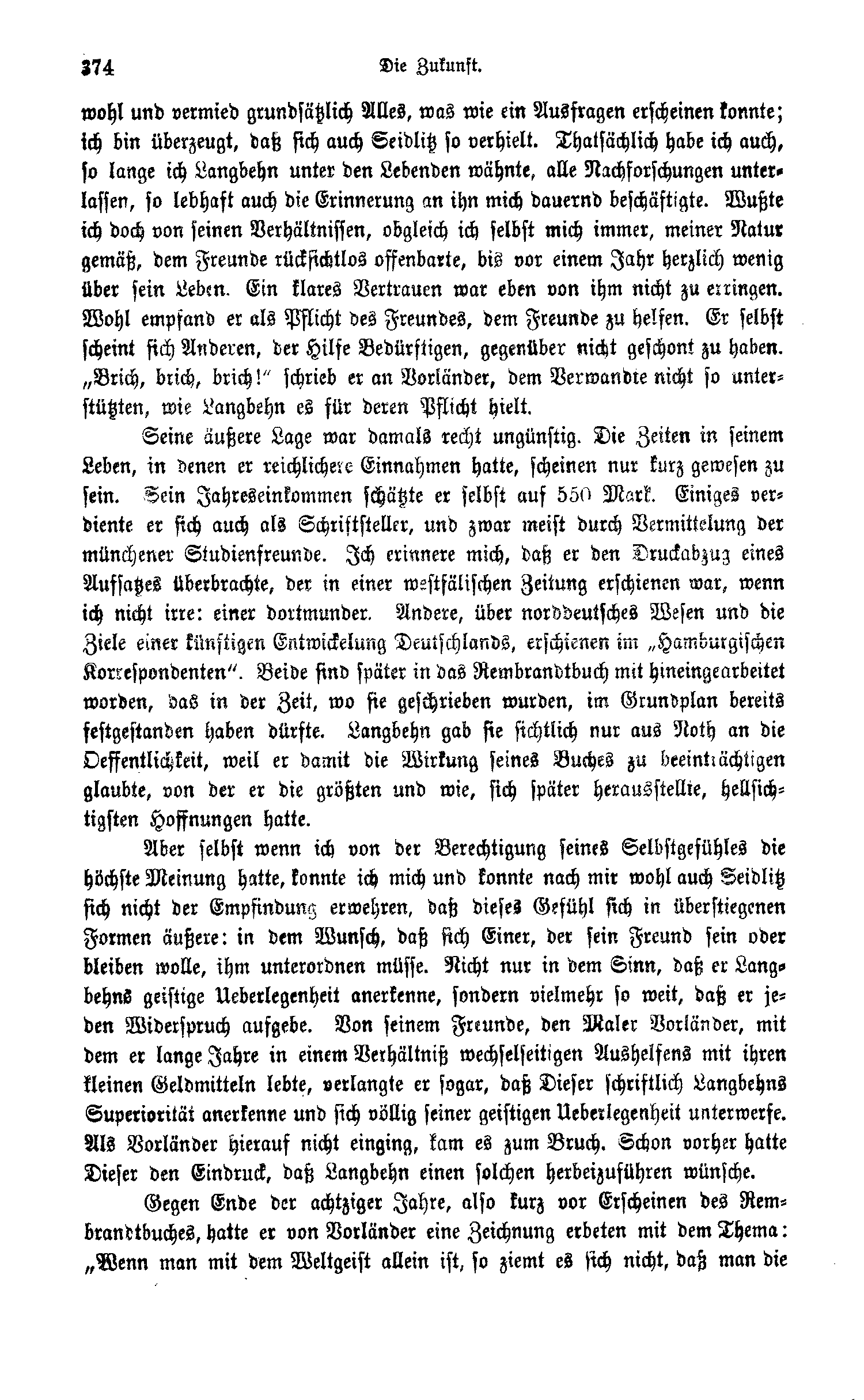
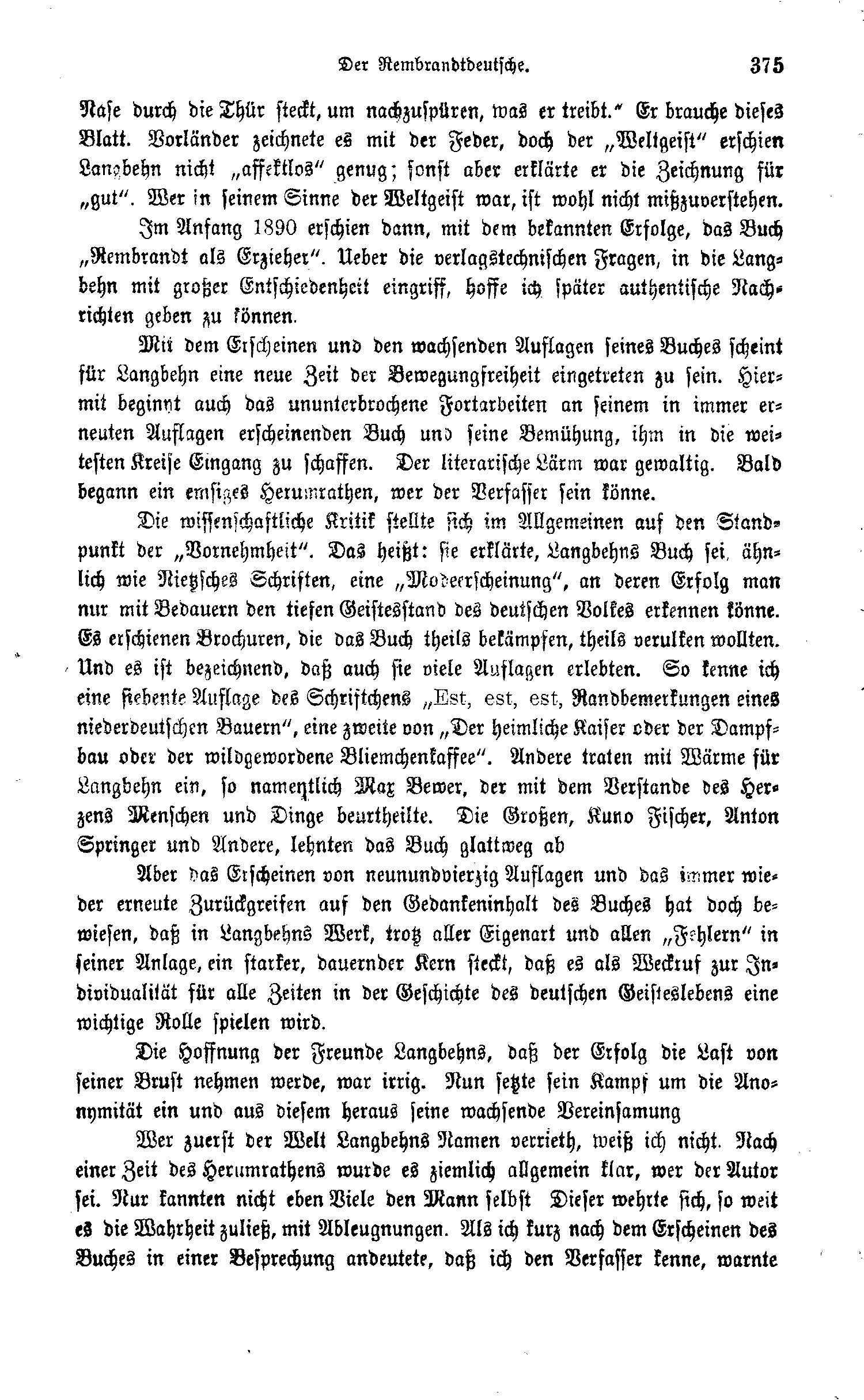
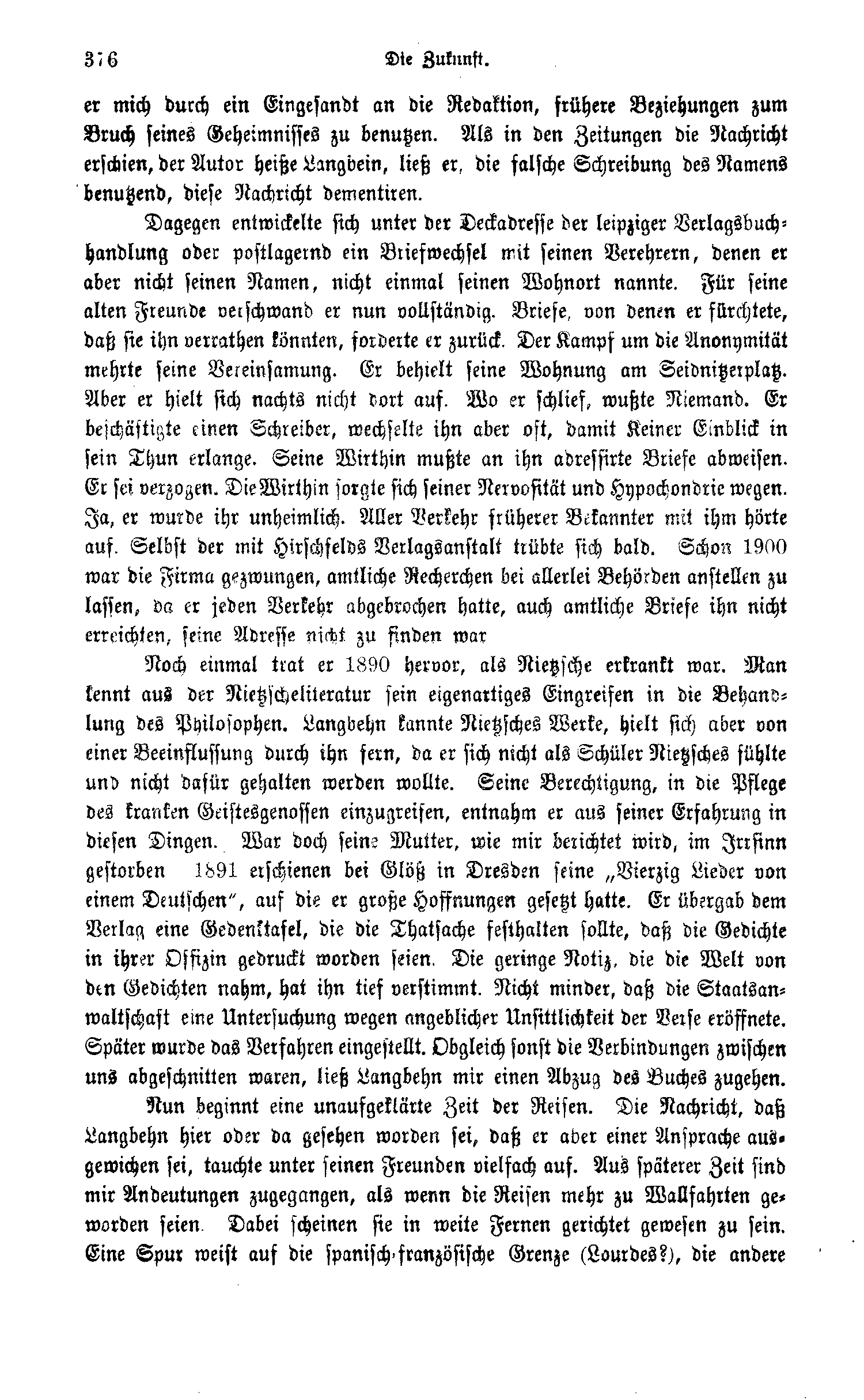
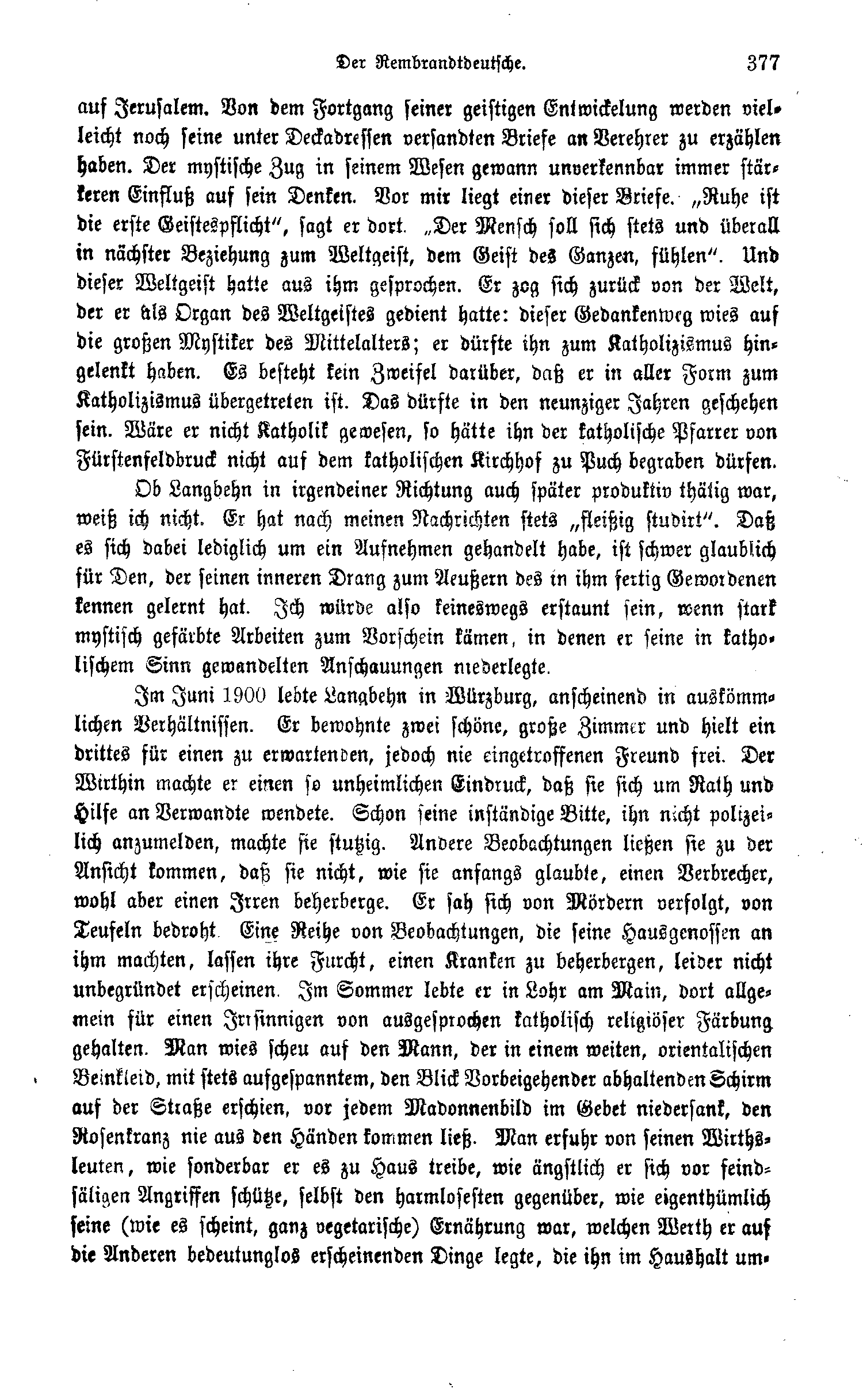
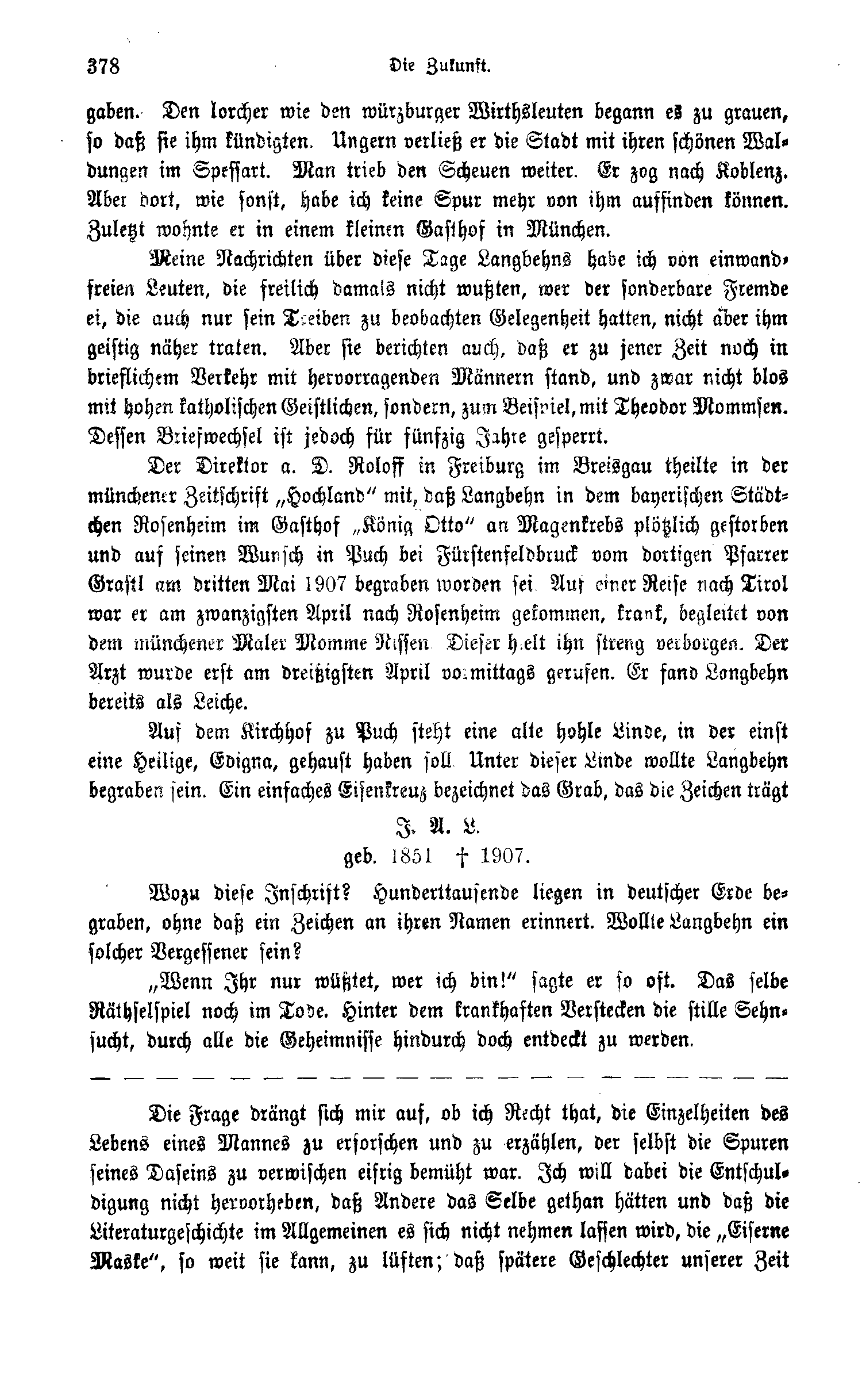
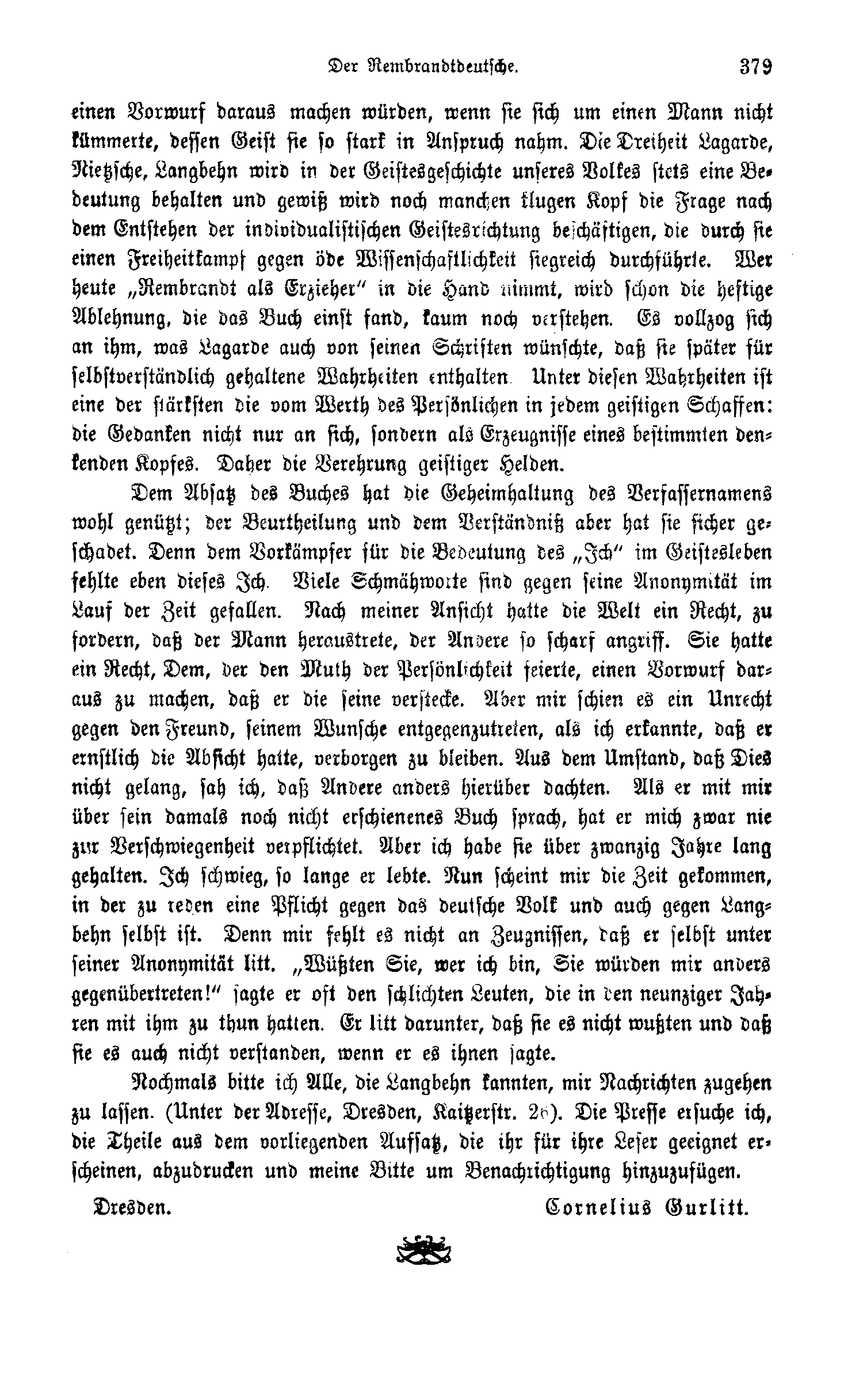
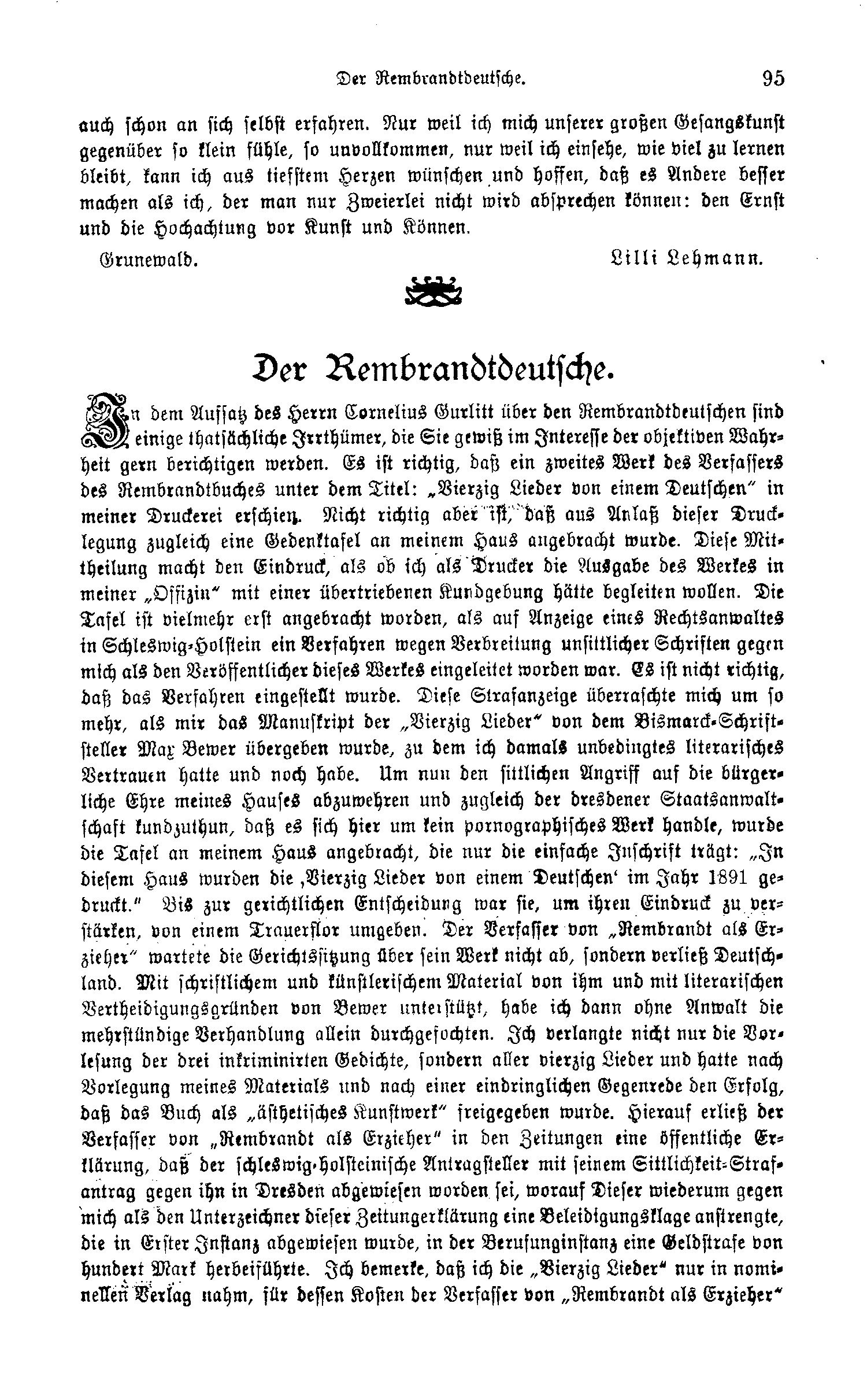
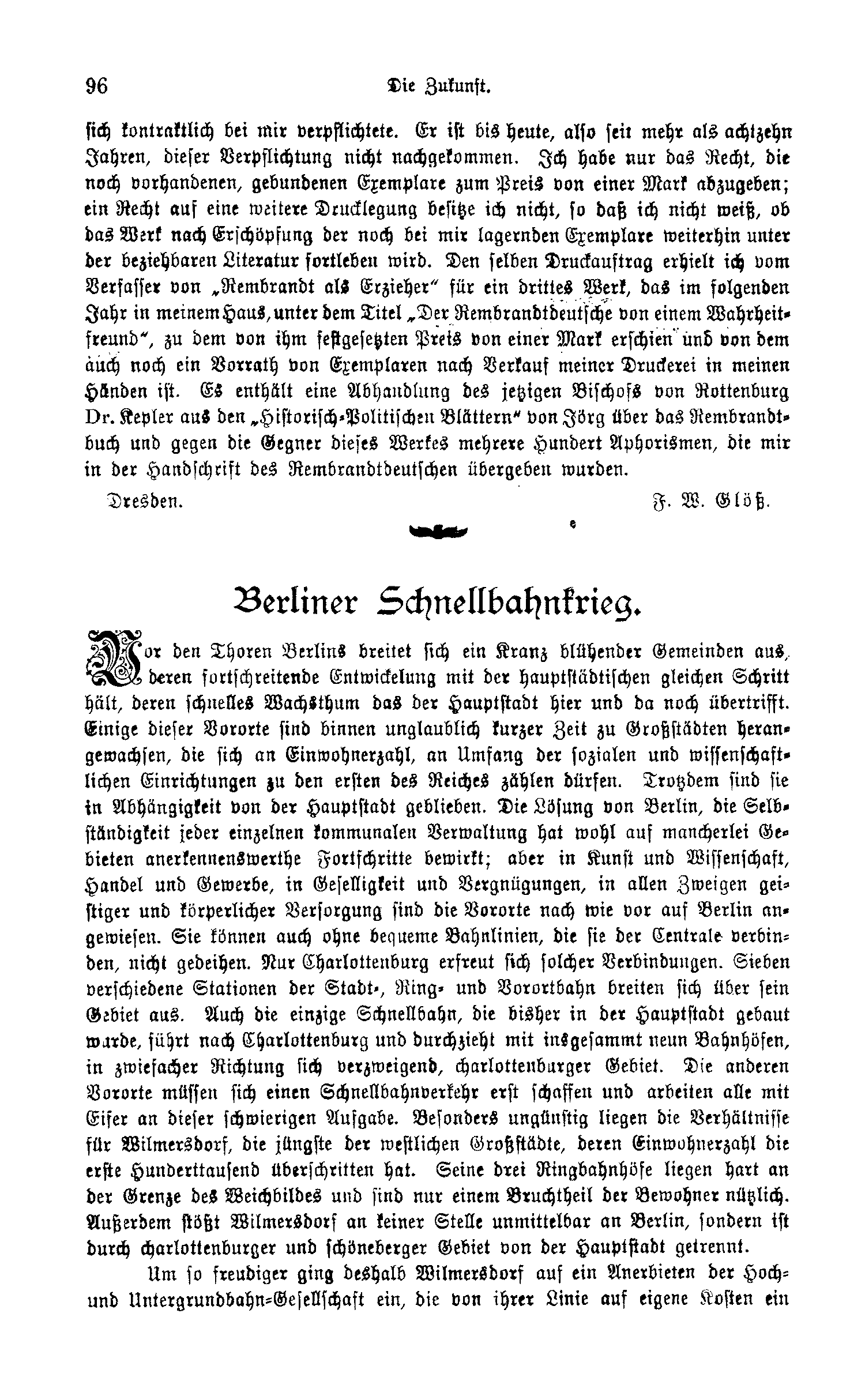 Texte
Texte
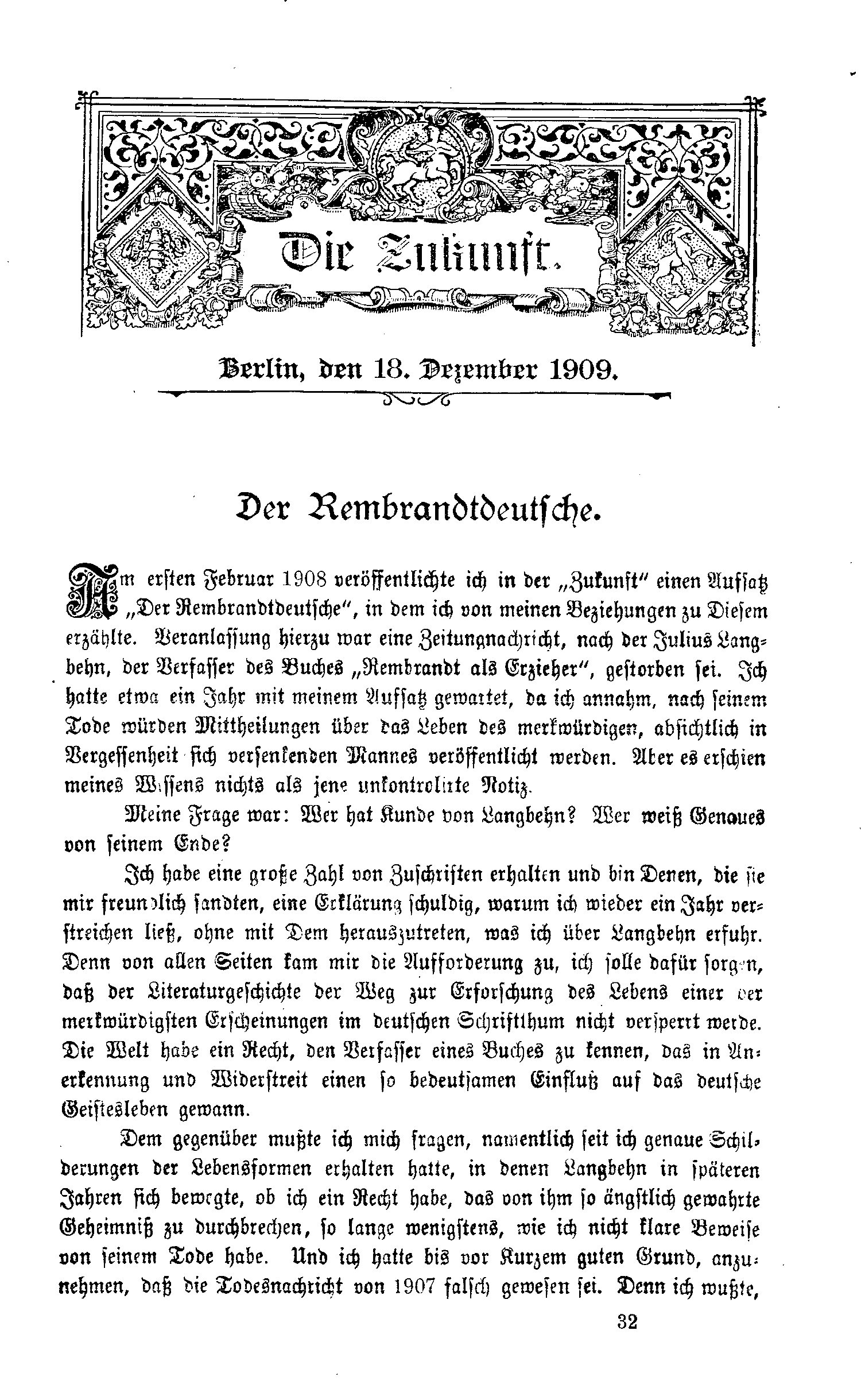
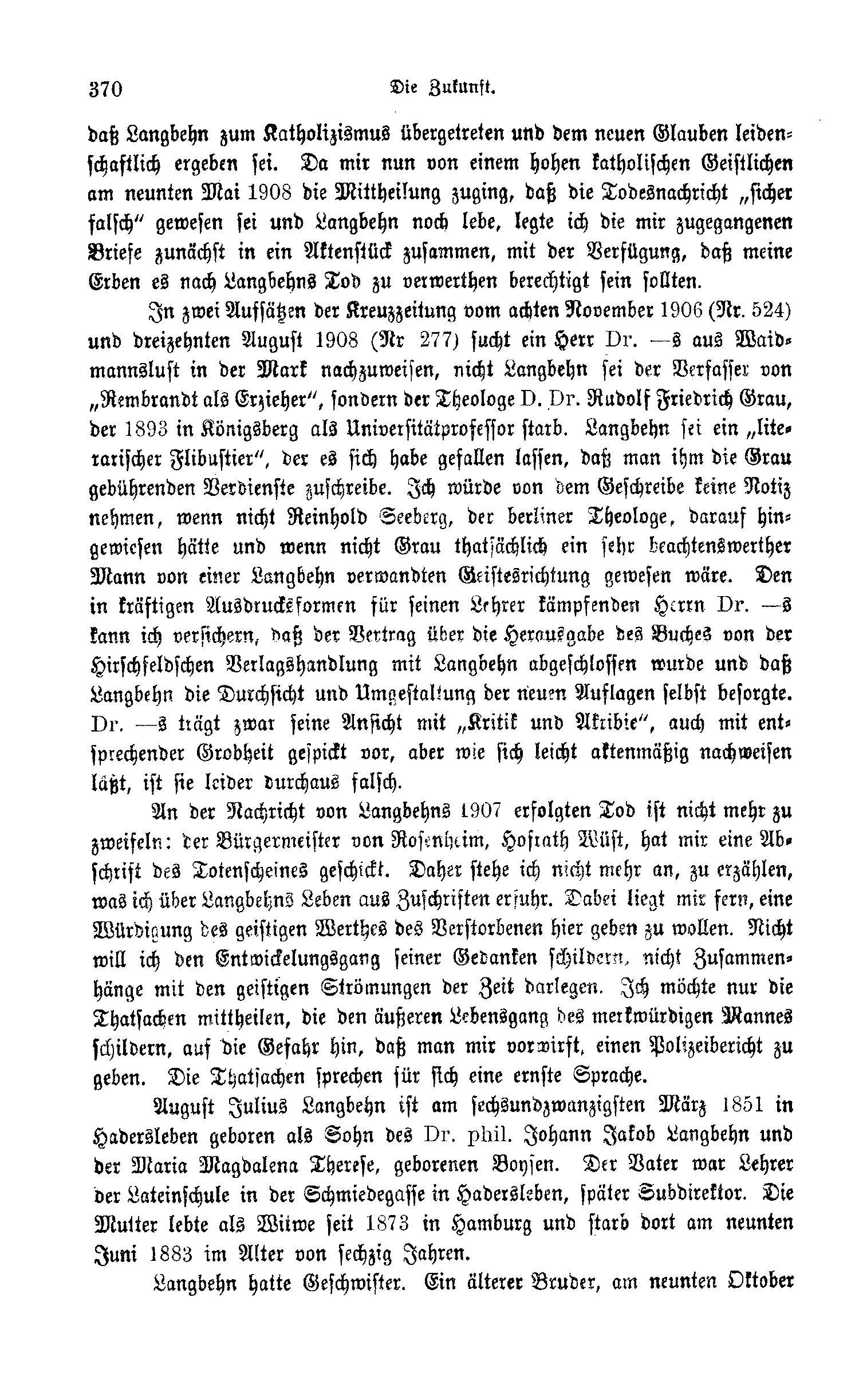
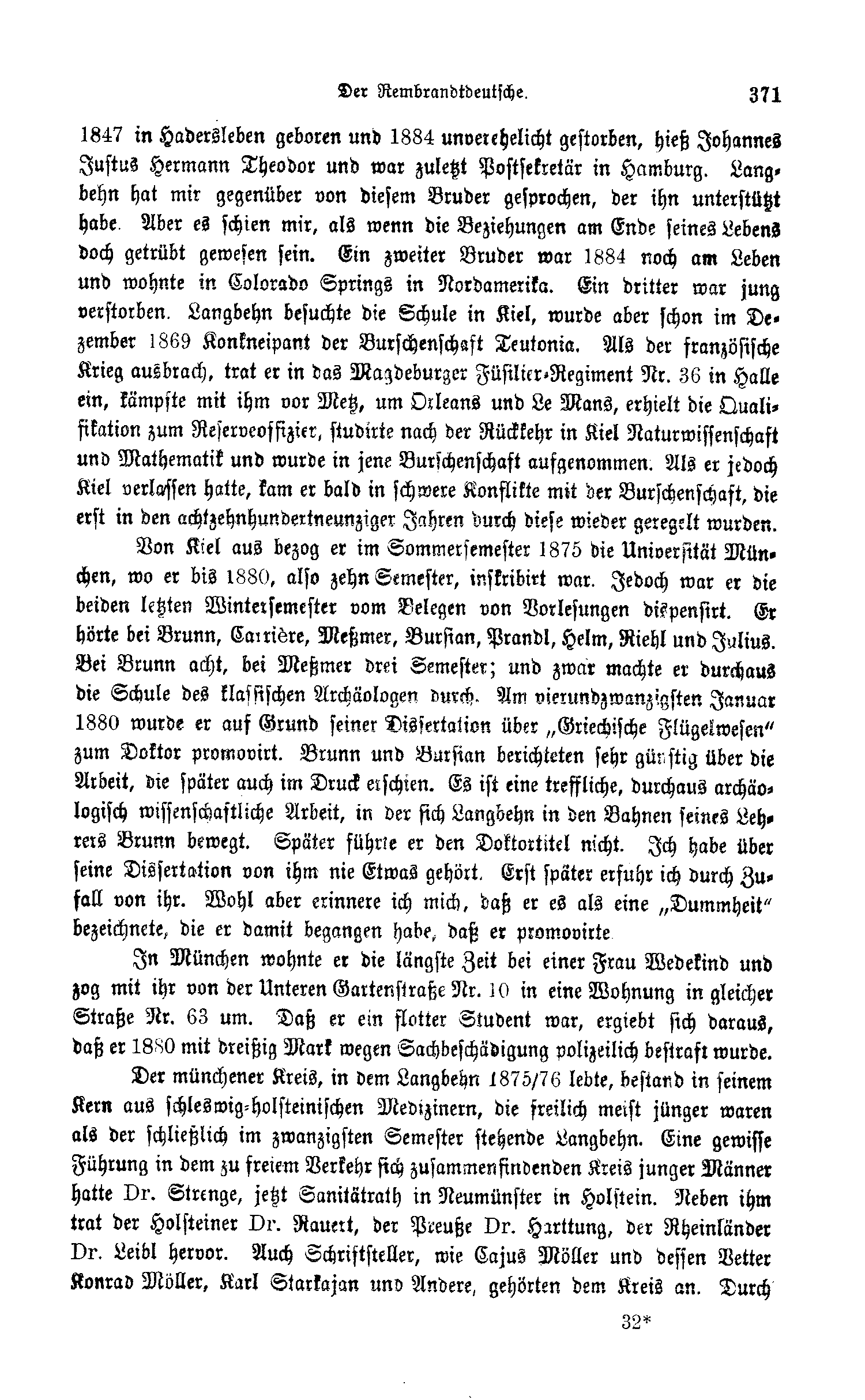
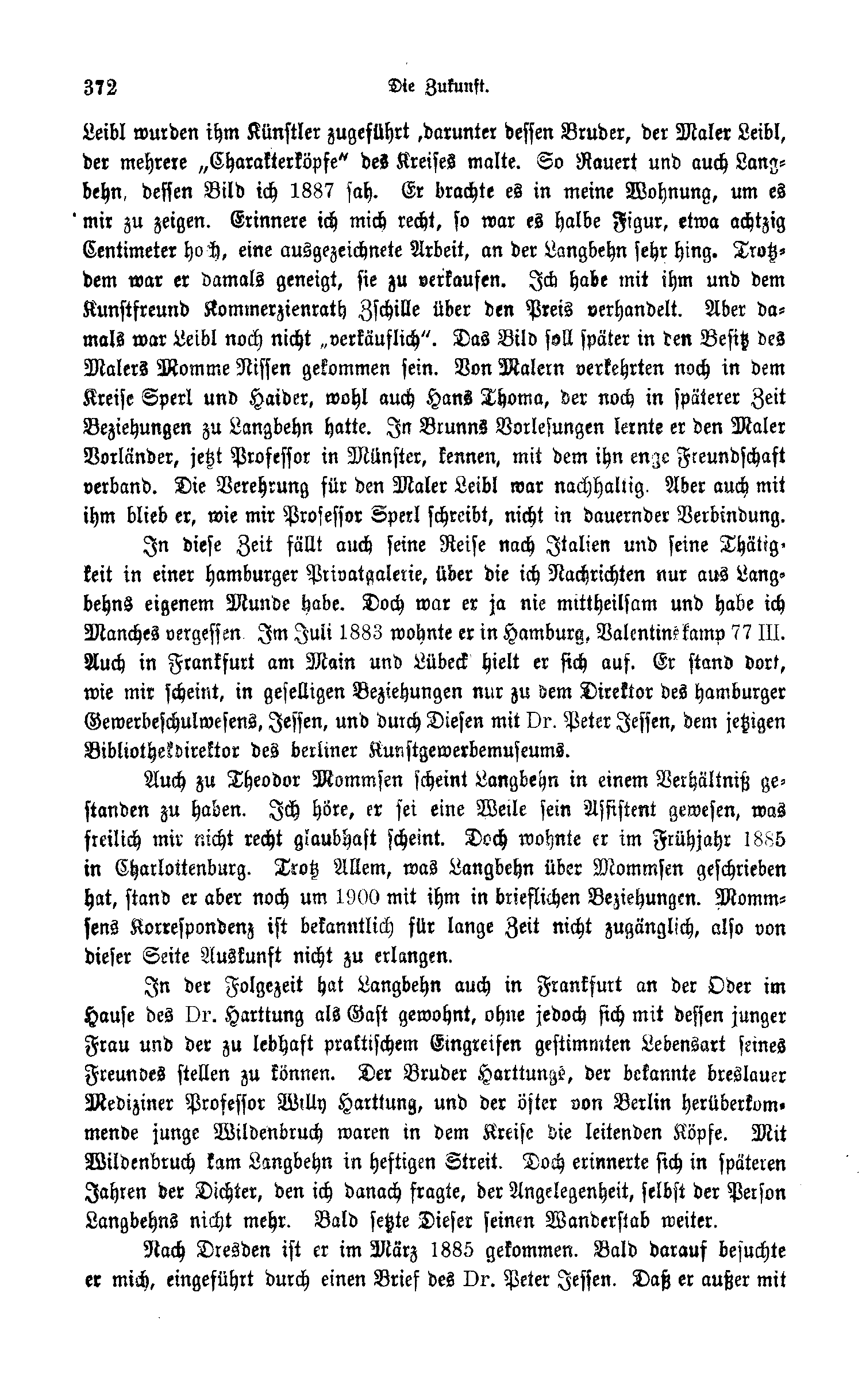
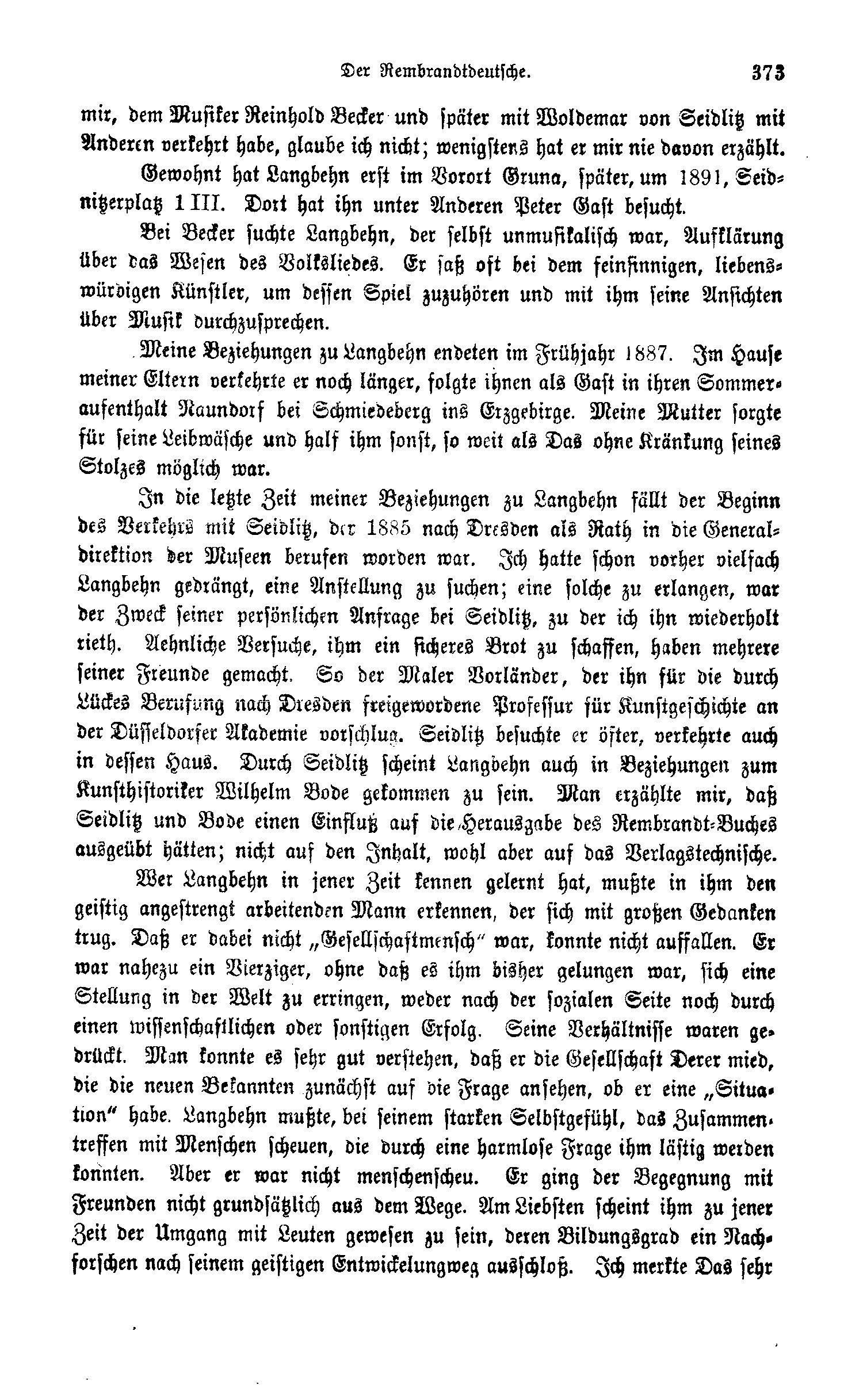
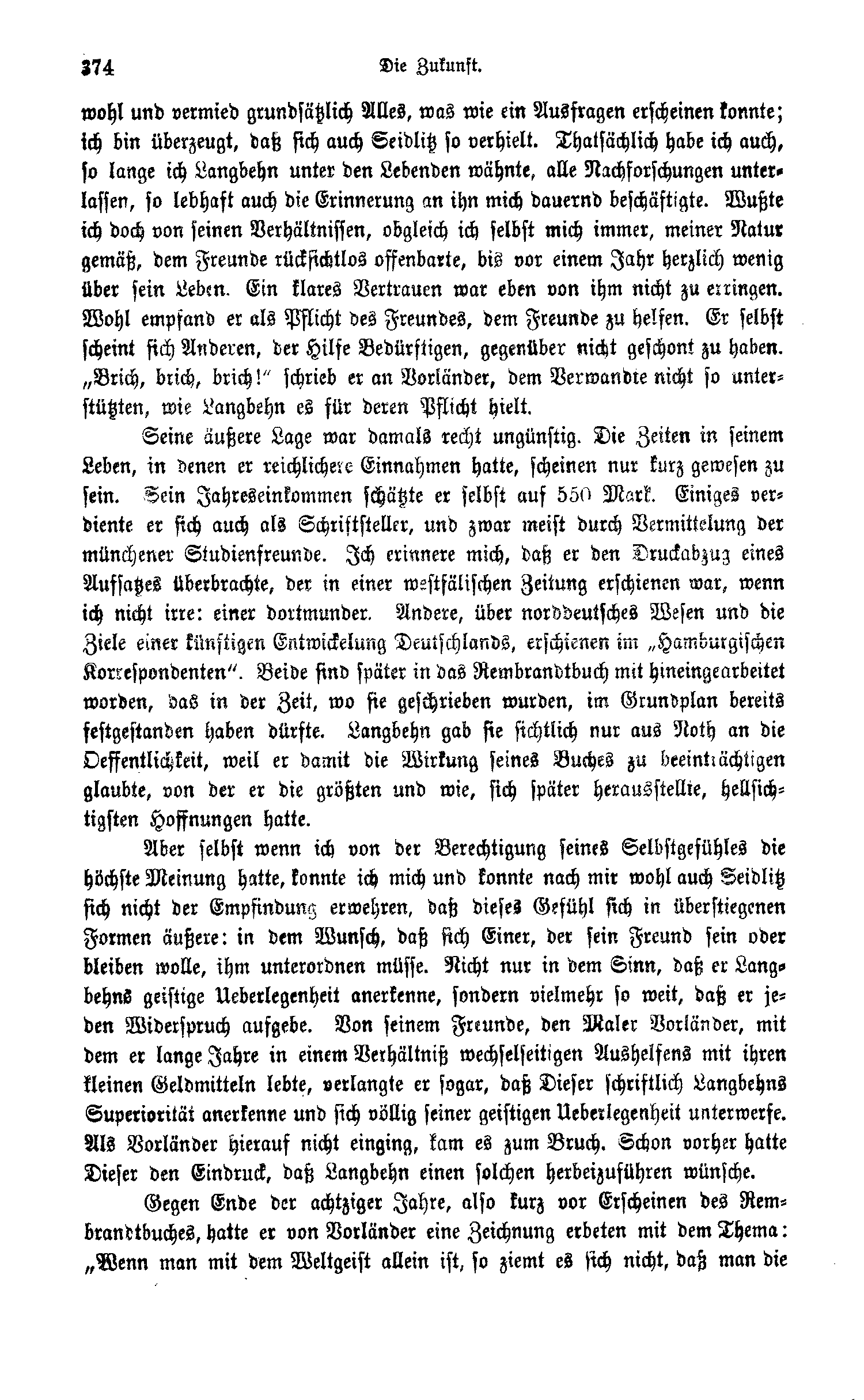
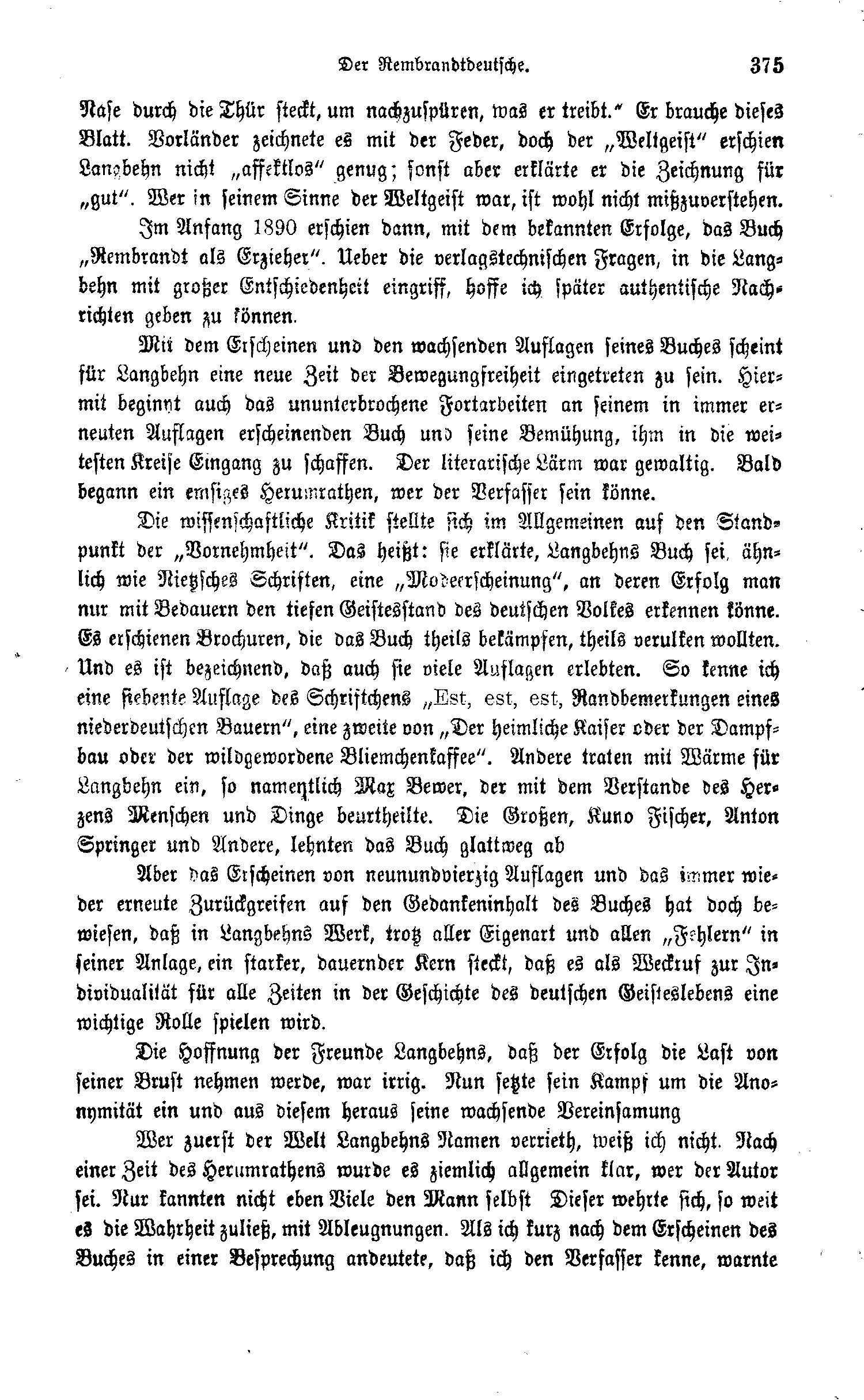
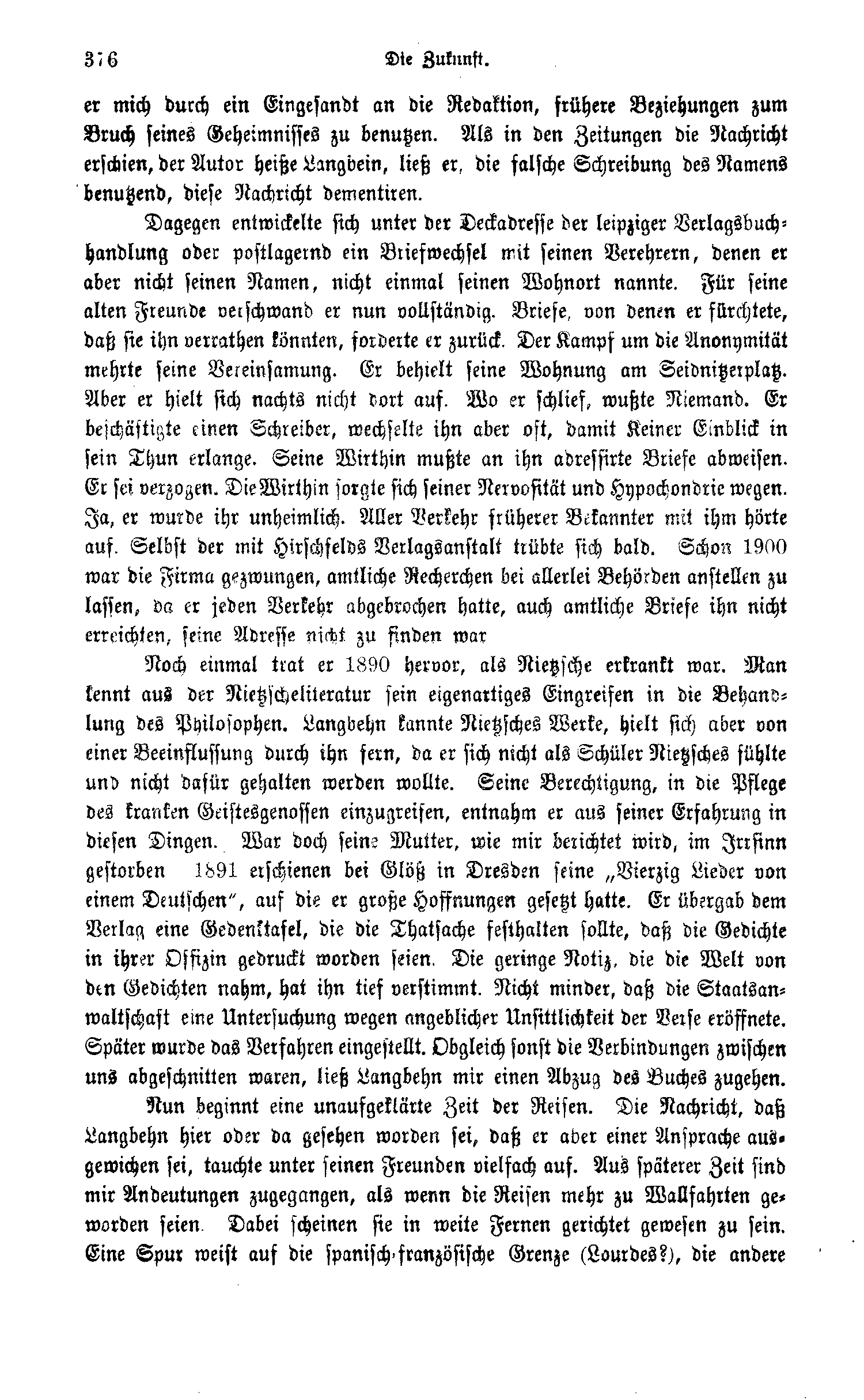
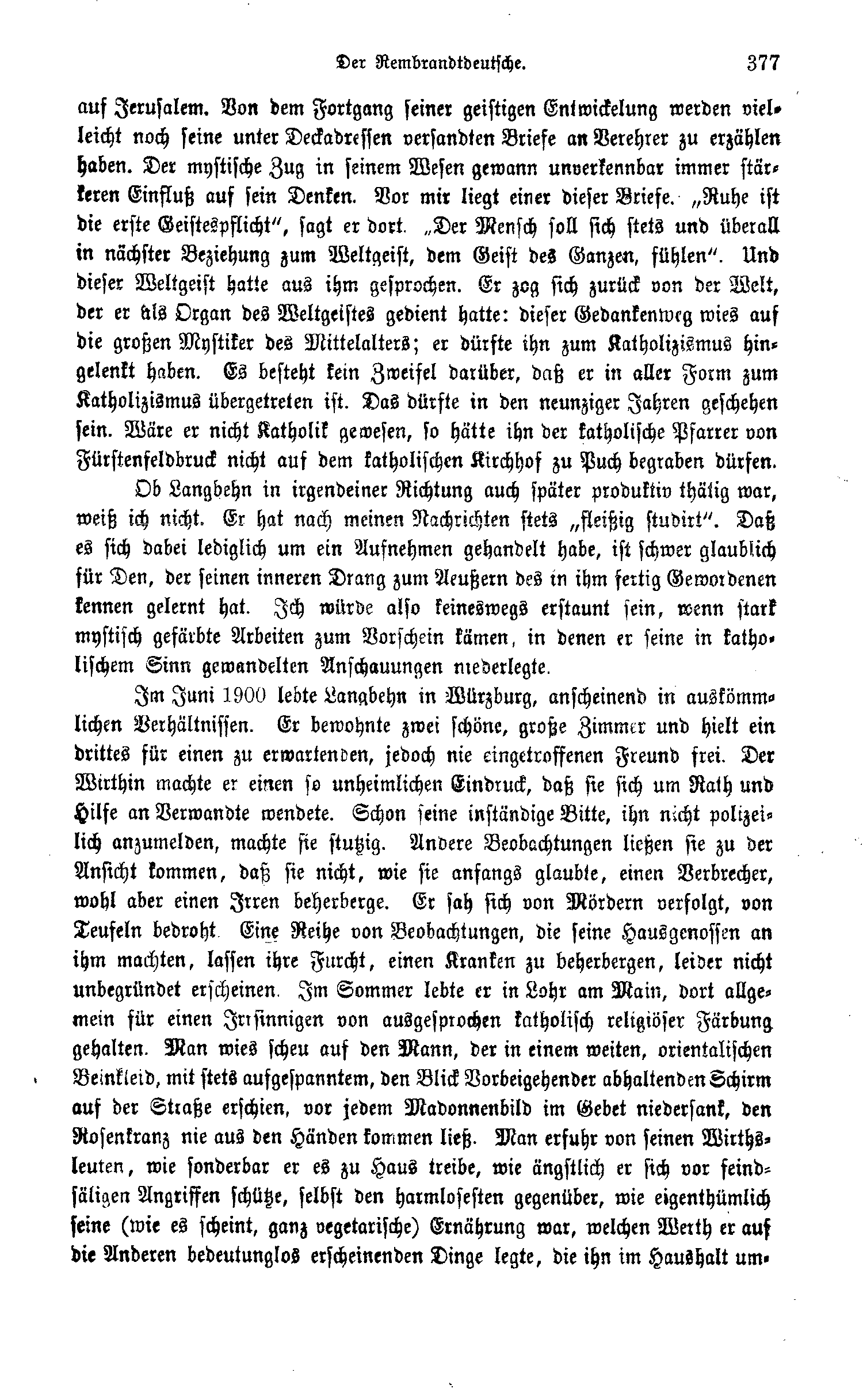
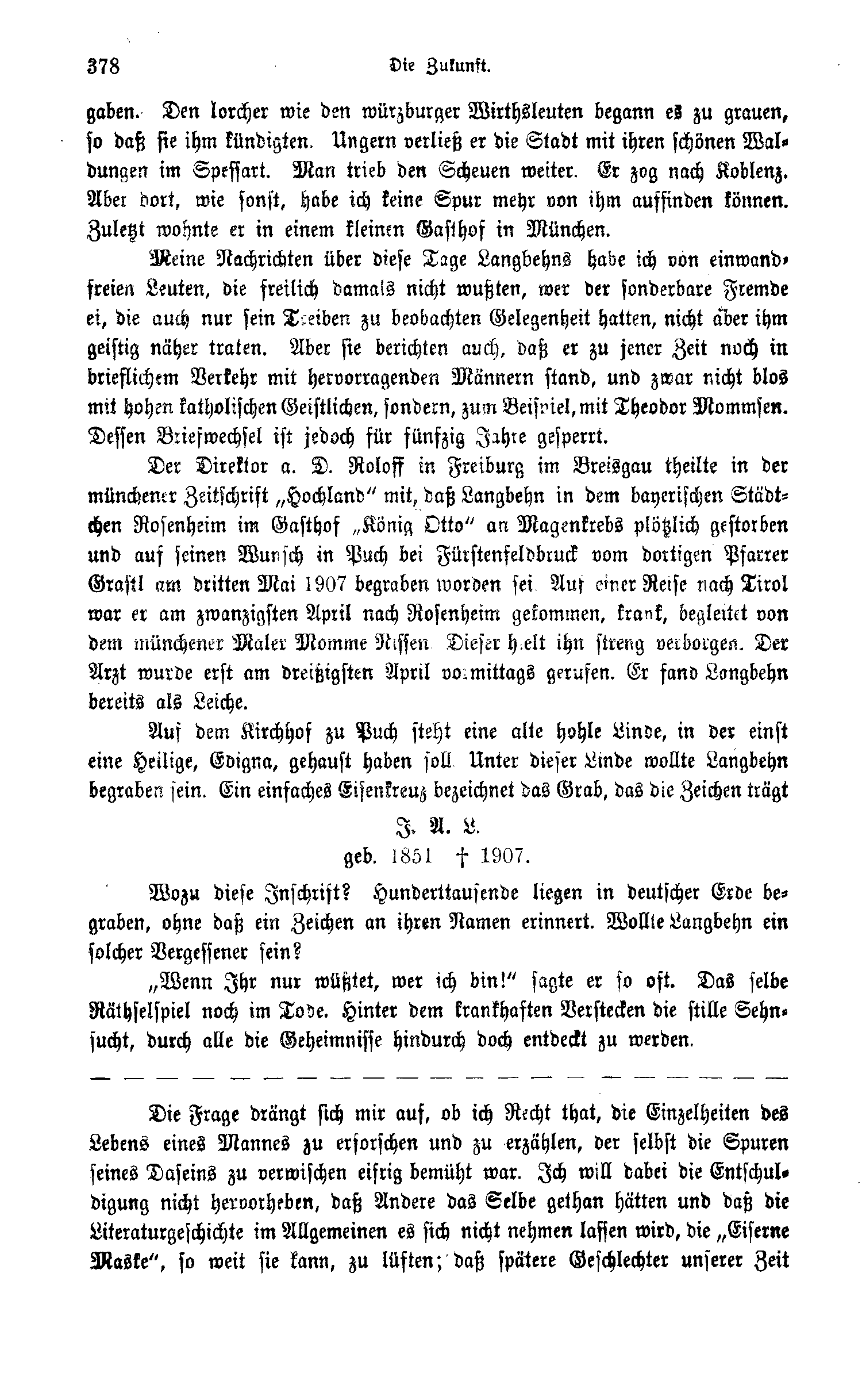
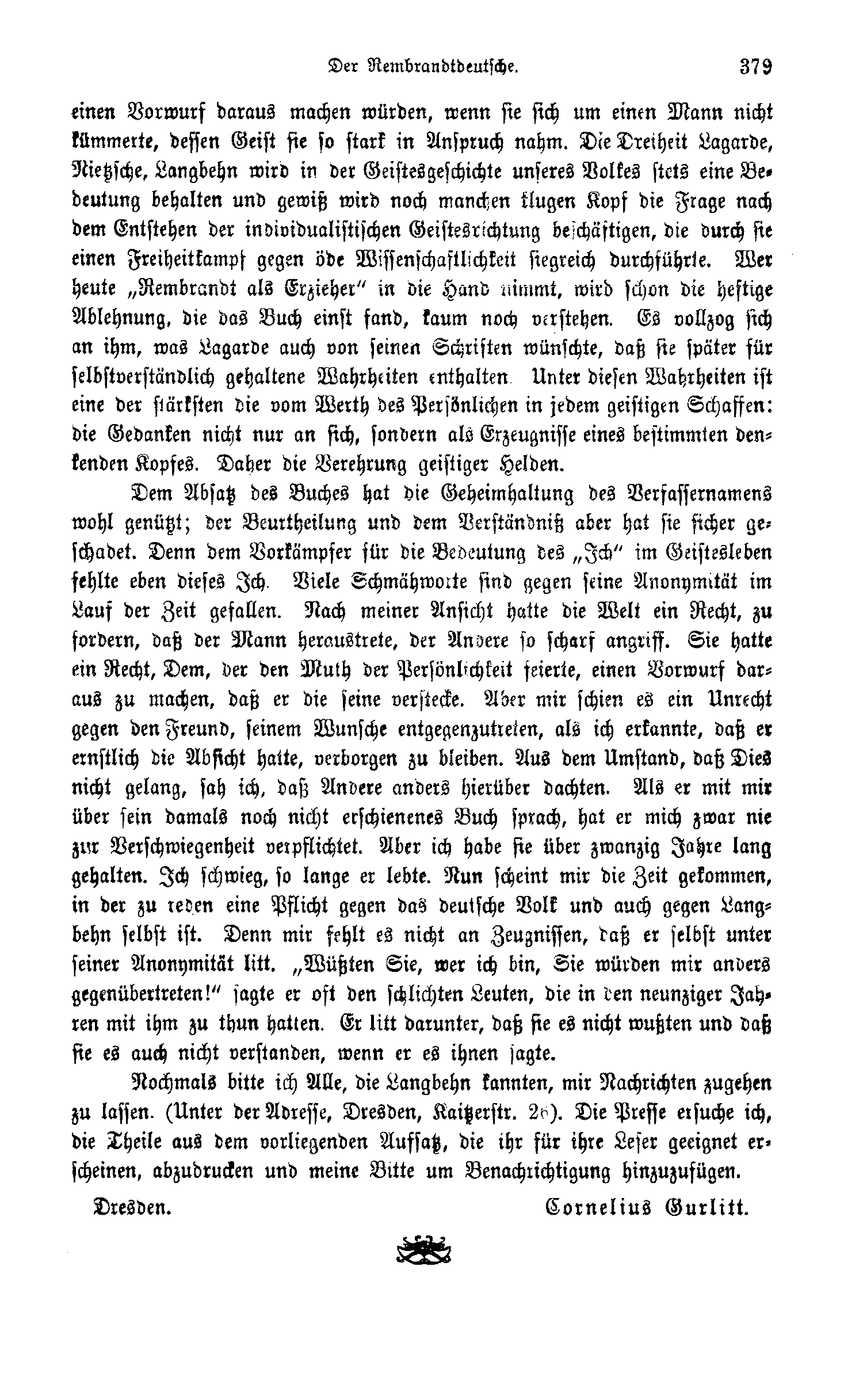
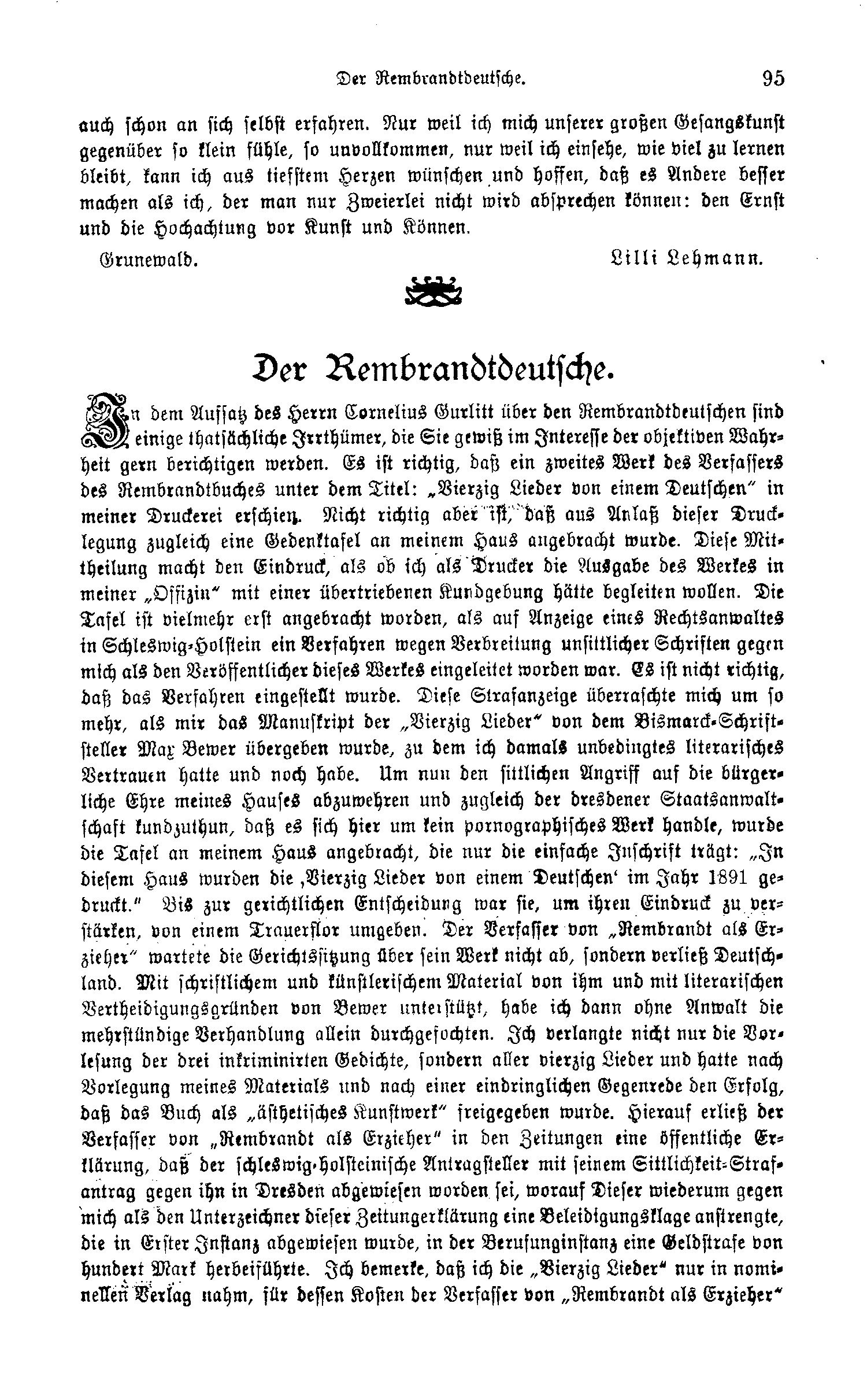
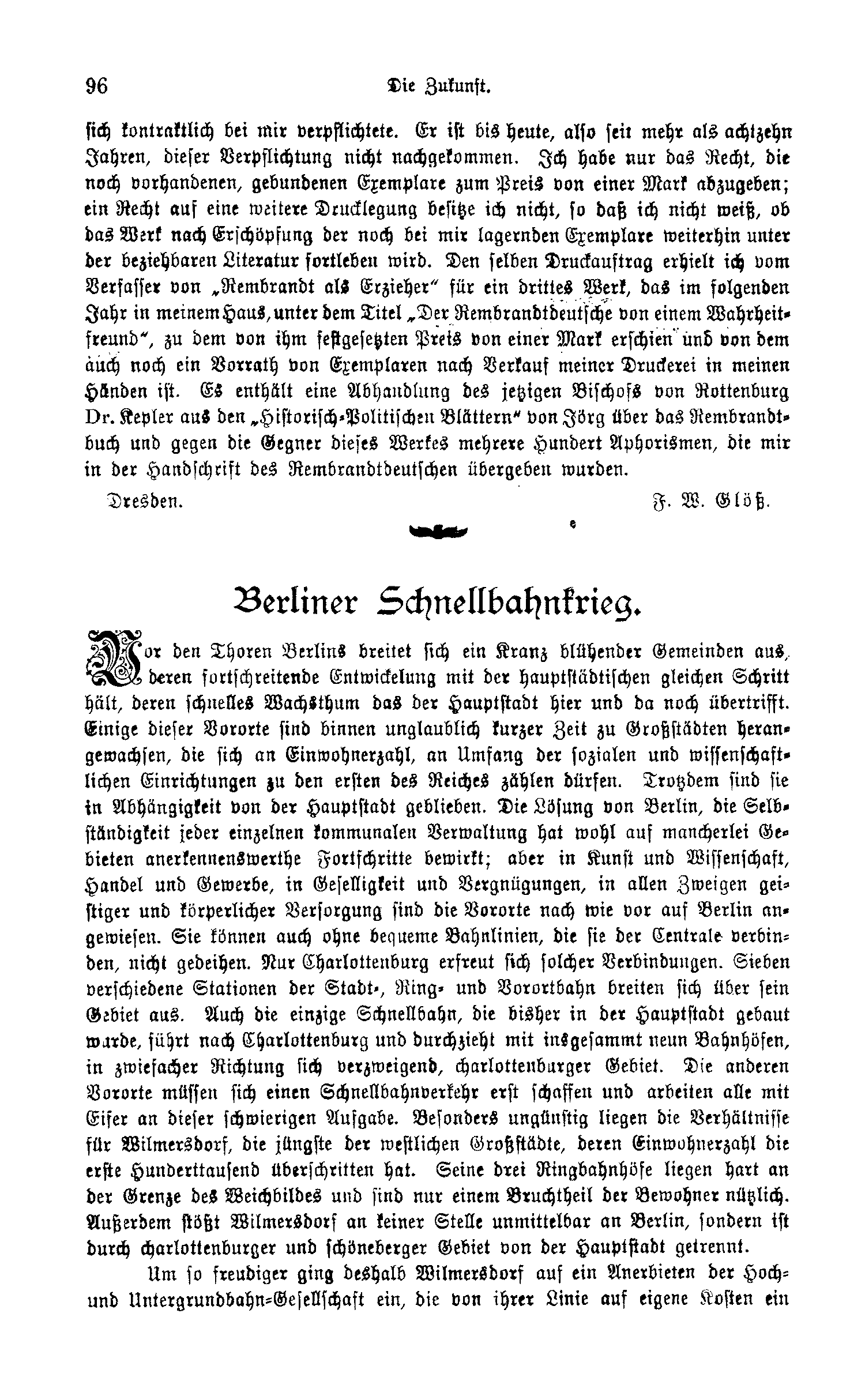 Texte
Texte
August Julius Langbehn wurde am 26. März 1851 in Hadersleben geboren und starb am 30. April 1907 in Rosenheim. Er war ein deutscher Schriftsteller und Kulturkritiker der Kaiserzeit.
Sein 1890 veröffentlichte Hauptwerk ist "Rembrandt als Erzieher".


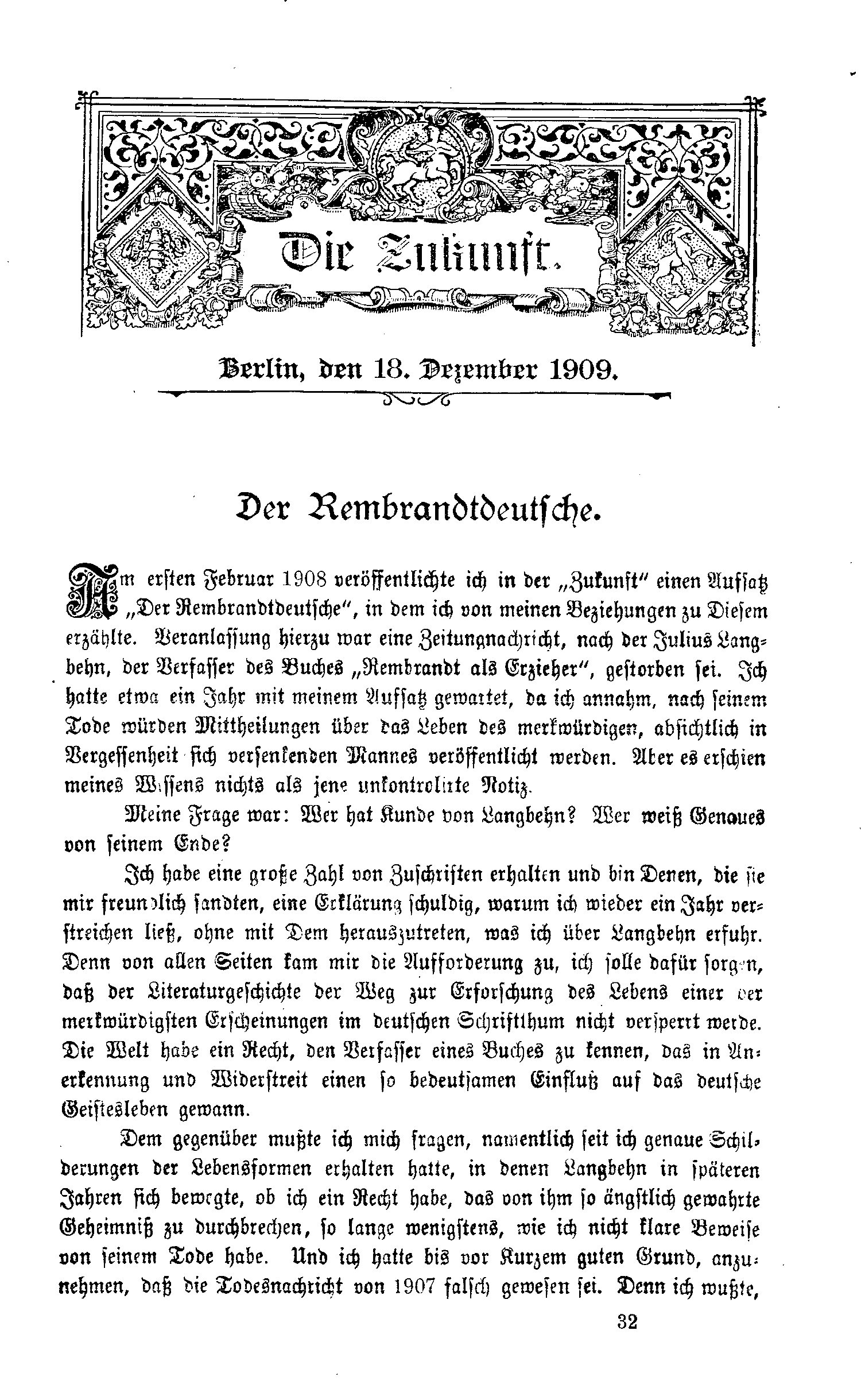
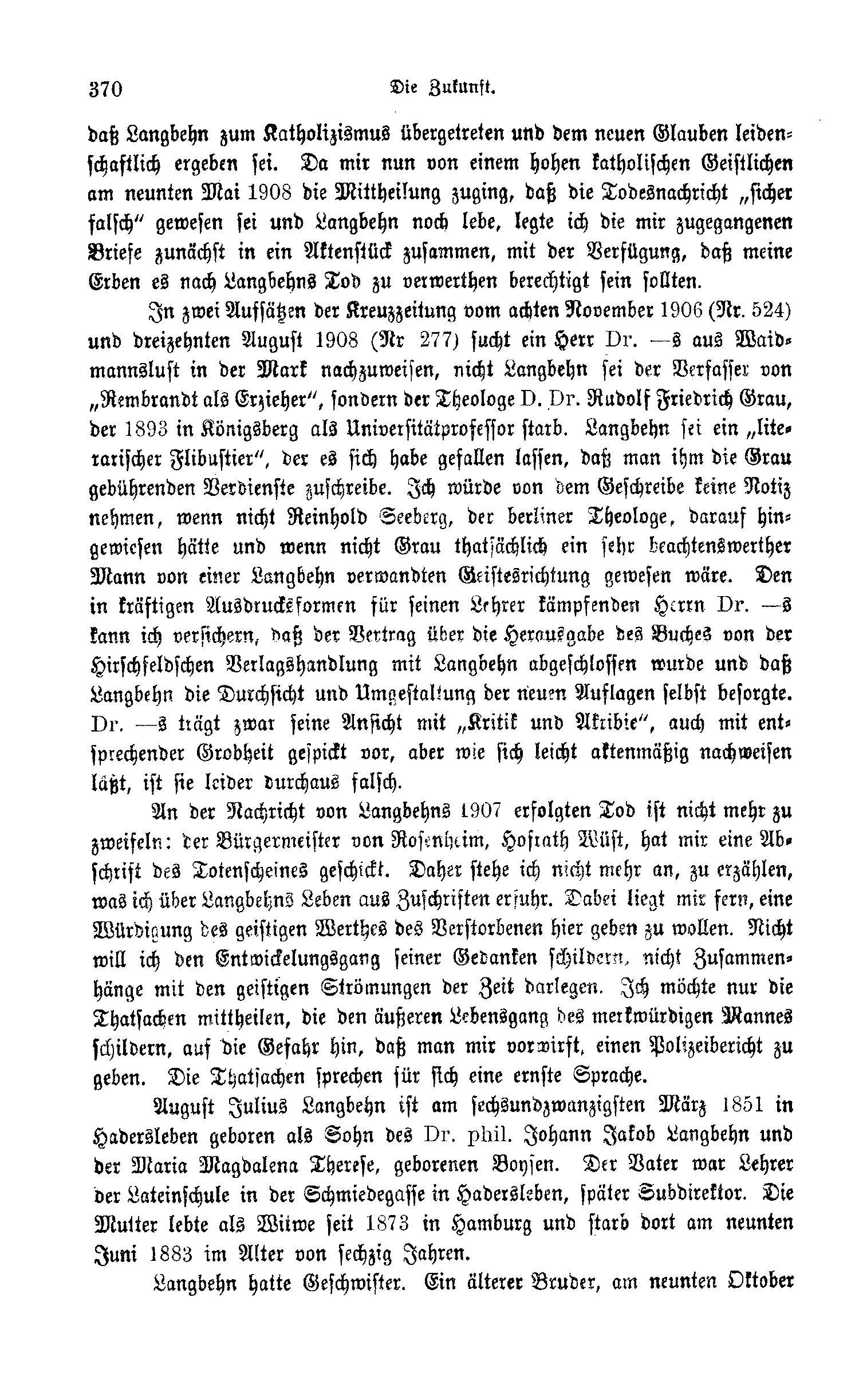
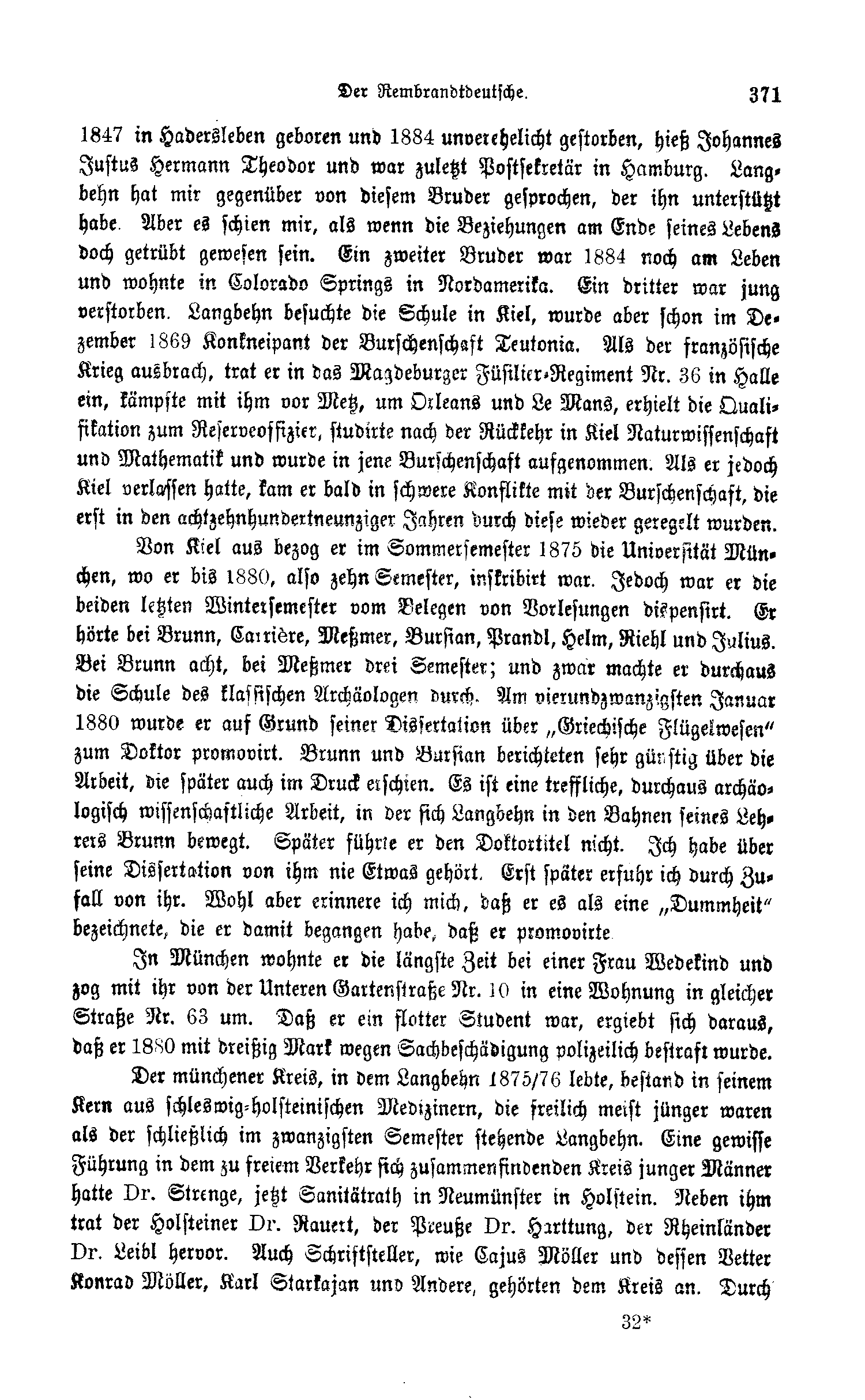
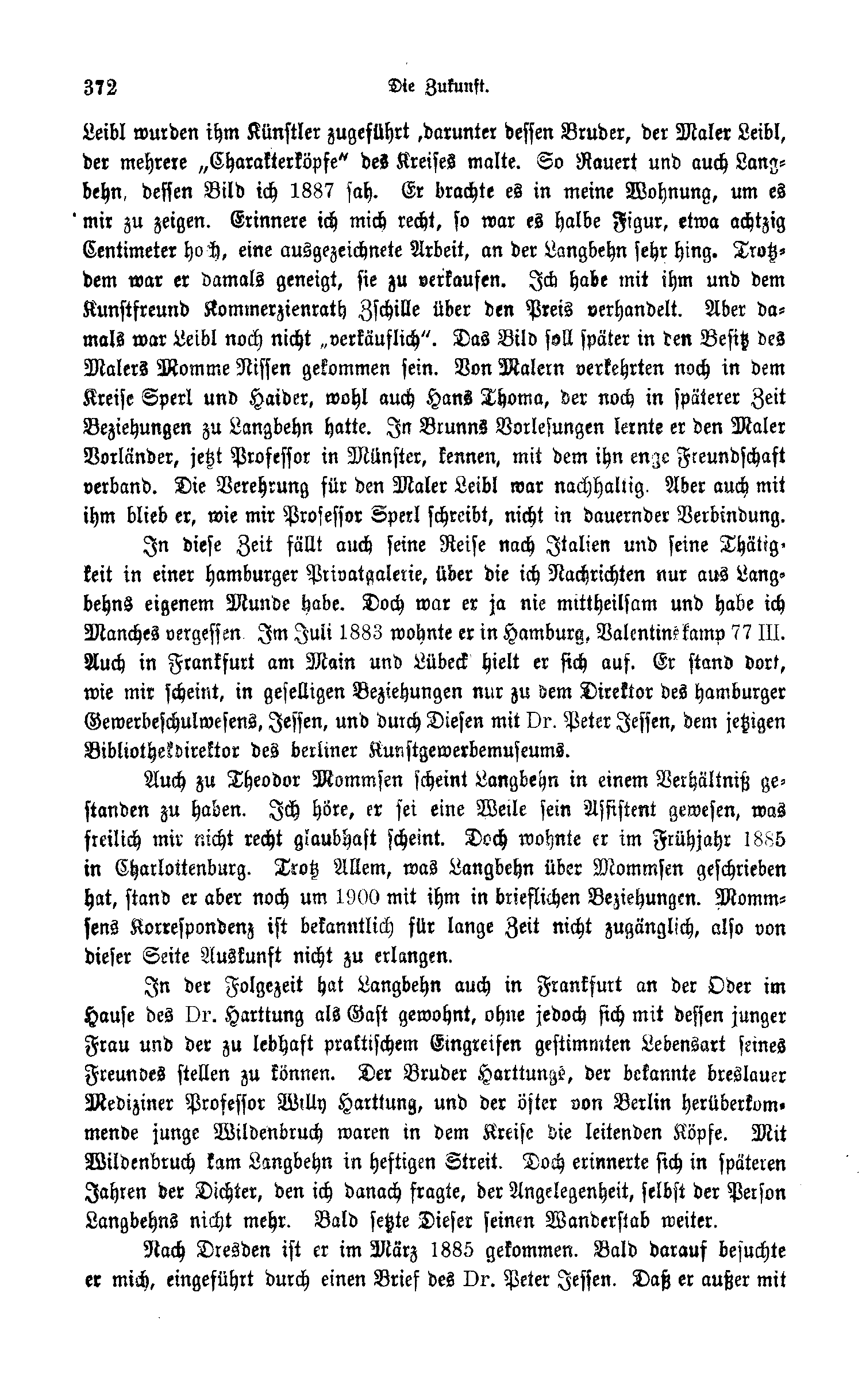
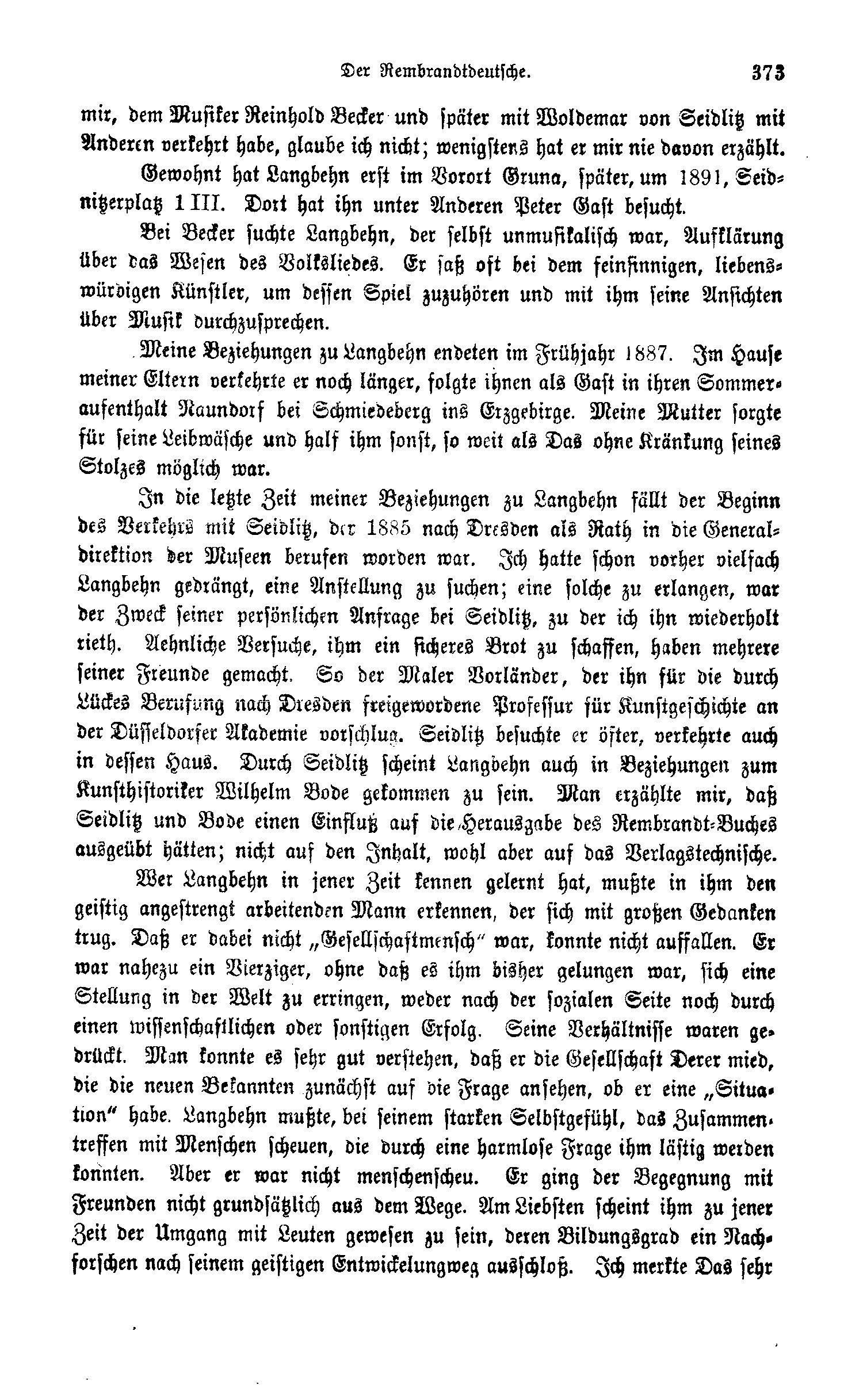
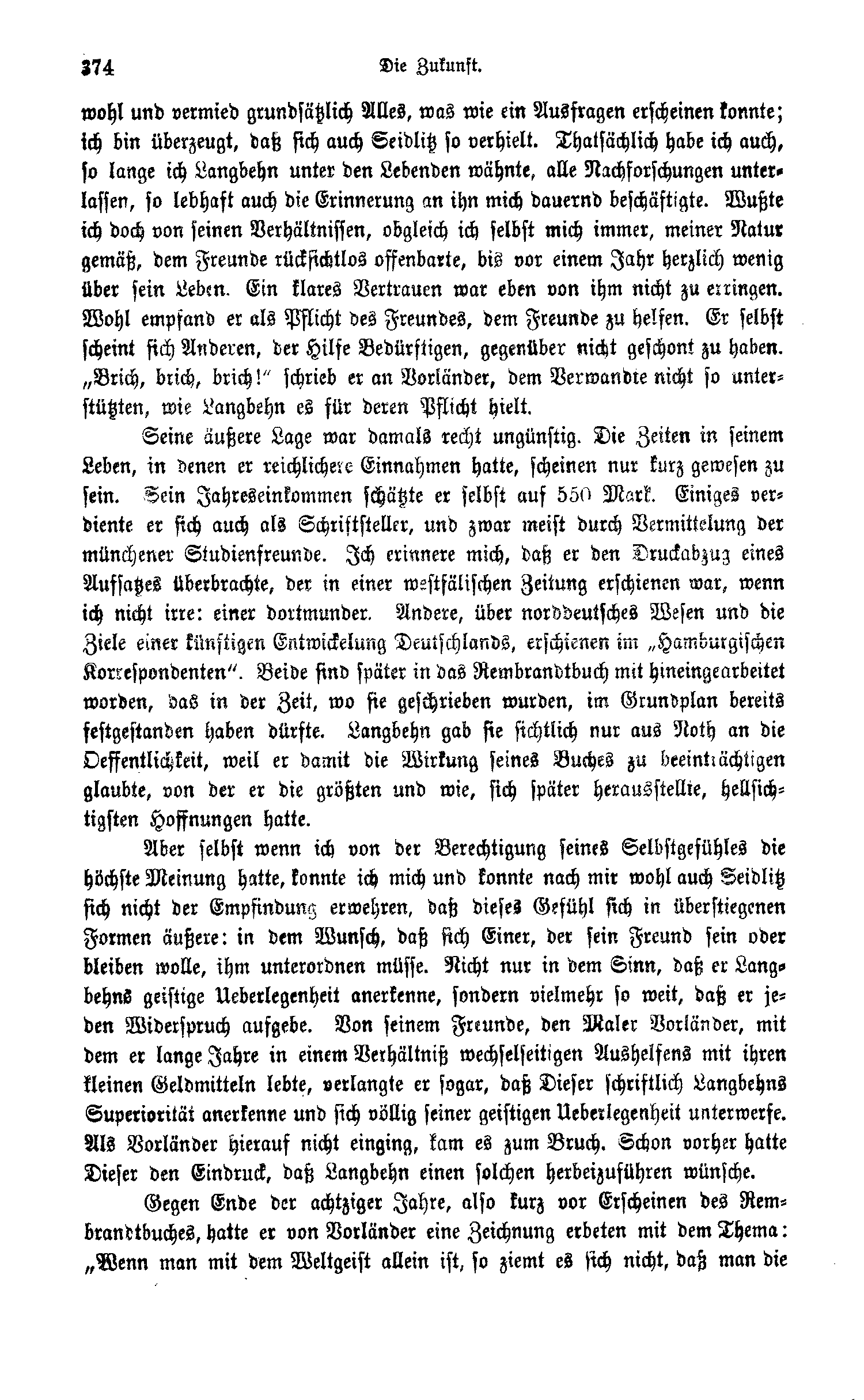
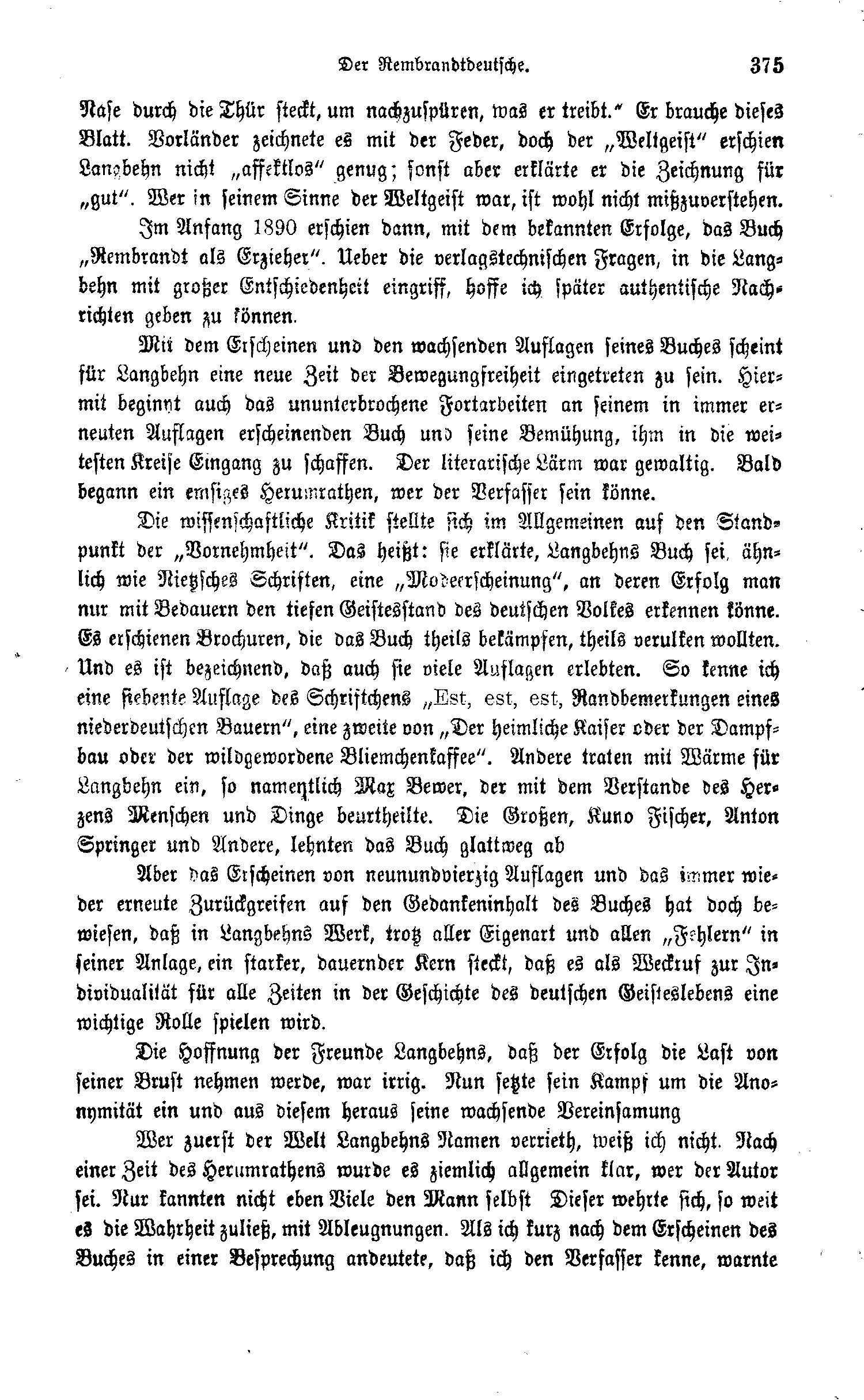
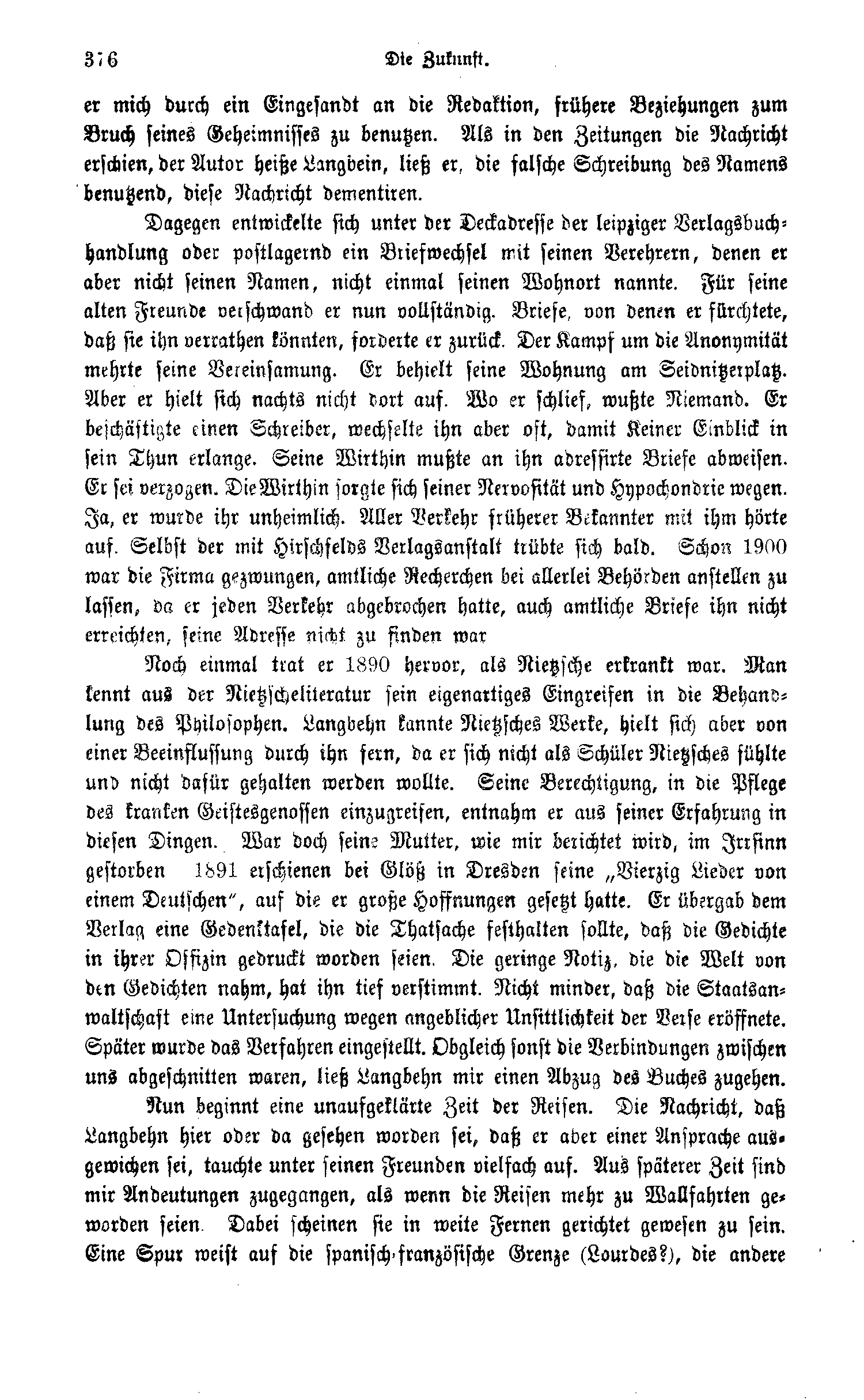
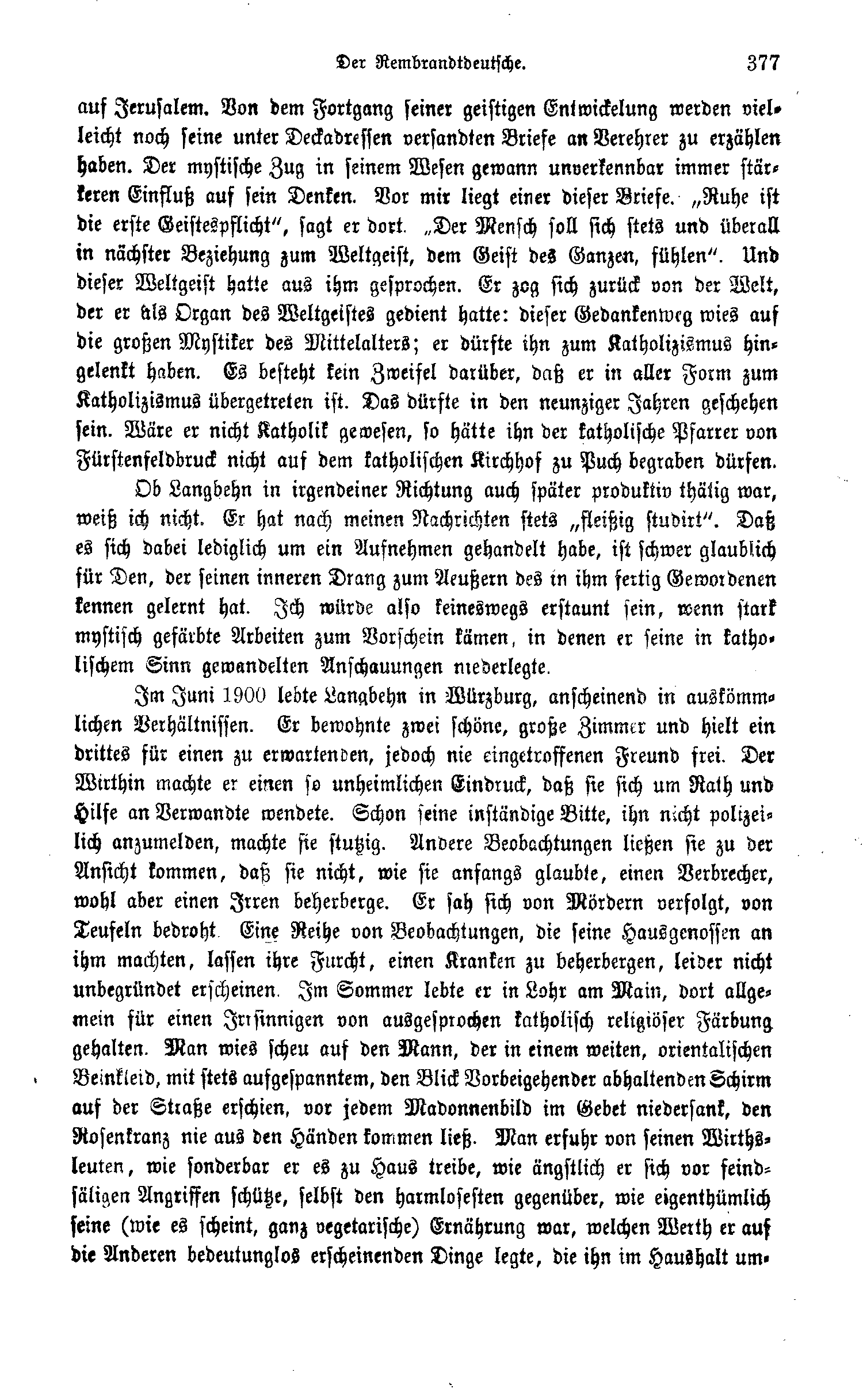
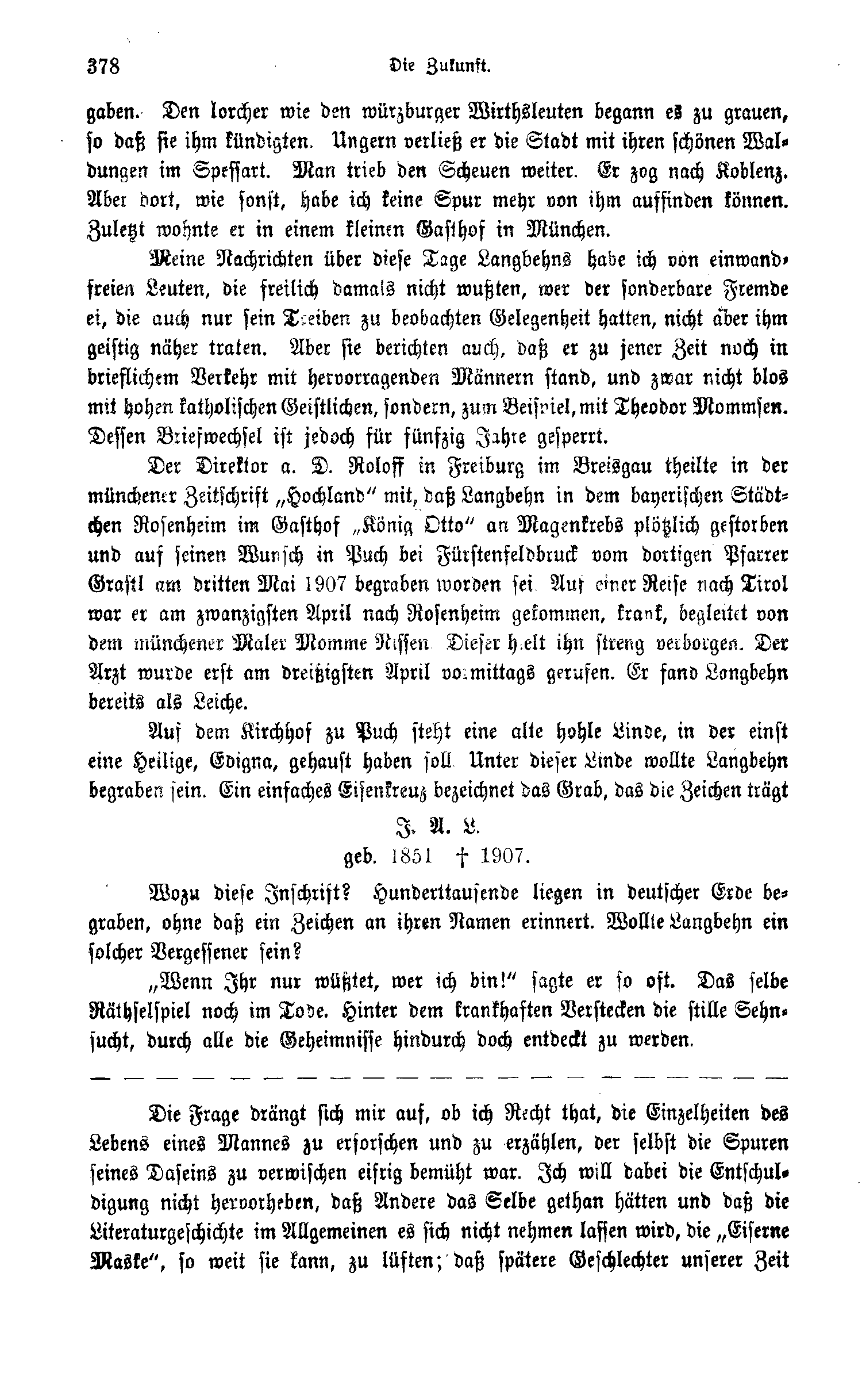
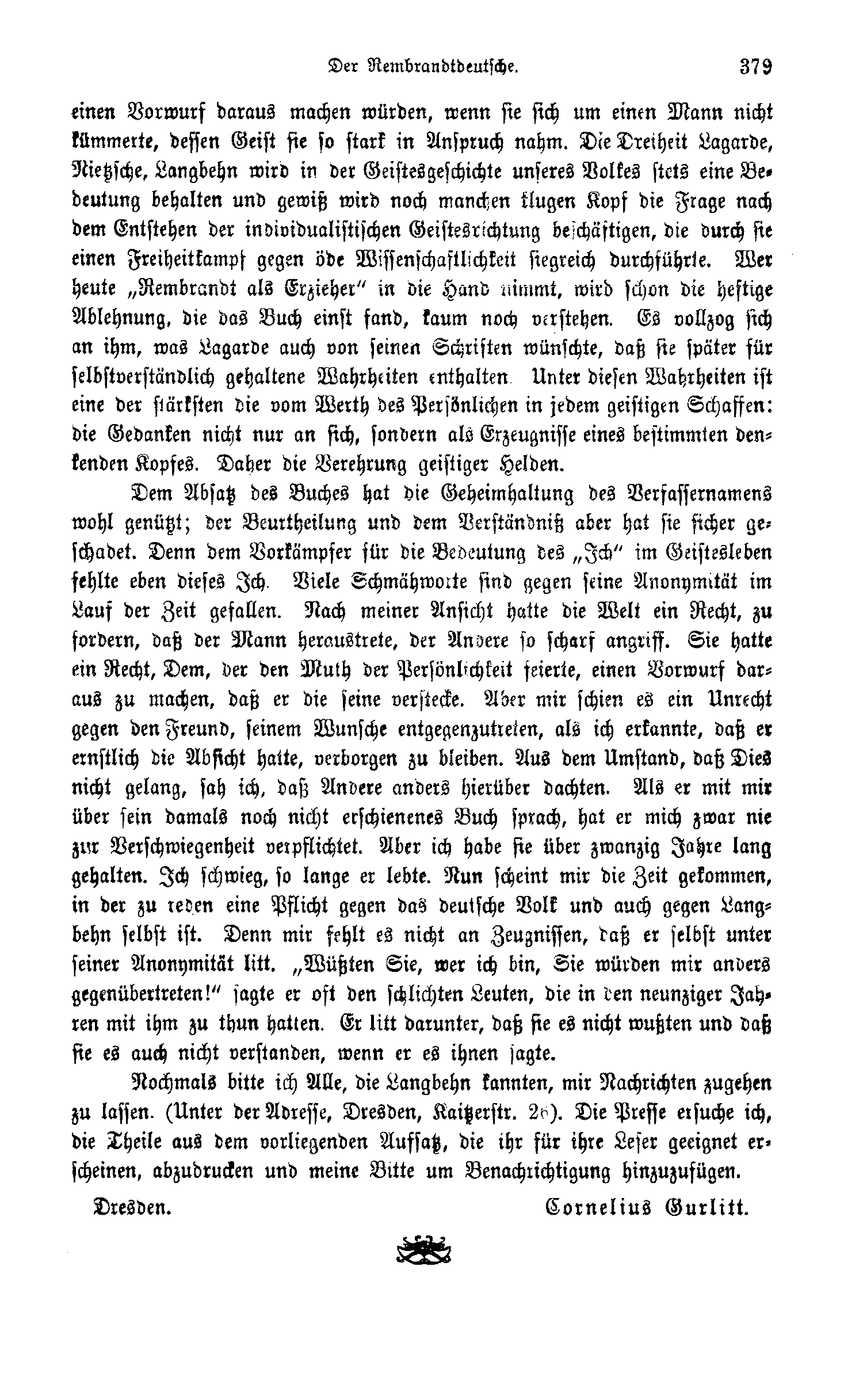
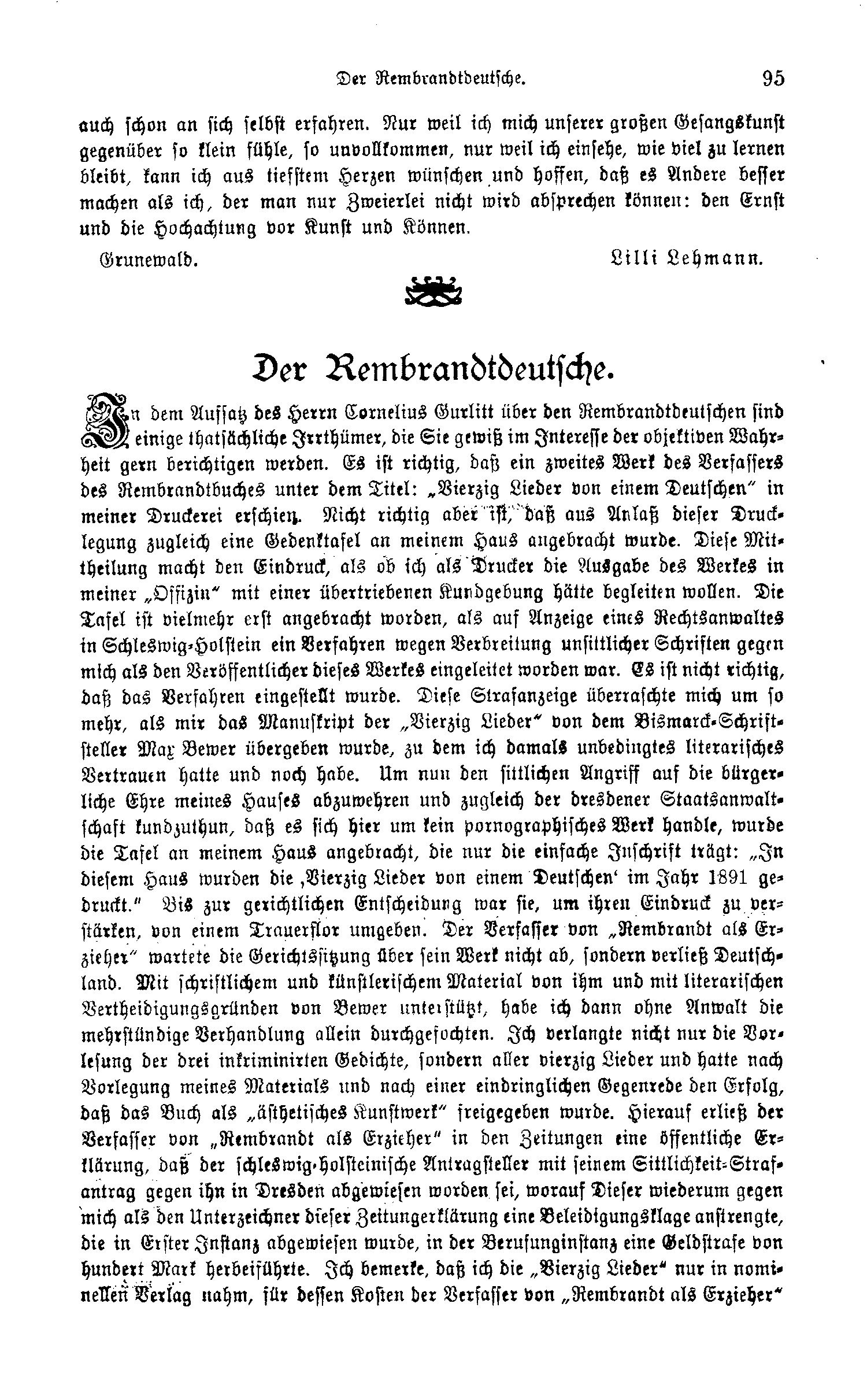
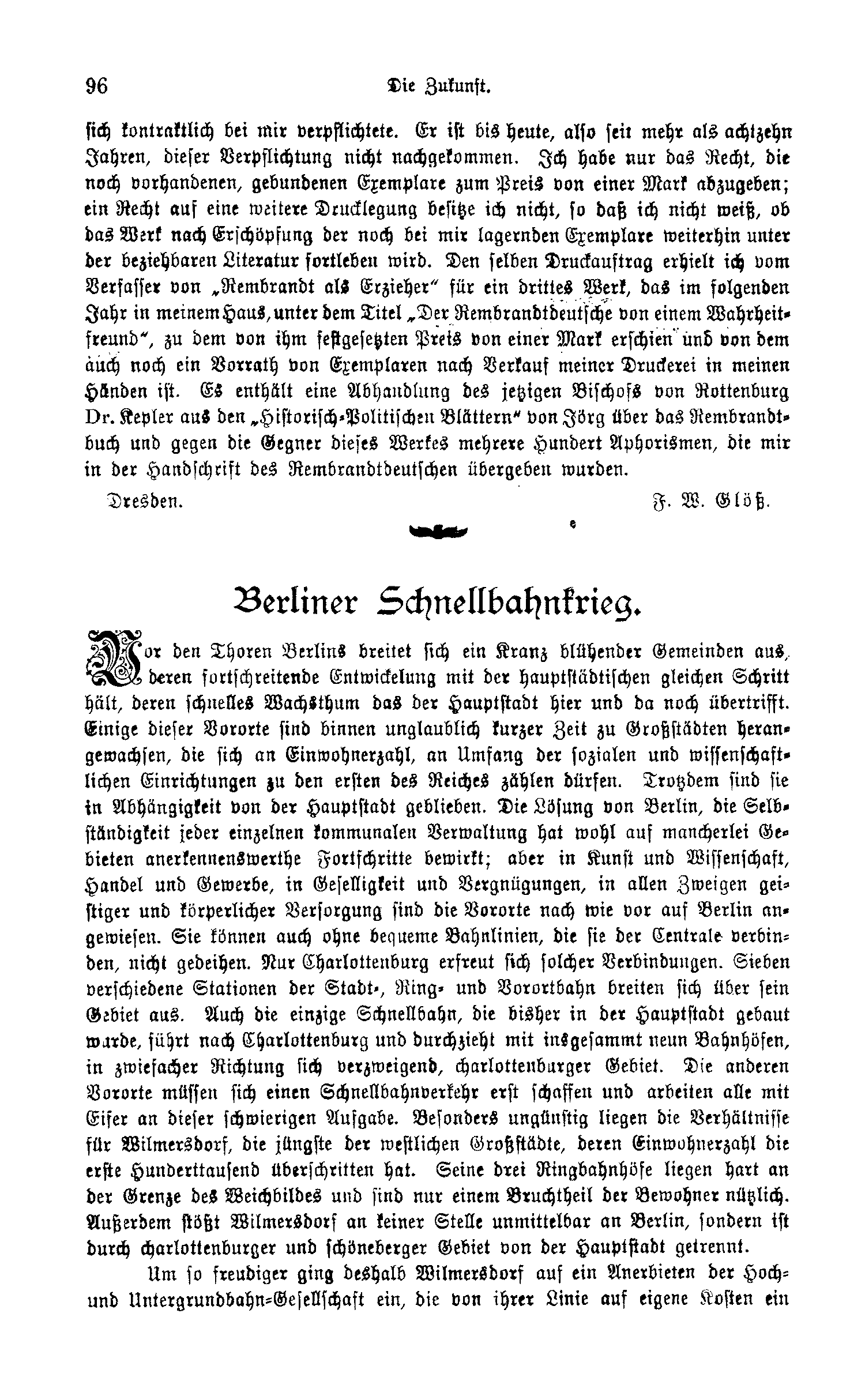
Berlin, den 18. Dezember 1909.
Der Rembrandtdeutsche.
Am ersten Februar 1908 veröffentlichte ich in der „Zukunft" einen Aufsatz „Der Rembrandtdeutsche", in dem ich von meinen Beziehungen zu Diesem erzählte. Veranlassung hierzu war eine Zeitungnachncht, nach der Julius Langbehn, der Verfasser des Buches „Rembrandt als Erzieher", gestorben sei. Ich hatte etwa ein Jahr mit meinem Aufsatz gewartet, da ich annahm, nach seinem Tode würden Mittheilungen über das Leben des merkwürdigen, absichtlich in Vergessenheit sich versenkenden Mannes veröffentlicht werden. Aber es erschien meines Wissens nichts als jene unkontrolirte Notiz.
Meine Frage war: Wer hat Kunde von Langbehn? Wer weiß Genaues von seinem Ende?
Ich habe eine große Zahl von Zuschriften erhalten und bin Denen, die sie mir freunslich sandten, eine Erklärung schuldig, warum ich wieder ein Jahr verstreichen ließ, ohne mit Dem herauszutreten, was ich über Langbehn erfuhr. Denn von allen Seiten kam mir die Aufforderung zu, ich solle dafür sorgen, daß der Literaturgeschichte der Weg zur Erforschung des Lebens einer der merkwürdigsten Erscheinungen im deutschen Schriftthum nicht versperrt werde. Die Welt habe ein Recht, den Verfasser eines Buches zu kennen, das in Anerkennung und Widerstreit einen so bedeutsamen Einfluß auf das deutsche Geistesleben gewann.
Dem gegenüber mußte ich mich fragen, namentlich seit ich genaue Schilderungen der Lebensformen erhalten hatte, in denen Langbehn in späteren Jahren sich bewegte, ob ich ein Recht habe, das von ihm so ängstlich gewahrte Geheimniß zu durchbrechen, so lange wenigstens, wie ich nicht klare Beweise von seinem Tode habe. Und ich hatte bis vor Kurzem guten Grund, anzunehmen, daß die Todesnachricht von 1907 falsch gewesen sei. Denn ich wußte,
370 - Die Zukunft.
daß Langbehn zum Katholizismus übergetreten und dem neuen Glauben leidenschaftlich ergeben sei. Da mir nun von einem hohen katholischen Geistlichen am neunten Mai 1908 die Mittheilung zuging, daß die Todesnachricht „sicher falsch" gewesen sei und Langbehn noch lebe, legte ich die mir zugegangenen Briefe zunächst in ein Aktenstück zusammen, mit der Verfügung, daß meine Erben es nach Langbehns Tod zu verwerthen berechtigt sein sollten.
In zwei Aufsätzen der Kreuzzeitung vom achten November 1906 (Nr. 524) und dreizehnten August 1908 (Nr 277) sucht ein Herr Dr. —s aus Waidmannslust in der Mark nachzuweisen, nicht Langbehn sei der Verfasser von „Rembrandt als Erzieher", sondern der Theologe v. Dr. Rudolf Friedrich Grau, der 1893 in Königsberg als Universitätprofessor starb. Langbehn sei ein „literarischer Flibustier", der es sich habe gefallen lassen, daß man ihm die Grau gebührenden Verdienste zuschreibe. Ich würde von dem Geschreibe keine Notiz nehmen, wenn nicht Reinhold Seeberg, der berliner Theologe, darauf hingewiesen hätte und wenn nicht Grau thatsächlich ein sehr beachtenswerther Mann von einer Langbehn verwandten Geistesrichtung gewesen wäre. Den in kräftigen Ausdrucksformen für seinen Lehrer kämpfenden Herrn Dr. —s kann ich versichern, daß der Vertrag über die Herausgabe des Buches von der Hirschseldschen Verlagshandlung mit Langbehn abgeschlossen wurde und daß Langbehn die Durchsicht und Umgestaltung der neuen Auflagen selbst besorgte. Dr. —s trägt zwar seine Ansicht mit „Kritik und Akribie", auch mit entsprechender Grobheit gespickt vor, aber wie sich leicht aktenmäßig nachweisen läßt, ist sie leider durchaus falsch.
An der Nachricht von Langbehns 1907 erfolgten Tod ist nicht mehr zu zweifeln: der Bürgermeister von Rosenheim, Hofrath Wüst, hat mir eine Abschuft des Totenscheines geschickt. Daher stehe ich nicht mehr an, zu erzählen, was ich über Langbehns Leben aus Zuschriften erfuhr. Dabei liegt mir fern, eine Würdigung des geistigen Werthes des Verstorbenen hier geben zu wollen. Nicht will ich den Entwickelungsgang seiner Gedanken schildern, nicht Zusammenhänge mit den geistigen Strömungen der Zeit darlegen. Ich möchte nur die Thatsachen mittheilen, die den äußeren Lebensgang des merkwürdigen Mannes schildern, auf die Gefahr hin, daß man mir vorwirft, einen Polizeibericht zu geben. Die Thatsachen sprechen für sich eine ernste Sprache.
August Julius Langbehn ist am sechsundzwanzigsten März 1851 in Hadersleben geboren als Sohn des Dr. phil. Johann Jakob Langbehn und der Maria Magdalena Therese, geborenen Boysen. Der Vater war Lehrer der Lateinschule in der Schmiedegasse in Hadersleben, später Subdirektor. Die Mutter lebte als Witwe seit 1873 in Hamburg und starb dort am neunten Juni 1883 im Alter von sechzig Jahren.
Langbehn hatte Geschwister. Ein älterer Bruder, am neunten Oktober
371 - Der Rembrandtdeutsche.
1847 in Hadersleben geboren und 1884 unverehelicht gestorben, hieß Johannes Justus Hermann Theodor und war zuletzt Postsekretär in Hamburg. Langbehn hat mir gegenüber von diesem Bruder gesprochen, der ihn unterstützt habe. Aber es schien mir, als wenn die Beziehungen am Ende seines Lebens doch getrübt gewesen sein. Ein zweiter Bruder war 1884 noch am Leben und wohnte in Colorado Springs in Nordamerika. Ein dritter war jung verstorben. Langbehn besuchte die Schule in Kiel, wurde aber schon im Dezember 1869 Konkneipant der Burschenschaft Teutonia. Als der französische Krieg ausbrach, trat er in das Magdeburger Füsilier-Regiment Nr. 36 in Halle ein, kämpfte mit ihm vor Metz, um Orleans und Le Mans, erhielt die Qualifikation zum Reserveoffizier, studirts nach der Rückkehr in Kiel Naturwissenschaft und Mathematik und wurde in jene Burschenschaft aufgenommen. Als er jedoch Kiel verlassen hatte, kam er bald in schwere Konflikte mit der Burschenschaft, die erst in den achtzehnhundertneunziger Jahren durch diese wieder geregelt wurden.
Von Kiel aus bezog er im Sommersemester 1875 die Universität München, wo er bis 1880, also zehn Semester, inskribirt war. Jedoch war er die beiden letzten Wintersemester vom Belegen von Vorlesungen dispensirt. Er hörte bei Brunn, Saniere, Meßmer, Bursicm, Prandl, Helm, Riehl und Julius. Bei Brunn acht, bei Meßmer drei Semester; und zwar machte er durchaus die Schule des klassischen Archäologen durch. Am vierundzwanzigsten Januar 1880 wurde er auf Grund seiner Dissertation über „Griechische Flügelwssen" zum Doktor promovirt. Brunn und Bursian berichteten sehr günstig über die Arbeit, die später auch im Druck erschien. Es ist eine treffliche, durchaus archäologisch wissenschaftliche Arbeit, in der sich Langbehn in den Bahnen seines Lehrers
Brunn bewegt. Später führte er den Doktortitel nicht. Ich habe über seine Dissertation von ihm nie Etwas gehört. Erst später erfuhr ich durch Zufall von ihr. Wohl aber erinnere ich mich, daß er es als eine „Dummheit"
bezeichnete, die er damit begangen habe, daß er promovirte.
In München wohnte er die längste Zeit bei einer Frau Wedekind und zog mit ihr von der Unteren Gartenstraße Nr. 10 in eine Wohnung in gleicher Straße Nr. 63 um. Daß er ein flotter Student war, ergiebt sich daraus, daß er 1880 mit dreißig Mark wegen Sachbeschädigung polizeilich bestraft wurde.
Der münchener Kreis, in dem Langbehn 1875/76 lebte, bestand in seinem Kern aus schleswig-holsteinischen Medizinern, die freilich meist jünger waren als der schließlich im zwanzigsten Semester stehende Langbehn. Eine gewisse Führung in dem zu freiem Verkehr sich zusammenfindenden Kreis junger Männer hatte Dr. Strenge, jetzt Sanitätrath in Neumünster in Holstein. Neben ihm trat der Holsteiner Dr. Rauert, der Preuße Dr. Harttung, der Rheinländer Dr. Leibl hervor. Auch Schriftsteller, wie Cajus Möller und dessen Vetter Konrad Möller, Karl Starkajan und Andere, gehörten dem Kreis an. Durch
372 - Die Zukunft.
Leibl wurden ihm Künstler zugeführt, darunter dessen Bruder, der Maler Leibl, der mehrere „Charakterköpfe" des Kreises malte. So Rauert und auch Langbehn, dessen Bild ich 1887 sah. Er brachte es in meine Wohnung, um es mir zu zeigen. Erinnere ich mich recht, so war es halbe Figur, etwa achtzig Centimeter hoch, eine ausgezeichnete Arbeit, an der Langbehn sehr hing. Trotzdem war er damals geneigt, sie zu verkaufen. Ich habe mit ihm und dem Kunstfreund Kommerzienrath Zschille über den Preis verhandelt. Aber damals war Leibl noch nicht „verkäuflich". Das Bild soll später in den Besitz des Malers Momme Nissen gekommen sein. Von Malern verkehrten noch in dem Kreise Sperl und Haider, wohl auch Hans Thoma, der noch in späterer Zeit Beziehungen zu Langbehn hatte. In Brunns Vorlesungen lernte er den Maler Vorländer, jetzt Professor in Münster, kennen, mit dem ihn enge Freundschaft verband. Die Verehrung für den Maler Leibl war nachhaltig. Aber auch mit ihm blieb er, wie mir Professor Sperl schreibt, nicht in dauernder Verbindung.
In diese Zeit fällt auch seine Reise nach Italien und seine Thätigkeit in einer Hamburger Privatgalerie, über die ich Nachrichten nur aus Langbehns eigenem Munde habe. Doch war er ja nie mittheilsam und habe ich Manches vergessen Im Juli 1883 wohnte er in Hamburg, Valentinakamp 77 III. Auch in Frankfurt am Main und Lübeck hielt er sich auf. Er stand dort, wie mir scheint, in geselligen Beziehungen nur zu dem Direktor des Hamburger
Gewerbeschulwesens, Jessen, und durch Diesen mit Dr. Peter Jessen, dem jetzigen Bibliothekdirektor des berliner Kunstgewerbemuseums.
Auch zu Theodor Mommsen scheint Langbehn in einem Verhältniß gestanden zu haben. Ich höre, er sei eine Weile sein Assistent gewesen, was freilich mir nicht recht glaubhaft scheint. Doch wohnte er im Frühjahr 1885 in Charlottenburg. Trotz Allem, was Langbehn über Mommsen geschrieben hat, stand er aber noch um 1900 mit ihm in brieflichen Beziehungen. Mommsens Korrespondenz ist bekanntlich für lange Zeit nicht zugänglich, also von dieser Seite Auskunft nicht zu erlangen.
In der Folgezeit hat Langbehn auch in Frankfurt an der Oder im Hause des Dr. Harttung als Gast gewohnt, ohne jedoch sich mit dessen junger Frau und der zu lebhaft praktischem Eingreifen gestimmten Lebensart seines Freundes stellen zu können. Der Bruder Harttungs, der bekannte breslauer Mediziner Professor Willy Harttung, und der öfter von Berlin herüberkommende junge Wildenbruch waren in dem Kreise die leitenden Köpfe. Mit Wildenbruch kam Langbehn in heftigen Streit. Doch erinnerte sich in späteren Jahren der Dichter, den ich danach fragte, der Angelegenheit, selbst der Person Langbehns nicht mehr. Bald setzte Dieser seinen Wanderstab weiter.
Nach Dresden ist er im März 1885 gekommen. Bald darauf besuchte er mich, eingeführt durch einen Brief des Dr. Peter Jessen. Daß er außer mit
373 - Der Rembrandtdeutsche.
mir, dem Musiker Reinhold Becker und später mit Woldemar von Seidlitz mit Anderen verkehrt habe, glaube ich nicht; wenigstens hat er mir nie davon erzählt.
Gewohnt hat Langbehn erst im Vorort Gruna, später, um 1891, Seidnitzerplatz 1 III. Dort hat ihn unter Anderen Peter Gast besucht.
Bei Becker suchte Langbehn, der selbst unmusikalisch war, Aufklärung über das Wesen des Volksliedes. Er saß oft bei dem feinsinnigen, liebenswürdigen Künstler, um dessen Spie! zuzuhören und mit ihm seine Ansichten über Musik durchzusprechen.
Meine Beziehungen zu Langbehn endeten im Frühjahr 1887. Im Hause meiner Eltern verkehrte er noch länger, folgte ihnen als Gast in ihren Sommeraufenthalt Naundorf bei Schmiedeberg ins Erzgebirge. Meine Mutter sorgte für seine Leibwäsche und half ihm sonst, so weit als Das ohne Kränkung seines Stolzes möglich war.
In die letzte Zeit meiner Beziehungen zu Langbehn fällt der Beginn des Verkehrs mit Seidlitz, der 1885 nach Dresden als Rath in die Generaldirektion der Museen berufen worden war. Ich hatte schon vorher vielfach Langbehn gedrängt, eine Anstellung zu suchen; eine solche zu erlangen, war der Zweck seiner persönlichen Anfrage bei Seidlitz, zu der ich ihn wiederholt rieth. Aehnliche Versuche, ihm ein sicheres Brot zu schaffen, haben mehrere seiner Freunde gemacht. So der Maler Vorländer, der ihn für die durch Lückes Berufung nach Dresden freigewordene Professur für Kunstgeschichte an der Düsseldorfer Akademie vorschlug. Seidlitz besuchte er öfter, verkehrte auch in dessen Haus. Durch Seidlitz scheint Langbehn auch in Beziehungen zum Kunsthistoriker Wilhelm Bode gekommen zu sein. Man erzählte mir, daß Seidlitz und Bode einen Einfluß auf die Herausgabe des Rembrandt-Buches ausgeübt hätten; nicht auf den Inhalt, wohl aber auf das Verlagstechnische.
Wer Langbehn in jener Zeit kennen gelernt hat, mußte in ihm den geistig angestrengt arbeitenden Mann erkennen, der sich mit großen Gedanken trug. Daß er dabei nicht „Gesellschaftmensch" war, konnte nicht auffallen. Er war nahezu ein Vierziger, ohne daß es ihm bisher gelungen war, sich eine Stellung in der Welt zu erringen, weder nach der sozialen Seite noch durch einen wissenschaftlichen oder sonstigen Erfolg. Seine Verhältnisse waren gedrückt. Man konnte es sehr gut verstehen, daß er die Gesellschaft Derer mied, die die neuen Bekannten zunächst auf die Frage ansehen, ob er eine „Situation" habe. Langbehn mußte, bei seinem starken Selbstgefühl, das Zusammentreffen mit Menschen scheuen, die durch eine harmlose Frage ihm lästig werden konnten. Aber er war nicht menschenscheu. Er ging der Begegnung mit Freunden nicht grundsätzlich aus dem Wege. Am Liebsten scheint ihm zu jener Zeit der Umgang mit Leuten gewesen zu sein, deren Bildungsgrad ein Nachforschen nach seinem geistigen Entwickelungweg ausschloß. Ich merkte Das sehr
374 - Die Zukunft.
wohl und vermied grundsätzlich Alles, was wie ein Ausfragen erscheinen konnte; ich bin überzeugt, daß sich auch Seidlitz so verhielt. Thatsächlich habe ich auch, so lange ich Langbehn unter den Lebenden wähnte, alle Nachforschungen unterlassen, so lebhaft auch die Erinnerung an ihn mich dauernd beschäftigte. Wußte ich doch von seinen Verhältnissen, obgleich ich selbst mich immer, meiner Natur gemäß, dem Freunde rücksichtlos offenbarte, bis vor einem Jahr herzlich wenig über sein Leben. Ein klares Vertrauen war eben von ihm nicht zu erringen. Wohl empfand er als Pflicht des Freundes, dem Freunde zu helfen. Er selbst scheint sich Anderen, der Hilfe Bedürftigen, gegenüber nicht geschont zu haben. „Brich, brich, brich!" schrieb er an Vorländer, dem Verwandte nicht so unterstützten, wie Langbehn es für deren Pflicht hielt.
Seine äußere Lage war damals recht ungünstig. Die Zeiten in seinem Leben, in denen er reichlichere Einnahmen hatte, scheinen nur kurz gewesen zu sein. Sein Jahreseinkommen schätzte er selbst auf 550 Mark. Einiges verdiente er sich auch als Schriftsteller, und zwar meist durch Vermittelung der münchener Studienfreunde. Ich erinnere mich, daß er den Druckabzuz eines Aufsatzes überbrachte, der in einer westfälischen Zeitung erschienen war, wenn ich nicht irre: einer dortmunder. Andere, über norddeutsches Wesen und die Ziele einer künftigen Entwickelung Deutschlands, erschienen im „Hamburgischen Korrespondenten". Beide sind später in das Rembrandtbuch mit hineingearbeitet worden, das in der Zeit, wo sie geschrieben wurden, im Grundplan bereits
festgestanden haben dürfte. Langbehn gab sie sichtlich nur aus Noth an die Oeffentlichkeit, weil er damit die Wirkung seines Buches zu beeinträchtigen glaubte, von der er die größten und wie, sich später herausstellte, hellsichtigsten Hoffnungen hatte.
Aber selbst wenn ich von der Berechtigung seines Selbstgefühles die höchste Meinung hatte, konnte ich mich und konnte nach mir wohl auch Seidlitz sich nicht der Empfindung erwehren, daß dieses Gefühl sich in überstiegenen Formen äußere: in dem Wunsch, daß sich Einer, der sein Freund sein oder bleiben wolle, ihm unterordnen müsse. Nicht nur in dem Sinn, daß er Langbehns geistige Ueberlegenheit anerkenne, sondern vielmehr so weit, daß er jeden Widerspruch aufgebe. Von seinem Freunde, den Maler Vorländer, mit dem er lange Jahre in einem Verhältniß wechselseitigen Aushelfens mit ihren kleinen Geldmitteln lebte, verlangte er sogar, daß Dieser schriftlich Langbehns Superiorität anerkenne und sich völlig seiner geistigen Ueberlegenheit unterwerfe. Als Vorländer hierauf nicht einging, kam es zum Bruch. Schon vorher hatte Dieser den Eindruck, daß Langbehn einen solchen herbeizuführen wünsche.
Gegen Ende der achtziger Jahre, also kurz vor Erscheinen des Rembrandtbuches, hatte er von Vorländer eine Zeichnung erbeten mit dem Thema: „Wenn man mit dem Weltgeist allein ist, so ziemt es sich nicht, daß man die
375 - Der Rembrandtdeutsche.
Nase durch die Thür steckt, um nachzuspüren, was er treibt." Er brauche dieses Blatt. Vorländer zeichnete es mit der Feder, doch der „Weltgeist" erschien Langbehn nicht „affektlos" genug; sonst aber erklärte er die Zeichnung für „gut". Wer in seinem Sinne der Weltgeist war, ist wohl nicht mißzuverstehen.
Im Anfang 1890 erschien dann, mit dem bekannten Erfolge, das Buch „Rembrandt als Erzieher". Ueber die verlagstechnischen Fragen, in die Langbehn mit großer Entschiedenheit eingriff, hoffe ich später authentische Nachrichten geben zu können.
Mit dem Erscheinen und den wachsenden Auflagen seines Buches scheint für Langbehn eine neue Zeit der Bewegungfreiheit eingetreten zu sein. Hiermit beginnt auch das ununterbrochene Fortarbeiten an seinem in immer erneuten Auflagen erscheinenden Buch und seine Bemühung, ihm in die weitesten Kreise Eingang zu schaffen. Der literarische Lärm war gewaltig. Bald begann ein emsiges Herumrathen, wer der Verfasser sein könne.
Die wissenschaftliche Kritik stellte sich im Allgemeinen auf den Standpunkt der „Vornehmheit". Das heißt: sie erklärte, Langbehns Buch sei, ähnlich wie Nietzsches Schriften, eine „Modeerscheinung", an deren Erfolg man nur mit Bedauern den tiefen Geistesstand des deutschen Volkes erkennen könne. Es erschienen Brochuren, die das Buch theils bekämpfen, theils verulken wollten. Und es ist bezeichnend, daß auch sie viele Auflagen erlebten. So kenne ich eine siebente Auflage des Schriftchens „Est, est, est, Randbemerkungen eines niederdeutschen Bauern", eine zweite von „Der heimliche Kaiser oder der Dampfbau oder der wildgewordene Bliemchenkaffee". Andere traten mit Wärme für Langbehn ein, so namentlich Max Bewer, der mit dem Verstande des Herzens Menschen und Dinge beurtheilte. Die Großen, Kuno Fischer, Anton Springer und Andere, lehnten das Buch glattweg ab.
Aber das Erscheinen von neunundvierzig Auflagen und das immer wieder erneute Zurückgreifen auf den Gedankeninhalt des Buches hat doch bewiesen, daß in Langbehns Werk, trotz aller Eigenart und allen „Fehlern" in seiner Anlage, ein starker, dauernder Kern steckt, daß es als Weckruf zur Individualität für alle Zeiten in der Geschichte des deutschen Geisteslebens eine wichtige Rolle spielen wird.
Die Hoffnung der Freunde Langbehns, daß der Erfolg die Last von seiner Brust nehmen werde, war irrig. Nun setzte sein Kampf um die Anonymität ein und aus diesem heraus seine wachsende Vereinsamung.
Wer zuerst der Welt Langbehns Namen verrieth, weiß ich nicht. Nach einer Zeit des Herumrathens wurde es ziemlich allgemein klar, wer der Autor sei. Nur kannten nicht eben Viele den Mann selbst. Dieser wehrte sich, so weit es die Wahrheit zuließ, mit Ableugnungen. Als ich kurz nach dem Erscheinen des Buches in einer Besprechung andeutete, daß ich den Verfasser kenne, warnte
376 - Die Zuknnft.
er mich durch ein Eingesandt an die Redaktion, frühere Beziehungen zum Bruch seines Geheimnisses zu benutzen. Als in den Zeitungen die Nachricht erschien, der Autor heiße Langbein, ließ er, die falsche Schreibung des Namens benutzend, diese Nachricht dementiren.
Dagegen entwickelte sich unter der Deckadresse der leipziger Verlagsbuchhandlung oder postlagernd ein Briefwechsel mit seinen Verehrern, denen er aber nicht seinen Namen, nicht einmal seinen Wohnort nannte. Für seine alten Freunde verschwand er nun vollständig. Briefe, von denen er fürchtete, daß sie ihn verrathen könnten, forderte er zurück. Der Kampf um die Anonymität mehrte seine Vereinsamung. Er behielt seine Wohnung am Seidnitzerplstz. Aber er hielt sich nachts nicht dort auf. Wo er schlief, wußte Niemand. Er beschäftigte einen Schreiber, wechselte ihn aber oft, damit Keiner Einblick in sein Thun erlange. Seine Wirthin mußte an ihn adressirte Briefe abweisen. Er sei verzogen. Die Wirthin sorgte sich seiner Nervosität und Hypochondrie wegen. Ja, er wurde ihr unheimlich. Aller Verkehr früherer Bekannter mit ihm hörte auf. Selbst der mit Hirschfelds Verlagsanstalt trübte sich bald. Schon 1900 war die Firma gezwungen, amtliche Recherchen bei allerlei Behörden anstellen zu lassen, da er jeden Verkehr abgebrochen hatte, auch amtliche Briefe ihn nicht erreichten, seine Adresse nicht zu finden war. Noch einmal trat er 1890 hervor, als Nietzsche erkrankt war. Man kennt aus der Nietzscheliteratur sein eigenartiges Eingreifen in die Behandlung des Philosophen. Langbehn kannte Nietzsches Werke, hielt sich aber von einer Beeinflussung durch ihn fern, da er sich nicht als Schüler Nietzsches fühlte und nicht dafür gehalten werden wollte. Seine Berechtigung, in die Pflege des kranken Geistesgenossen einzugreifen, entnahm er aus seiner Erfahrung in diesen Dingen. War doch seine Mutter, wie mir berichtet wird, im Irrsinn gestorben. 1891 erschienen bei Glöß in Dresden seine „Vierzig Lieder von einem Deutschen", auf die er große Hoffnungen gesetzt hatte. Er übergab dem Verlag eine Gedenktafel, die die Thatsache festhalten sollte, daß die Gedichte in ihrer Offizin gedruckt worden seien. Die geringe Notiz, die die Welt von den Gedichten nahm, hat ihn tief verstimmt. Nicht minder, daß die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen angeblicher Unsittlichkeit der Verse eröffnete. Später wurde das Verfahren eingestellt. Obgleich sonst die Verbindungen zwischen uns abgeschnitten waren, ließ Langbehn mir einen Abzug des Buches zugehen.
Nun beginnt eine unaufgeklärte Zeit der Reisen. Die Nachricht, daß Langbehn hier oder da gesehen worden sei, daß er aber einer Ansprache ausgewichen sei, tauchte unter feinen Freunden vielfach auf. Aus späterer Zeit sind mir Andeutungen zugegangen, als wenn die Reisen mehr zu Wallfahrten geworden seien. Dabei scheinen sie in weite Fernen gerichtet gewesen zu sein. Eine Spur weist auf die spanisch-französische Grenze (Lourdes?), die andere
377 - Der Rembrandtdeutsche.
auf Jerusalem. Von dem Fortgang seiner geistigen Entwickelung werden vielleicht noch seine unter Deckadressen versandten Briefe an Verehrer zu erzählen haben. Der mystische Zug in seinem Wesen gewann unverkennbar immer stärkeren Einfluß auf sein Denken. Vor mir liegt einer dieser Briefe. „Ruhe ist die erste Geistespflicht", sagt er dort. „Der Mensch soll sich stets und überall in nächster Beziehung zum Weltgeist, dem Geist des Ganzen, fühlen". Und dieser Weltgeist hatte aus ihm gesprochen. Er zog sich zurück von der Welt, der er als Organ des Weltgeistes gedient hatte: dieser Gedankenweg wies auf die großen Mystiker des Mittelalters; er dürfte ihn zum Katholizismus hingelenkt haben. Es besteht kein Zweifel darüber, daß er in aller Form zum Katholizismus übergetreten ist. Das dürfte in den neunziger Jahren geschehen sein. Wäre er nicht Katholik gewesen, so hätte ihn der katholische Pfarrer von Fürstenfeldbruck nicht auf dem katholischen Kirchhof zu Puch begraben dürfen.
Ob Langbehn in irgendeiner Richtung auch später produktiv thätig war, weiß ich nicht. Er hat nach meinen Nachrichten stets „fleißig studirt". Daß es sich dabei lediglich um ein Aufnehmen gehandelt habe, ist schwer glaublich für Den, der seinen inneren Drang zum Aeußern des in ihm fertig Gewordenen kennen gelernt hat. Ich würde also keineswegs erstaunt sein, wenn stark mystisch gefärbte Arbeiten zum Vorschein kämen, in denen er seine in katholischem Sinn gewandelten Anschauungen niederlegte.
Im Juni 1900 lebte Langbehn in Würzburg, anscheinend in auskömmlichen Verhältnissen. Er bewohnte zwei schöne, große Zimmer und hielt ein drittes für einen zu erwartenden, jedoch nie eingetroffenen Freund frei. Der Wirthin machte er einen so unheimlichen Eindruck, daß sie sich um Rath und Hilfe an Verwandte wendete. Schon seine inständige Bitte, ihn nicht polizeilich anzumelden, machte sie stutzig. Andere Beobachtungen ließen sie zu der Ansicht kommen, daß sie nicht, wie sie anfangs glaubte, einen Verbrecher, wohl aber einen Irren beherberge. Er sah sich von Mördern verfolgt, von Teufeln bedroht Eine Reihe von Beobachtungen, die seine Hausgenossen an ihm machten, lassen ihre Furcht, einen Kranken zu beherbergen, leider nicht unbegründet erscheinen. Im Sommer lebte er in Lohr am Main, dort allgemein für einen Irrsinnigen von ausgesprochen katholisch religiöser Färbung, gehalten. Man wies scheu auf den Mann, der in einem weiten, orientalischen Beinkleid, mit stets aufgespanntem, den Blick Vorbeigehender abhaltenden Schirm auf der Straße erschien, vor jedem Madonnenbild im Gebet niedersank, den Rosenkranz nie aus den Händen kommen ließ. Man erfuhr von seinen Wirthsleuten, wie sonderbar er es zu Haus treibe, wie ängstlich er sich vor feindsäligen Angriffen schütze, selbst den harmlosesten gegenüber, wie eigentümlich seine (wie es scheint, ganz vegetarische) Ernährung war, welchen Werth er auf die Anderen bedeutunglos erscheinenden Dinge legte, die ihn im Haushalt um-
378 - Die Zukunft.
gaben. Den lorcher wie den Würzburger Wirthsleuten begann es zu grauen, so daß sie ihm kündigten. Ungern verließ er die Stadt mit ihren schönen Waldungen im Spessart. Man trieb den Scheuen weiter. Er zog nach Koblenz. Aber dort, wie sonst, habe ich keine Spur mehr von ihm auffinden können. Zuletzt wohnte er in einem kleinen Gasthof in München.
Meine Nachrichten über diese Tage Langbehns habe ich von einwandfreien Leuten, die freilich damals nicht wußten, wer der sonderbare Fremde sei, die auch nur sein Treiben zu beobachten Gelegenheit hatten, nicht aber ihm geistig näher traten. Aber sie berichten auch, daß er zu jener Zeit noch in brieflichem Verkehr mit hervorragenden Männern stand, und zwar nicht blos mit hohen katholischen Geistlichen, sondern, zum Beispiel, mit Theodor Mommsen. Dessen Briefwechsel ist jedoch für fünfzig Jahre gesperrt.
Der Direktor a. D. Roloff in Freiburg im Breisgau theilte in der münchener Zeitschrift „Hochland" mit, daß Langbehn in dem bayerischen Städtchen Rosenheim im Gasthof „König Otto" an Magenkrebs plötzlich gestorben und auf seinen Wunsch in Puch bei Fürstenfeldbruck vom dortigen Pfarrer Grastl am dritten Mai 1907 begraben worden sei. Auf einer Reise nach Tirol war er am zwanzigsten April nach Rosenheim gekommen, krank, begleitet von dem münchener Maler Momme Nissen. Dieser hielt ihn streng verborgen. Der Arzt wurde erst am dreißigsten April vormittags gerufen. Er fand Langbehn bereits als Leiche.
Auf dem Kirchhof zu Puch steht eine alte hohle Linde, in der einst eine Heilige, Edigna, gehaust haben soll Unter dieser Linde wollte Langbehn begraben sein. Ein einfaches Eisenkreuz bezeichnet das Grab, das die Zeichen trägt