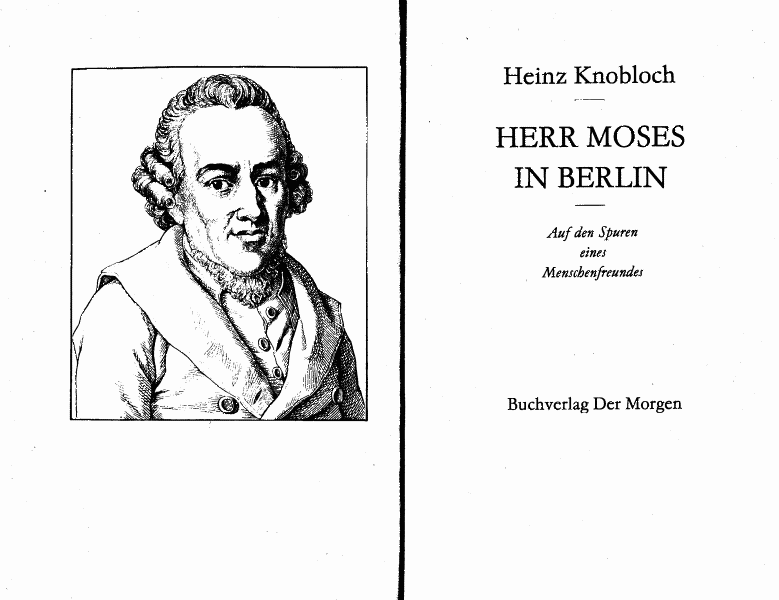
Auszug aus: "Herr Moses in Berlin"
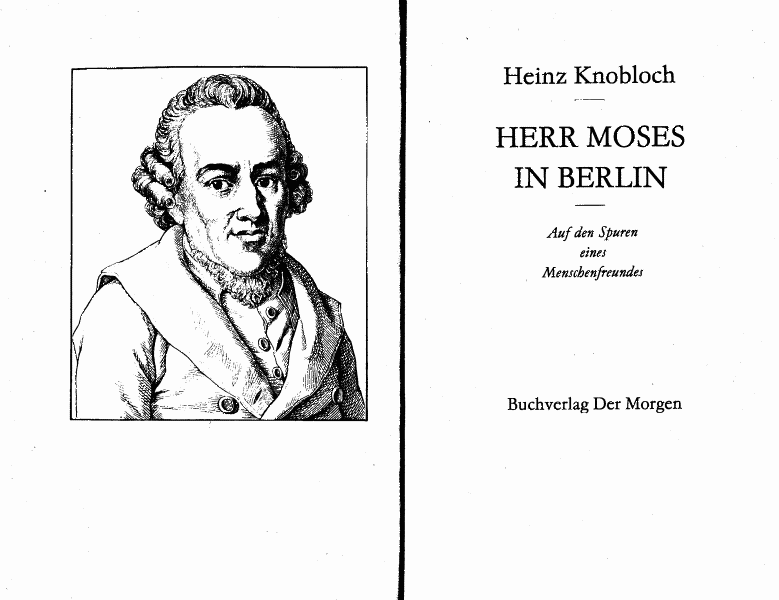
Eine Beschreibung des Lebens von Moses Mendelssohn und der Situation der Juden in Berlin und Preußen zur Zeit Friedrich des Großen von Heinz Knobloch
Auf den Spuren eines Menschenfreundes
Buchverlag Der Morgen , Berlin 1979
(Hinweis: Die Seitenzahlen befinden sich am Kopf jeder Seite, zusammen mit einigen Worten als Hinweis auf den Inhalt. Die jeweilige Seite beginnt mit der Seitenzahl in eckigen Klammern. - Bisheriger Inhalt: die Seiten 5, 26, 27, 98 - 165)
[Auszug]
[310] Der 200. Geburtsag
15,- Reichsmark, Halbfranz kostet 15,- statt 18,75, und die Luxusausgabe, auf holländischem Bütten, wird 30, Reichsmark pro Band kosten.
Als sich 1936 der Todestag Mendelssohns zum 150. Male jährt, erinnert der Rabbiner Dr. Posner in Wien ' in einem Zeitungsaufsatz an die Septemberwoche 1929 in Dessau und Berlin, an die Feiern, an die Ausstellungen und an die Jubiläumsausgabe, von der sieben Bände herausgekommen sind, an deren Fortsetzung wohl nun aber gezweifelt werden muss». Das ist zurückhaltend formuliert.
Erst 1971 wird diese Jubiläumsausgabe erneut angefangen mit einem Wiederabdruck der einst erschienenen Bände und ihrer Fortsetzung.
Die Staatsbibliothek in Berlin eröffnete die größte jemals gezeigte jüdische Spezialausstellung verschob sie aber um eine Woche, um der Geburtsstadt Dessau den Vortritt zu lassen.
In der Dessauer Ausstellung war als Leihgabe des Märkischen Museums Berlin «Ein Ring mit dem Bilde Moses Mendelssohns» ausgestellt. Wo mag er geblieben sein? Heute ist er nicht auffindbar.
Überall in Deutschland fanden Feiern zu Ehren Mendelssohns statt. Am Grab legte der Magistrat von Groß Berlin einen Kranz nieder. «Ihrem großen Mitbürger Moses Mendelssohn. Die Stadt Berlin» stand auf der Schleife. Sechs Jahre später, zum 150. Todestag, war diese Ehrung undenkbar gemacht worden.
In der Singakademie fand am Sonntagmorgen des 8. September 1929 eine Feier statt. In Dessau hatte es ein Festkonzert gegeben. Gespielt wurde, kein anderer kam in Frage, Felix Mendelssohn Bartholdy:
Konzert-Ouvertüre Nr. 2 zu den «Hebriden» op. 26
Arnold Zweig. Prolog [311]
Konzert für Violine mit Orchester op. 64
Musik zum «Sommernachtstraum» op. 61
Die «Vossische Zeitung» hatte einen ihrer besten Feuilletonisten nach Dessau entsandt, Arthur Eloesser. Er schrieb: «Es war viel und war auch schön, und wenn man den katholischen Priester vor der Bundeslade in der Synagoge mitaufstehen sah, spürte man, dass dieser kleine Moische vor 190 Jahren sich doch nicht ganz umsonst mit Schweinen und Kühen am Berliner Stadttor verzollen ließ.»
In Dessau wurde die Festwoche am 6. September 1929 von einer Festaufführung im Friedrich-Theater gekrönt. Man spielte «Nathan der Weise».
Zwei Pressestimmen: Die Aufführung wurde «von einem klugen und warmherzigen, wenn auch etwas gewollt originellen Prolog von Arnold Zweig eingeleitet», «der sich durch lyrische Schönheiten und dichterischen Schwung auszeichnete». Unserem Leser wird empfohlen, den Prolog laut zu lesen.,
Mendelssohn-Prolog
Von Arnold Zweig (1887-1968)
In Sachen des verstorbenen Herrn Moses Mendelssohn
Lebte er heute, spräche man auch nicht in geschwollenem Ton.
Von allerlei Leuten säh man ihn heftig verkleinert, mancher schriebe viel Blödes über ihn.
Und in Bayern oder Frankfurt hieße es wieder: Natürlich, Berlin.
Auch seinem Freund G. E. Lessing käme man öfter quer,
[312] Ohne Pose
Seinen Gegnern kommt er noch heute jüdisch vor, Lessing, er!
Nein, mein Herr, Herr Lessing ist ein waschechter, Arier, ein glaubender Christ,
Grade gewachsen, mit breitem Kinn, helläugig, ein Evangelischer, wie er selten ist,
Allerdings kein Pfaffe, aber ein Eiferer für das Auf stecken von möglichst vielen Kerzen,
Ein Leuchtturm mit einem glühenden deutschen Herzen.
Da steht er, lasst euch nicht weismachen, er habe gelebt:
Er wird erst leben! Vor uns ragt er, an den Horizont wie der Morgenstern geklebt,
Und neben ihm, sitzend in einem Stuhle, den Kopf in die Hand gestützt,
Ohne Pose, wie ein Mann, der viel denkt, eben sitzt,
Dieser kleine rundrückige Jude, aus Dessau, beim Eintritt in Berlin wie ein Schöps verzollt
Mit gut ausgebildetem Hirn und mit Blute, das mutig rollt.
Von seinem großdunkelnden Auge strömt die Kraft seiner reinen Seele aus,
Und ein aufrechter Sinn ward groß im verkümmerten Körperhaus.
Er liebte das Schöne. Ewigen Einsichten lebte er zugewandt.
Sein Vollbringen war zeitlich - aber herrlich bleibt immer ein strahlender Menschenverstand.
Und wo ein Mann unbedingt dem Erhabenen gegen übersteht.
Da offenbart sich aufleuchtend des Menschen demütige Majestät.
Er war nicht schön, um so mächtiger strahlte aus ihm der Geist,
So sehen wir ihn [313]
Was er gedacht hat, wird besser heute und tiefer gedacht zumeist;
Aber wie er dachte, inbrünstig einsetzend seine Lebenskraft -
Aus dem einen Mann Moses speiste man heute eine ganze Lehr- und Studentenschaft;
Denn ein Buchhalter blieb er, und nährte sich so, und was ersann,
Blieb frei von Marktwert und Brotbedarf - da stand ein Mann.
Hinter ihm ging groß auf ein Gestirn, Immanuel Kant,
Aber Mendelssohn war auch nötig, für den breiten Menschenverstand,
Und wenn im Lehrhaus der strenge Gedanke allein beharrt,
Immer braucht es auch Denker für alle, fürs Leben, für die ewige Gegenwart.
So, wie er im Volke von unten, aus den fruchtbaren Schichten entwuchs,
Zeitlebens vergaß er nicht des schwer auf den Armen lastenden Drucks,
Er wurde kein Königslober, er rezensierte ihn,
Und das konnte man damals wie heut in Berlin.
So sehen wir ihn neben Lessingen, eine verdunkelte neben der strahlenderen Kraft,
Aber eine lebendige Stimme im Herzen deutscher Judenschaft.
Und über Europa, Amerika, wohin immer Juden verstreut,
Alle gedenken sie Mendelssohns heut,
Und nach Dessau blickend nicken sie dankbar: Er war eine Macht,
Er hat den Juden deutsche Sprache, Bildung, Freiheit, Europa gebracht.
[314] Der liebeswerte Moses
In ihre harte Enge, spießige Finsternis -trug er europäisches Licht,
Moses, das vergessen die Ihnen nicht.
Manchmal standen Sie. streitend, aber Sie keiften nicht,
Ohne starre Maske zeigten Sie stets ein nobles Gesicht.
Adel des Herzens und der schlichteste Ton,
Liebenswert sind Sie noch heute, Moses Mendelssohn.
Ihr Lebtag haben Sie sich geplagt und zerdacht,
Und wir haben manchmal Ihre bescheidene Aufklärung ausgelacht;
Aber heute, zehn Jahre nach einem gründlich ausgekosteten Krieg,
Seufzen wir manchmal nach ihr und nach Ihnen Sie waren ein Sieg.
Bei uns Gebrodel, Wirrnis und Gefahr,
Bei euch Verstand und Einsicht, gütig und klar,
Bei uns Tiefe, Aufruhr und Übergang,
Bei euch Lessings Festigkeit, Schillers Glühen und Klopstocks und Goethes Gesang,
Bei uns ein unablässiges Beginnen und Mühn,
Bei euch Ansatz zu Blüte und unsägliches Blühn:
Bei uns schmerzhaftes Gestalten, tragische Pflicht,
Bei euch: Vorhang auf! Nathan der Weise spricht!
Damit öffnete sich auch unsere Bühne hier für Lessings Schauspiel.
«... da habe ich diese vergangene Nacht einen närrischen Einfall gehabt», schreibt Lessing im August 1778 an seinen Bruder Karl. «Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Schauspiel entworfen, dessen Inhalt eine Art von Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigkeiten hat, die ich mir damals wohl nicht träumen ließ. WC
Sichtbare Absicht [315]
Du und Moses es für gut finden, so will ich das Ding auf Subskription drucken lassen j..» Das Braunschweiger Ministerium hatte dem Bibliothekar durch Zensurpflicht neuerdings so gut wie verboten, weiterhin polemische Schriften gegen die orthodoxen' Theologen zu publizieren. Er meint, sein neues Schauspiel werde «gewiss den Theologen einen ärgern Possen» spielen als weitere zehn Aufsätze.
Im Oktober schreibt er, dass es kein satirisches Stück wird, sondern «ein so rührendes», wie er es nur jemals gemacht hat. In den Entwürfen zu einer Vorrede heißt es:
«Wenn man sagen wird, dieses Stück lehre, dass es nicht erst von gestern her unter allerlei Volke Leute gegeben, die sich über alle geoffenbarte Religion hinweggesetzt hätten und doch gute Leute gewesen wären; wenn man hinzufügen wird, dass ganz sichtbar meine Absicht dahingegangen sei, dergleichen Leute in einem weniger abscheulichen Lichte vorzustellen, als in welchem der christliche Pöbel sie gemeiniglich erblickt: so werde ich nicht viel dagegen einzuwenden haben.»
Am Ende sagt er: «Noch kenne ich keinen Ort in Deutschland, wo dieses Stück schon jetzt aufgeführt werden könnte. Aber Heil und Glück dem, wo es zuerst aufgeführt wird.» Die Uraufführung erlebt er nicht mehr. Sie findet erst zwei Jahre nach seinem Tode statt, am 14. April 1783, aber wo? In Berlin, mitten im sklavischsten Lande, )wo der Dichter es am allerwenigsten vermutet hätte; aber, wir wissen es, die Dichter lassen sich nicht alles träumen.
Schwerwiegender als jene Uraufführung war eine andere. Die erste Vorstellung des «Nathan», mit der sich im September 1945 das Deutsche Theater in Berlin nach der Überwindung des Faschismus wieder öffnete, kommt einer Uraufführung gleich. Das Publikum kennt
[316] Als alles in Scherben lag
nämlich das Stück nicht mehr aus der Erinnerung. Es «wurde in der großen Glanzzeit des bürgerlichen Kunsttheaters nie gespielt. Es galt allgemein als schwach, als zu didaktisch und kathedermäßig angelegt, mithin als unspielbar.» Inge von Wangenheim, deren «Hamburgische Elegie> von ihrer lebenslangen Beziehung zu Lessing erzählt, hat diesen ersten Nachkriegswinter in Berlin miterlebt. jetzt kommen die Menschen auf schmalen Fußpfaden über die Trümmerberge ihrer Stadt von weither, «um für ein paar Stunden nur einmal wenigstens in all der Drangsal des Unbewältigten ... die Stimme des Humanismus zu vernehmen ..., zur Wiederbelebung ihres Gewissens».
«Nathan» ist kein Vorkriegsstück, aber danach spielt man ihn wieder gern.
Ist denn, wie vor allem früher behauptet, Moses Mendelssohn Urbild und Verkörperung des Nathan, beziehungsweise umgekehrt, ist Nathan der auf die Bühne gestellte Mendelssohn?
Das Schauspiel trägt keine Widmung an den Freund in Berlin. Weder Lessing noch Moses haben sich dazu geäußert, dass Moses der Nathan sei. Schon aus religiösen Gründen war das nicht möglich, denn Lessing lehnte alle Offenbarungsreligionen - darunter die jüdische - wegen ihres Ausschließlichkeitsanspruches ab.
Alle, die sagen, Lessig ist selber sein Nathan, haben recht. Und wer kann, der komme mit auf den Schleichpfad und klettere mit durchs Gebüsch und über kompostiertes Laub; auf Gutdünken gehen wir, immer der Nase nach durch ein Stück Tiergarten zwischen Brandenburger Tor und dem Potsdamer Platz, dem ehemaligen. Diese Ecke des Tiergartens ist nicht der gut gepflegte Parkteil mit seinen einsamen Spazierwegen, die ein Goethedenkmal berühren und eine Löwengruppe aus Kaisers Zeiten, sondern er ist eine Wildnis, dem Pu-
Wanderung zu Lessing [317]
blikum durch Sperrschilder verwehrt, aber doch nicht unsereinem, der bei Kisch gelernt hat, dann das Gegenteil zu tun, jedenfalls manchmal. Und Sperrschild, das geht ja noch.
Es ist ein früher Septembermorgen, ein Freitag 1977, ganz still. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ein Wetter, das Urlauber in der Nachsaison darin bestärkt, gut beraten zu sein. Solches Wetter macht auch diesen Weg tröstlicher. Der Tiergarten, das muss dem unkundigen Leser gesagt werden, gehört nämlich zu Westberlin.
Der mit Herrn Moses beschäftigte Mensch hat dorthin eine Studienreise bekommen. Das sind ein paar Minuten Fahrt mit der Stadtbahn, dann ein Spaziergang. Im Grunde ist es ein Fußweg, denn man braucht dazu gar keine Bahn. Es ist eine Weltreise.
Im Mendelssohn-Archiv, das sich mit der umfangreichen, von Herrn Moses in Berlin gezeugten Familie beschäftigt und vor allem mit seinem Enkel, dem genialen Musiker, den die Nazis als Juden behandelten, obgleich er ein getaufter Christ war; es wird der Name gewesen sein, Felix hätte nicht nur sich taufen, sondern sich umtaufen lassen müssen; in diesem Mendelssohn-Archiv also stellt sich beim Lesen alter und neuer Zeitungsausschnitte heraus, dass es im Berliner Tiergarten einst ein Lessingdenkmal gegeben hat. Mit einem Bildnis Moses Mendelssohns am Sockel.
Das muss schon ein sehr papierner Mensch sein, der da das Archivmaterial nicht liegen lässt und loszieht und sucht wann, wenn nicht jetzt, solange das Visum reicht ob noch eine Spur vorhanden ist von Lessings Denkmals Erdentagen. Im Tiergarten! Ausgerechnet dort in dieser chancenlosen Gegend. Wer es nicht miterlebt hat, war vielleicht im Kino dabei und hat alles gesehen. Erst die übermütige Parade quer durch den Tiergarten an Hitlers 50. Geburtstag, zwei Kesselpauker zu
[318] Im Urwald von Berlin
Pferd und so, und dann die anderen Filme. Mit Panzern, Artillerie und viel Beethoven querfeldein durch den Tiergarten. Hitlers Reichskanzlei und das Reichstagsgebäude in Sichtweite. Endlich. Und hier, auf diesen letzten hundert Metern des zweiten Weltkrieges soll ein Marmordenkmal stehengeblieben sein?
Laut vergangenem Stadtplan steht das Lessingdenkmal an der Lennéstraße. Die ist nicht mehr da. Die Häuser Lennéstraße 6/7, denen gegenüber das Denkmal errichtet wurde, sind mitsamt der ganzen Straße vom Erdboden verschwunden. Restlos.
Wer nun von der anderen Richtung her durch den Wald kommt, quer durch diesen Tiergarten, der ein unübersichtlicher Urwald ist in diesem entlegensten Teil, der denkt an mancherlei und nicht ausschließlich an Lessing. Denn auf einmal steht der Mensch vor seiner Grenze. Es ist seine Grenze. In mehrfacher Hinsicht. Als seine Staatsgrenze ist sie weiß und glatt und zweimal so hoch wie er. Noch nie hat er sie so nah gesehen. So also sieht sie aus.
Eine helle Mauer, nur durch einen betonierten Pfad vom Gebüsch abgesetzt. Das ist die Scheidewand, die sehr hart und säuberlich zwei Gesellschaftsordnungen trennt, eine elementare Teilung. Kein Schnitt mehr nach sechzehn Jahren. Operationsnarbe. Manchmal, bei Wetteränderungen, spürt man sie.
Wer sich das bloß ansieht, kann denken, es sei schon immer so gewesen, denn es ist alles sehr sauber und glatt; und wer zum erstenmal hierher kommt und sich vor diese weiße Mauer stellt, über die er nicht blicken kann, weil sie zu hoch ragt, der muss eigentlich neugierig werden auf das, was sie verbirgt, oder darauf, was sich hinter ihr offenbart.
Selbstverständlich sind an einigen spektakulären Punkten dieser Grenze auf der Westseite Plattformen
Immer an der Wand entlang [319]
hochgezogen worden. Für Touristen zum Hinüberblicken; höchstens das, aber nicht zur Einsicht. Nein, nur an solcher Stelle unten ist sie möglich. Die Vielzahl der Bäume und Sträucher bildet ebenfalls eine Mauer und versperrt den Blick; nur etwas individueller, auf gewohnte Art und so, dass die Undurchdringlichkeit naturgegeben wirkt. Dann hat man sich ihr anzupassen, es ist nun mal so, wie es immer war. Damit ist den Menschen mitgeteilt, dass es immer Kriege geben wird und Ausbeutung. Die Steinwand hingegen sagt ehrlich, dass sie nicht bleiben will. Eines Tages wird noch ein Stück von ihr mit einem Täfelchen zu besichtigen sein wie der Rest der Berliner Stadtmauer aus dem Mittelalter. Dann wird kein Krieg mehr sein können, keine Ausbeutung. Dann leben Menschen.
Wie gesagt, nur vor diesen beiden Mauern wird alles bis in die Tiefe durchschaubar. Dann geht der Mensch weiter in der Richtung, wo Lessings Denkmal vermutet werden kann. Immer an der Wand, an der Wand entlang. Wäre ihm danach zumute, könnte er jetzt seine eigene Staatsgrenze berühren. Er hat sie mitfinanziert in nicht geringem Maße. Es geht tatsächlich eine Autobahn rund um die Stadt. Vielleicht sind das gerade hier seine Quadratzentimeter, wie seine Handfläche so groß. Er kann die Hand auflegen, aber er tut's nicht. Er kann, aber er will nicht. Das gibt es zuweilen im Leben. Wenn der Mensch etwas tun darf, dann will er es gar nicht mehr, denn allein die Tatsache, dass er könnte, wenn er möchte, genügt ihm. So ist es auch mit anderen Dingen.
Und so taucht nach weiteren Schritten auf der archäologisch noch erfassbaren Lennéstraße zwischen Bäumen und Büschen das Lessingdenkmal auf. Als Lessing sein Bild sah, das Graff gemalt hatte, soll er ausgerufen haben: «ja, sehe ich denn so verteufelt freundlich aus!»
Der Bildhauer Otto Lessing, ein Urgroßneffe, hat
[320] Kritik auch hier im Rücken
diese Marmorstatue nach dem Leipziger Porträt von Graff geschaffen. Aus strahlendem Carraramarmor, der nur etwas nachgedunkelt ist seit dem 14. Oktober 1890, dem Tage der Einweihung. Da war die Lennestraße voller Jubelgäste.
Ach, du lieber Lessing.
Das sieht hier schlimm aus, jedoch nicht so übel wie erwartet. Unbeschädigt wie sein Werk ist Lessing durch den Krieg gekommen. Drei Meter hoch als Statue auf drei Meter hohem Sockel. Ob man ihn während des Bombenkrieges vorsorglich umkleidet hat wie das Reiterstandbild seines Zeitgefährten Eff Zwei Unter den Linden? Dort fehlt am Sockel unter den vielen Köpfen und Brustbildern ringsherum verständlicherweise das Antlitz Mendelssohns, während Lessing immerhin unter dem Pferdeschwanz einen Platz gefunden hat, gemeinsam mit Kant. Und warum fehlt unter den vielen Generalen und Feldmarschällen der Mann, der dem König den Krieg gewann, der Generalfeldmarschall Ephraim?
Unbeschossen, den Mantel offen, steht Lessing so da, wie er dastehen würde. Die rechte Hand auf die Hüfte gestützt, die linke herabhängend mit einem Buch, den Finger zwischen zwei Seiten, als ob er jetzt nicht weiterlesen kann, angesichts der Mauer vor seiner Nase. Er hat aber einen viel weiteren Blick als jener, der, sich unter sein Denkmal stellt. (Den Satz werden die Kritiker benutzen.) Sehe ich denn so verteufelt freundlich aus? So freundlich verteufelt.
Bloß keine zusätzlichen Allegorien über den ausgesperrten, in die Hauptstadt der DDR schauenden Lessing. Das Denkmal selber bietet genug. Vor dem Sockel huldigt der bronzene Genius der Humanität mit erhobener Opferschale, während an der Rückseite des Sockels der Genius der Kritik die Zähne bleckt un d eine Geißel schwingt, die des Spottes und der Satire, ei ja, und mit
Kehrseite des Medaillons [321]
der anderen Hand greift er ein schlaffes Löwenfell. Zur Tarnung, zur Abschreckung oder dem toten Löwen abgezogen, wer weiß. Niemand ist vor seinem Denkmal glücklich zu preisen. Und nicht jedes Denkmal hält so rein.
Dieser geschweifte Sockel wurde in friedlicheren Zeiten durch ein geschwungenes Rokokogitter beschirmt. Wohin mag es zerschmolzen worden sein? Die vier großen Bronzemedaillons am Sockel sind herausgerissen, irgendwann, daher fehlt vorn Lessings Name. Bedauerlicher, dass die drei Porträts dahin sind: Ewald von Kleist, Nicolai, er war hinten beim Genius der Kritik befestigt, und Moses Mendelssohn. Es gibt keine Abbildung der Medaillons. Bei einer Denkmalseinweihung fotografieren alle den Redner. Niemand denkt daran, was vielleicht mit dem Denkmal passieren wird. Und falls jemand darunter ist, der schon Denkmäler kommen sah und gehen, bildlich gesprochen, der hält aus Erfahrung die Statuen der Dichter für langlebiger. Selbstredend spricht keiner bei einer solchen Feier über eine ungewisse Zukunft.
Es ist kaum anzunehmen, dass Hitlers Anhängern das Bildnis Mendelssohns an Lessings Sockel entgangen ist. Andererseits, so kulturbeflissen waren die nicht. Lessing war, von seinem Irrtum «Nathan der Weise» abgesehen, nicht ganz zu vermeiden und daher schwerlich abzuschaffen. Es gelang ihnen, das Berliner Lessing-Museum im Nicolaihaus in der Brüderstraße schon 1936 zu schließen. Nicht mit Krawall und Feuer, sondern auf still-wirksame Art. Das Museum war nicht rentabel; es schloss aus wirtschaftlicher Unzulänglichkeit. Lessings Denkmal im Tiergarten durfte stehenbleiben. Wer kam schon hierher, wenn der Bevölkerung ganz andere Ablenkungen geboten werden konnten. Wer wusste von dem Medaillon an der linken Seite, wenn nicht der
[322] Wie war Berlin früher?
lauernde Nachbar es verpetzte; Volkszorn, entartete Kunst, im Namen Gleichgesinnter, Kristallnacht, Bronzenacht, Bombennacht.
Misstrauen vor dieser Grünanlage. Warum fehlen alle vier Bronzetafeln? Buntmetalldiebe? Oder musste Lessing diese Teile seines Denkmals hergeben zum Umschmelzen in den Endsieg? - Wollt ihr den totalen Lessing?
Das Stufenpostament hat sich verschoben, wie das geschieht, wenn Erde, durch Bombentrichter erschreckt, sich schnell bewegen muss oder aber, wenn sie das langsam jahrzehntelang ungestört tut auf ihre Art, nach und nach. Die Granitstufen wollen mit Vorsicht betreten sein. Die Wasserbecken sind sturzbereit. Eventuelle Kranzniederlegungen nur mit Schutzhelm. Schlimme Zeichen einer zunehmenden Verwitterung. Vielleicht wird Lessing eines Tages abgetragen und an einer gefälligeren Örtlichkeit wieder ordentlich errichtet. Dann weiß bald niemand mehr von der finsteren Ecke am Rande des Tiergartens.
Der sich reich belohnt fühlende Mensch fotografiert zu Studienzwecken und weil das natürlich ein Bild ist, die leere Stelle, an der einst Mendelssohns Gesicht den Betrachter zum Nachdenken reizte; was Berlin einmal war.
Da kommt eine Erinnerung. Vor einem halben Jahr, in Oberägypten, eine fast ähnliche Aufnahme. Keine mit uralten Schriftzeichen bedeckte Tafel, sondern ein Block, von dem die Inschrift weggemeißelt worden ist. Grob und gründlich. jeder sollte sehen, dass da mal etwas geschrieben stand, aber er darf nicht mehr sagen, was. Darum geht es schließlich bei solcher Maßnahme. Sie muss erkennbar sein und verhüllen. So ist der Name der Königin Hatschepsut auf Anordnung ihres Nachfolgers überall entfernt worden. Die beiden Fotografien äh-
Zwischen zwei Bühnen [323]
neln sich. Es sieht aus', als seien schlimme Dinge mitgeteilt worden an diesem Denkmalssockel.
Die Frage von vorhin, ob nicht Lessing selber Nathan ist und der Sprecher seines Jahrhunderts, hat der Bildhauer Otto Lessing im Tiergarten längst beantwortet, indem er den Genius der Humanität sich auf eine Tafel stützen lässt, auf der sich noch heute die Worte entziffern lassen, die jeder einmal gehört oder gelesen haben soll. Nathans Worte. Schöne Worte. Nur es ist ein Unterschied, ob einer sie vom umgebogenen Reclam-Heft sich eintrichtert für die Deutschstunde oder ob er im Parkett mit Andacht dem ehrwürdigen Schauspieler lauscht. Es ist ein beträchtlicher Unterschied, ob Lessings Worte, aus dem Monolog gelöst, dem Leser hier irgendwo auf einer anderen Buchseite hingestellt werden oder ob der Aufnehmende sie jetzt angeboten bekommt, wo er vor diesem Denkmal steht.
Es ist einer der wenigen Morgen im Jahr, an dem die Luft frisch weht, rein und klar, weder zu kühl noch zu warm, und der hellblaue Himmel spiegelt dem Lebewesen vor, es sei unsterblich und ganz allein auf der Welt. So still ist sie. Nun liest sich der Mensch - mit dem Rücken zur Steinmauer angesichts der Baummauer - den Text der Tafel laut vor:
Wohlan!
Es eifre jeder seiner unbestochnen
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es strebe von euch jeder um die Wette,
Die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag
Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott,
Zu Hülf'! Und wenn sich dann der Steine Kräfte
Bei euern Kindes-Kindeskindern äußern:
[324] Rückschau
So lad' ich über tausend tausend Jahre,
Sie wiederum vor diesem Stuhl.
Da wird Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen
Als ich; und sprechen.
Es klingt doch anders als im Theater.
«Um gern in Berlin zu sein, muss man zuweilen reisen.»
Moses Mendelssohn
Zweimal, im August 1778 und im darauffolgenden Sommer, reiste Mendelssohn mit seiner Frau nach Strelitz, wo sie sich wahrscheinlich als Gast bei Meyer Katz erholten.
In dieser Stadt gab es «keine Geschäfte, keine Bücher, keine Zerstreuung», wie es in einem Brief heißt, einem langen Brief an den Freund Hennings. Es ist die Zeit der ersten ärgerlichen Rabbiner-Reaktionen auf die Bibelübersetzung. Moses hält Rückschau. In jüngeren Jahren, er nennt sie «bessere», war er weit davon entfernt, «jemals ein Bibelherausgeber oder -übersetzer zu werden». Er wollte sich darauf beschränken, «des Tages seidene Zeuge verfertigen zu lassen und in Nebenstunden der Philosophie einige Liebkosungen abzugewinnen». Verlor jedoch «die Fähigkeit zu meditieren und mit ihr anfangs den größten Teil meiner Zufriedenheit. Nach einiger Untersuchung fand ich, dass der Überrest meiner Kräfte noch hinreichen könne, meinen Kindern und vielleicht einem ansehnlichen Teil meiner Nation einen guten Dienst zu erzeigen, wenn ich ihnen eine bessere Übersetzung und Erklärung der heiligen Bücher in die Hände gäbe, als sie bisher gehabt.»
Wieder in Berlin, ging Mendelssohn einige Wochen morgens und abends zum «Gesundbrunnen» in der Nähe des Flüsschens Panke. Dr.Wilhelm Behm hatte das
Am Gesundbrunnen [325]
Gelände von Eff Zwei geschenkt bekommen, der auf dem Wedding einen Artillerieübungsplatz anlegen ließ.
Dr. Behm errichtete Gebäude, kultivierte einen Park und nannte seine Kuranstalt «Friedrichs-Gesundbrunnem, was dankbar klang und ungewollt höhnisch zugleich, denn wie wir wissen, trank der König hier kein Mineralwasser, sondern fuhr stets ins Ausland zur Kur. Die Quelle, um 1880 städtebaulich misshandelt, versiegte; nur der Name «Gesundbrunnen» ist übriggeblieben. Wer heute mehr darüber wissen will, muss alte Leute fragen, die dort Seifenpulver und Schokolade kauften.
Das Leben geht weiter. In England wird die erste eiserne Brücke der Welt gebaut. In Berlin stellt der von Hugenotten abstammende Franz Carl Achard den ersten Rübenzucker her. Der Astronom Herschel entdeckt den Planeten Uranus. Der Zeitungsleser kann zufrieden sein. In Österreich ist ein neuer Kaiser mit Reformen beschäftigt, die auch den Juden zugute kommen sollen. Schiller, 19- bis 20jährig, schreibt auf der Karlsschule an den «Räubern», Kant kritisiert die reine Vernunft.
Mendelssohn geht manchmal abends mit Frau und Kindern spazieren und wird von seinen Kindern gefragt: «Papa, was ruft uns jener Bursche dort nach? Warum werfen sie mit Steinen hinter uns her? Was haben wir ihnen getan?» Da nützt es nichts, ein berühmter Philosoph zu sein, da muss man den Kopf einziehen.
Moses gibt einen Augenzeugenbericht, als sei er Journalist in eigener Sache: «ja, lieber Papa, spricht ein anderes, sie verfolgen uns immer in den Straßen und schimpfen: Juden! Juden! Ist denn dieses so ein Schimpf bei den Leuten, ein Jude zu sein? - Ach!- ich schlage die Augen nieder und seufze mit mir selber: Menschen!
[326] Lernt Boxen im Londoner Ghetto
Menschen! wohin habt ihr es endlich kommen lassen?»
Das steht weder in der «Königlich Privilegierten Zeitung» noch in Nicolais «Beschreibung der königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam». Wir wollen nicht unfair sein. Es kann dort nicht gedruckt stehen. Es ist zu alltäglich.
Moses schreibt über solche Vorfälle in einem Brief an Maurus Winkopp (1759-1813), einen Benediktinermönch in Erfurt, den er persönlich kennen lernte, als Winkopp nach Berlin kam und ihn zu Hause oder in seinem Garten an der Oranienburger Landwehr aufsuchte.
Aus London kommen keine anderen Berichte. Im 18. Jahrhundert werden dort Juden auf der Straße geschubst, am Bart gezogen, angespuckt oder barbarisch verprügelt, ganz wie es dem Publikum beliebt, ohne dass Passanten oder Polizisten eingegriffen hätten.
Dann kam bessere Nachricht. Seit 1784 war ein junger Jude namens Mendoza, der den vielversprechenden Vornamen Daniel trug, ein beliebter Faustkämpfer geworden. Ihn spuckte lieber niemand mehr an. Mendoza boxte elegant und wissenschaftlich und so gut, dass er bald den Meistertitel im Schwergewicht errang. Es war der Anfang des modernen Boxsports, und die Kenner wissen, dass man noch keine Handschuhe trug und bis zum Umfallen kämpfte.
Daniel Mendoza gründete nun in London eine Boxschule und lehrte diese neue Kunst als Wissenschaft. Sehr bald hatte er großen Zuspruch von jungen Juden. Nach einiger Zeit waren die Ergebnisse zu fühlen. Zeitgenössische Quellen berichten: «Es war nicht länger ratsam, einen Juden zu beleidigen, es sei denn, er war ein alter Mann oder allein.» Daniel Mendoza, der elf Kinder hatte und seinen jüngsten Sohn mit Vornamen Entebbe nannte, stand noch bis ins hohe Alter im Ring.
[327] 1919 - 1929 - 1939
Preußen genießt den Ruf, das Land der höchstmöglichen Toleranz zu sein, schreibt Herr Moses an Winkopp. «Allhier in diesem sogenannten duldsamen Lande lebe ich gleichwohl eingeengt, durch wahre Intoleranz so von allen Seiten beschränkt, dass ich meinen Kindern zuliebe mich den ganzen Tag in einer Seidenfabrik, so wie Sie sich in einem Kloster, einsperren muss; und den Musen nicht so fleißig opfern darf, als ich es wünsche ... »
«Wenn die Familie Mendelssohn durch die Straßen Berlins geht, fliegen noch immer Steine. Es sind die Hände solcher Menschen, die einmal die Jüdin Rosa Luxemburg in den Landwehrkanal werfen werden.»
Hans Flesch zum 200. Geburtstag
Mendelssohns am 6. September 1929
in der «Literarischen Welt».
1774 hatte in Dessau der Pädagoge Johann Bernhard Basedow (1723-1790) eine Schule gründen können, das Philantropinum, dessen Erziehungsprogramm den Auffassungen der Menschenfreunde (Philanthropen) entsprach, die sich gegen «die Unnatur und Verkrüppelung in der häuslichen Kinderzucht, den Wortkram, die Gedächtnisqual und Rutentyrannei in den Schulen» wandten, wie es in einem alten Leixikon heißt. Sie wollten freie, aufgeklärte Persönlichkeiten erziehen und ausbilden. Als Basedow sein «Elementarbuch» vorbereitete, wandte er sich an regierende Herren, an Gelehrte und hochstehende Persönlichkeiten mit der Bitte um Subskription. Auch Mendelssohn bekam einen Brief des Pädagogen, der ihn bat, unter den Juden Vorbesteller für das Buch zu suchen.
Mendelssohn antwortete mit höflicher Verehrung für Basedow, jedoch nicht ohne Verwunderung darüber,
[328] Ahnungsloser Schulmann
dass dieser Menschenfreund keine rechte Vorstellung von der Lage der Juden zu haben schien.
«Je edler Ihre Absichten, je weiser Ihre Grundsätze und je richtiger Ihre Anwendungen sind, desto weniger können wir Gebrauch davon machen. Denn, sagen Sie mir doch um des Himmels willen, wenn Sie Ihre Absichten auf das vollkommenste erreicht haben, was haben Sie ausgerichtet? Sie haben vernünftige Menschen erzogen, welche die Rechte der Menschheit wahren, Wahrheit und vernünftige Freiheit lieben und dem Staate, in welchem sie leben, zu dienen Willen und Fähigkeit haben. Nun eben dieses soll der Jude nicht, kann er nicht, wenn seine Denkungsart mit seiner Verfassung übereinstimmen soll. Er soll die Rechte der Menschheit wahren lernen? Wenn er in dem Stande der bürgerlichen Unterdrückung nicht ganz elend sein will, so muss er diese Rechte gar nicht kennen. Er soll Wahrheit und vernünftige Freiheit lieben, um vielleicht zu verzweifeln, dass alle bürgerlichen Einrichtungen an vielen Orten dahin abzielen, ihn von beiden abzuhalten? Soll er geschickt werden, dem Staate zu dienen? Der einzige Dienst, den der Staat von ihm annimmt, ist Geld. Bei eingeschränkten Mitteln des Erwerbes große Abgaben zu entrichten, dieses ist die einzige Bestimmung, zu welcher sich meine Brüder geschickt machen müssen. Wenn Ihr Elementarbuch diese Wissenschaft lehrt, so wird es meiner Nation willkommen sein, die keine andere brauchen kann. jedoch genug hiervon, diese Betrachtungen schlagen mich zu sehr nieder, als dass ich sie ohne Widerwillen verfolgen könnte.»
Wahrscheinlich hätte Mendelssohn lieber darauf hingewiesen, dass sich die Juden zunächst darum kümmern müssten, überhaupt eine Schule für ihre Kinder einrichten zu dürfen und dass dazu die Spenden der reichen Juden, auf die Basedow zählte, gebraucht wurden.
[329] Elementare Rechte fehlen 329
1778 wollte das Dessauer Philanthropinum als pädagogisch bahnbrechendes Schulinstitut auch jüdische Kinder und Lehrer aufnehmen. Ein bis dahin undenkbares menschenfreundliches Angebot; doch es meldete sich niemand. Daraufhin bekam Mendelssohn, der oft genug als Sprecher und Anwalt der Juden betrachtet wurde, einen etwas anzüglichen Brief von einem Lehrer dieser Schule. Man hatte in Dessau nicht nur mit jüdischen Schülern gerechnet, denen man nach erfolgreicher Ausbildung eine Anstellung als Lehrer am Philanthropinum in Aussicht stellte, sondern mit ansehnlichen Geldzuwendungen der reichen jüdischen Familien, den einzigen, deren Kinder in Frage kamen. Als Mendelssohn den Brief beantwortete, fragt er augenzwinkernd:
«Bester Freund, war denn der Schritt wirklich so außerordentlich, so kühn, den das Philanthropinum zum Besten meiner Brüder getan? Liegt es nicht schon im Begriff eines philantropischen Instituts, dass ihm der Mensch als Mensch erziehungswürdig und willkommen sein muss, ohne darauf zu sehen, ob er einen beschnittenen oder unbeschnittenen Vater gehabt?»
Wer weiß, wenn statistische Daten verfügbar gewesen wären, dann hätte Mendelssohn die Aufmerksamkeit auf die pädagogischen Zustände in Preußen gelenkt.
Eff Zwei hatte von sich behauptet, er spräche nicht besser deutsch als ein Fuhrknecht. Daher fand er nichts dabei, als 1779 viele Invaliden als Lehrer eingestellt wurden, darunter solche, die selber nicht lesen und schreiben konnten. Oft gab der Hirte oder der Nachtwächter einen Teil seiner Zeit für Schulzwecke her.
Hier ist die rechte Stelle, die vielgeschmähten Münzunternehmer Ephraim und Itzig als Menschenfreunde zu nennen. Mitten im Geschäft, die Konjunktur ausnutzend, baten sie bereits 1761 um die Erlaubnis, eine
[330] Pädagogische Unternehmungen
Schule stiften zu dürfen. Also selber finanzieren. Ihre Eingabe vom 13. Juli 1761 erwartete nicht, dass die Regierung eine Schule für arme Kinder gründen sollte, in der die jüdische Jugend von jüdischen und christlichen Lehrern in Religion, Latein, Französisch, Mathematik und anderem unterrichtet werden sollte, «damit sie einmal dem Staate nützliche Dienste zu leisten imstande seien«. Das war gut formuliert. Das hört der Staat gern. Daher sahen Gutachter und Kammer die Motive der Unternehmer «als rechtmäßig und löblich an», weil «alles, was der Erziehung der Juden diene, ohne Rücksicht auf die Religionsverschiedenheit befördert werden müsse». Nach einem Jahr bekamen die Antragsteller die Erlaubnis, «eine Schule zur Erziehung und zum Unterricht von zwölf armen Judenkindern einzurichten». Vermutlich ließ sich das Projekt während und unmittelbar nach dem Siebenjährigen Krieg nicht verwirklichen.
Nach langen Vorbereitungen begann in Berlin 1781 die erste jüdische Freischule in Deutschland ihre Tätigkeit. Das Gebäude schenkte Daniel Itzig, der Münzunternehmer. Sein Schwiegersohn David Friedländer leitete zusammen mit seinem Schwager Isaak Daniel Itzig die jüdische Freischule, die kostenlosen (daher ihr Name) Unterricht bot in Hebräisch, Deutsch, Französisch, Geographie, Buchführung und andern Fächern wie Bibel und Talmud. Reiche Berliner Juden erhielten den Schulbetrieb durch Spenden und Stiftungen aufrecht. Kinder aus wohlhabendem Elternhaus zahlten monatlich zwei Taler Schulgeld.
Drei Jahre zuvor, 1778, war diese Schulgründung beschlossen worden. Mendelssohn hatte das als weiteres Mittel vorgeschlagen, um die Juden aus der Enge ihres geistigen Ghettos herauszuführen. Was für ein Gefühl muss es für ihn gewesen sein, als er der ersten öffentlichen Prüfung beiwohnte.
[331] Lernen macht frei 331
Er hielt keine Rede. Die Tatsachen sprachen. Und die aufgeweckten jungen. In den ersten Jahren konnten 500 unterrichtet werden.
Moses und Friedländer verfassten ein kleines Lesebuch. Es war 46 Seiten stark in Kleinoktav (10 mal 18,5). Zum ersten Male wurde von Juden für Juden ein Schulbuch in hochdeutscher Sprache mit deutschen und lateinischen Buchstaben geschrieben. Ein pädagogischer Feiertag, denn bisher war nur ein ähnliches deutsches Lehrbuch erschienen, Rochows berühmter «Kinderfreund» (1776), der als Vorlage diente.
Eine pädagogische Sensation: jüdische Kinder halten ein Schulbuch in der Hand und können die hochdeutsche Schriftsprache erlernen, indem sie deutsche Literatur und ins Deutsche übersetzte hebräische Literatur lesen.
1786 brachte David Friedländer eine kommentierte deutsche Übersetzung des hebräischen Gebetbuches heraus.
Diese Berliner Schule, in der es auch christliche Lehrer gab, wurde zum Modell für ähnliche Einrichtungen in Wolfenbüttel (1786), Dessau (1799), Seesen (1801) und anderen Orten.
«Die Freischule hat etwa 80 Zöglinge ... Verschiedene hier gezogene Schüler sind jetzt Kinderlehrer öder Schreibund Rechenmeister, andere sind Kontor- und Handlungsdiener, einige sind auf höhere Schulen gegangen und haben sich den Wissenschaften gewidmet.»
Nicolai in seiner
«Beschreibung Berlins», 1786
«Wenn das Volk der Juden jemals aufgeklärt werden soll», schrieb die von Aufklärern herausgegebene «Berli-
[332] Durch unsere Schuld
ner Monatsschrift» 1784, «so muss dies - da nun doch einmal die Regierungen nichts dazu tun werden - durch des Volkes eigene innere Kraft geschehen, durch die Bildung, die die Juden sich selbst erwerben und die sie dann den jüngeren und dazu Empfänglicheren wiederum mitteilen. Wahrscheinlich ein schweres Problem, dessen Auflösung geradezu unmöglich scheint: dass ein durch seine unglückliche Lage und durch unsere Schuld» - das hatte bis dahin noch kein Nichtjude zugegeben oder gedruckt in Berlin - «jahrtausendelang gedrücktes Volk ... in sich Mut und Kraft und Geschicklichkeit finden soll, sich wieder aufzurichten.»
Seltene Worte. jedoch häufig gehört in der «Mittwochsgesellschaft», die der geistige Träger dieser Zeitschrift war. Der Bibliotheksdirektor Johann Erich Biester (1749-1816) und der Pädagoge Friedrich Gedicke (1754-1803) gaben sie gemeinsam heraus. Nützliche Aufsätze (über Seuchenbekämpfung, für Chausseebäume, gegen Gespensterglauben), Nachdichtungen und literarische Kostproben. Unter den zahlreichen Mitarbeitern Namen wie Lessing, Nicolai, Mendelssohn, Lichtenberg und Kant, dessen Organ sie eine Zeitlang wurde. Die «Berlinische Monatsschrift» - mit zweimaliger Neugründung erschien sie bis 1811, war also bemerkenswert ausdauernd - lebte von 1783 bis 1796. Dann starb sie an einem Übel, an dem noch mancher Satz und mancher Mensch scheitern sollte, an der Zensur.
Der Freischule folgte die Gründung einer Druckerei. So logisch das klingt, so kompliziert war es. Eff Zwei erlaubte den Juden nicht, in deutscher Sprache zu drucken, gestattete aber in hebräischer und anderen orientalischen Sprachen gedruckte Bücher. Deshalb konnte 1784 in Berlin die «Orientalische Buchdruckerei und Buchhandlung» gegründet werden, wobei der Name
[333] «Judenschule» 333
«Orientalische» nur zum Teil wegen der betrieblichen Reichweite gewählt wurde, er bedeutete zugleich Schutz.
Mir fällt meine Schulzeit in Berlin ein. Wie oft haben unsere Lehrer, wenn sie das lärmende Klassenzimmer betraten, das Wort «Judenschule» gerufen. Wie oft hat uns ein wütender Lehrer, wenn alles durcheinanderredete, angebrüllt: «Wir sind doch hier nicht in der Judenschule!»
Auch wer die DDR nicht mag, wird zugeben müssen, dass dieser Lehrerzuruf aus ihren Schulen verschwunden ist. Damals jedoch, als das Wort «Jude» allein tödlich war und dermaßen entsetzlich, war der Schrei «Judenschule» für unsere bedauernswerten Lehrer eines der zum Einschüchtern geeigneten Worte. Es war nicht neu. Sie hatten es von ihren Lehrern zugerufen bekommen, die hatten es einst als Kind gehört. Die Judenschule, ein tobender Lärm, bei dem man nichts verstand, nicht lernen konnte. Es gab auch den sanften Klassenleiter, der sich an die Stirn tippte und leise zu uns sagte: «Wir sind doch nicht in der Judenschule ... »
Ob einige wenige unserer Lehrer wirklich gewusst haben, was eine Judenschule ist? Das heißt, zu wissen brauchten sie es nicht, es genügte die ihnen von der Regierung gegebene Richtlinie «Die Juden sind unser Unglück», um weitere antisemitisch orientierte Generationen von Soldaten und Müttern auszubilden.
Und heute - da keiner das Wort benutzt, stirbt es aus; es stirbt hinterher, es stirbt den Juden hinterher, die vor vielen Jahren sterben mussten und daher fast ausgestorben sind.
Wir aber fahren nach Prag und sehen für eine Synagoge das Wort «Altneu-Schul» verwendet. Eine christliche Kirche in Verbindung mit diesem Wort gibt es
[334] Altneu-Schul
nicht; Konfirmierte erinnern sich, dass der dazugehörige Unterricht sie kaum an die Schule erinnerte, eher an schulfrei.
Altneu-Schul. Wie nützlich wird das kleine Bilderheft, mitgebracht aus der Altneu-Schul, der ältesten Synagoge Europas: Als im Jahre 586 vor unserer Zeitrechnung der erste Tempel Jerusalems zerstört wurde, fand der jüdische Gottesdienst in Versammlungen statt, die später mit dem griechischen Wort Synagoge bezeichnet wurden. Auch das dazugehörige Gebäude wurde so genannt. Der Gottesdienst in der Synagoge bestand aus Vorlesen der Thora, Gebeten, Predigten und - in christlichen Gottesdiensten unvorstellbar - Diskussionen.
Als die Juden unier anderen Völkern zerstreut wurden, entwickelten sich die Synagogen zum Zentrum des geistigen Lebens. Hier wurde gelehrt.
Bis zur Emanzipation der Juden war es ein rein religiöser Unterricht. Daher bekamen die Synagogen im Mittelalter die Bezeichnung Schule. War nicht der Vater unseres Moses in Dessau von Beruf Schulklopfer. Derjenige, der die Gemeindemitglieder an den Beginn des Gottesdienstes erinnert, indem er an ihre Haustür ,klopft. Das Läuten von Glocken, aus akustischen Gründen in Türmen aufgehängt, kennt die jüdische Religion nicht. Und wenn, wäre es als unchristlicher Lärm ohnehin sehr bald verboten worden.
Das doppeldeutige Wort Judenschule wäre damit erklärt, gäbe es nicht eine weitere Bedeutung: «Ort, wo man viel untereinander spricht.» Schon deswegen muss eine Judenschule denjenigen ungeheuerlich vorkommen, die es gewohnt sind, dass nur einer spricht. Der Pfarrer, der Lehrer, der Leutnant. Beim jüdischen Gottesdienst ist tätige Mitarbeit erwünscht. jeder Jude sollte jederzeit Vorbeter in der Synagoge sein können, lautete das Ideal.
[335] Ein Rabbi erklärt 335
Wer könnte, wenn er gefragt wird, auf Anhieb den Unterschied zwischen der christlichen und der jüdischen Religion erläutern?
Schon längst wäre eine möglichst einfache Erklärung der Unterschiede und Besonderheiten ihrer Anschauungen nötig gewesen. Herr Moses und sein Wirken lässt sich besser begreifen, und auch, was er unterlassen hat.
Eine Abhandlung bieten? Ein Stück Lehrbuch? Aber welches? Und wieviel davon? Hilfreich kommt ein Kriminalroman in die Quere. «Am Mittwoch wird der Rabbi nass» von Harry Kemelman.
Dort unterhält sich ein amerikanischer Rabbi mit einem Arzt und erklärt, seine jüdische Religion sei eine moralische Religion, ein Lebensstil.
Sind das nicht alle Religionen? wird er gefragt.
«0 nein», antwortet der Rabbi. «Das Christentum zum Beispiel ist eine mystische Religion.»
Nun sagt der andere, ob er damit behaupten wolle, die Christen seien nicht moralisch? Der Rabbi macht eine ungeduldige Geste und antwortet
«Selbstverständlich sind sie das. Aber bei ihnen kommt das erst in zweiter Linie. Was ihnen vor allem eingeschärft wird, ist der Glaube an den Menschengott Jesus. Und ihre Moral entspringt dem Grundsatz, dass sie, wenn sie an Jesus als den Sohn Gottes und den Heiland glauben, versuchen werden, ihm nachzueifern, und daher moralisch handeln werden. Außerdem herrscht, vor allem bei den evangelischen Sekten, der Glaube, wenn man wahrhaft glaubt, (wenn man Jesus in seinem Herzen aufnimmt), heißt es wohl üblicherweise, komme das moralische Verhalten von selbst. Und manchmal stimmt das sogar.» Er legte den Kopf schief und überlegte. Dann nickte er energisch. «Natürlich. Wenn man die Gedanken auf den Himmel richtet, ist man weniger versucht, die Dinge dieser Welt zu begehren. Gewiss,
[336] Nichts weiter zu bieten als...
hin und wieder mag man ausrutschen, aber nicht so oft, wie wenn man an gar nichts anderes denkt. Andererseits neigt man vielleicht zu der Auffassung, dass jede Laune, die einem in den Kopf kommt, das Wort Gottes sein muss. Bei uns dagegen hat der Glaube im christlichen Sinne so gut wie gar keine Bedeutung, da Gott für uns unerkennbar ist. Was kann es bedeuten, wenn ich sage, ich glaube an etwas, das ich nicht kenne und auch nicht erkennen kann? Theoretisch haben die Christen dieselbe Auffassung von Gott, und darum wurde Sein Sohn auf Erden geboren und lebte als Mensch. Denn da er ein Mensch war, konnte Er erkannt werden. Wir aber teilen diesen Glauben nicht. Unsere Religion ist ein Moralkodex. Der Kodex Moses, die Thora, ist eine Reihe von Verhaltensregeln und -gesetzen. Und die Rabbis, aus deren Diskussionen und Debatten der Talmud besteht, befassen sich mit der Aufgabe, bis ins kleinste Detail festzuhalten, wie diese allgemeinen Verhaltensregeln erfüllt werden sollen. Ich möchte nebenbei erwähnen, dass dies der Grund ist, warum in all den Jahren so wenige Menschen zum Judentum übergetreten sind. Weil wir nichts zu verkaufen haben: keine Geheimnisse, keine Zauberformel, keine zeremonielle Einweihungsfeier, die das Tor des Himmels öffnet. Wenn ein Christ zu mir kommt, der übertreten will, wie es hin und wieder geschieht, erkläre ich ihm genau das, denn wir haben tatsächlich nichts weiter zu bieten als unsere Moral und unseren Lebensstil. Und wenn er sagt, dafür interessiere er sich ja gerade, daran möchte er teilnehmen, antworte ich ihm, das solle er nur tun, nichts könne ihn daran hindern, ein moralischer Christ stehe in unseren Augen ebenso hoch vor Gott wie der Hohepriester von Israel.»
Er hätte Mendelssohns Sohn sein können. Er hieß Lazarus Bendavid und lebte von 1762 bis
1832. Er war in Ber-
[337] Den Schuldirektor wählen 337
lin geboren worden, wurde dort schlecht und recht unterrichtet, studierte an verschiedenen Universitäten und dachte, er könne in Preußen Jurist werden. Schon der Berufswunsch war absurd, der Bescheid selbstverständlich abschlägig. Mit dieser Religion im Personalfragebogen konnte man mit Seide handeln und irgendwelche Bücher verfassen, aber taugte nicht für den Justizdienst.
Bendavid ging nach Wien und hielt Vorlesungen, bis ihn das österreichische Aufenthaltsverbot für Fremde wieder nach Berlin trieb, wo er nun als Lehrer tätig sein durfte an der Freischule, als Redakteur bei der «Spenerschen Zeitung» und als Schriftsteller. Heine und Zelter kannten ihn, Kästner lobte ihn als Mathematiker, die Akademie gab ihm einen Philosophenpreis. Bendavid schrieb über, für und gegen die Juden, benannte Kritikwürdiges im eigenen Haus, griff Beschränktheit an, und als er wegen seines Nichtbeachtens der Zeremonialgesetze von jenen, die sich unfehlbar vorkommen, daran gehindert wurde, selbst die Trauergebete für seinen verstorbenen Vater zu sprechen, betrat er zwanzig Jahre die Synagoge nicht mehr. Doch das sind nur sporadische Auskünfte über einen längst unbekannt gewordenen Menschen, den die Berliner Gemeinde 1806 zum Direktor der jüdischen Freischule wählte. Schuldirektor als Wahlfunktion ... Immerhin ein beachtliches Stück demokratischer und kultureller Reife. Bendavid arbeitete unentgeltlich, weil die Mittel der Schule angesichts der trüben Verhältnisse immer knapper wurden: In jenem Jahr verlor Preußen gegen Napoleon bei Jena und Auerstädt.
Ein anderer erster Mann hätte die Schule wahrscheinlich geschlossen, wenn er kein Gehalt bekam, doch Bendavid, vom Fortschritt überzeugt, setzte sogar durch, dass auch christliche Kinder in die Freischule gehen
[338] Schulwege
durften. Wie lange ließ sich der Staat das gefallen? Das ist eine wunderbare Frage für ein Preisausschreiben.
Zunächst beschäftigte Napoleon alle Reserven. Die sogenannten Befreiungskriege kamen, an denen sich als nationale Neuerung Juden beteiligen durften. Das Leben und Sterben fürs deutsche Vaterland blieb ihnen bis einschließlich 1918 gestattet.
1819, im Gefolge der die Menschenrechte unterdrückenden Karlsbader Beschlüsse, an die noch heute in Karlovy Vary eine Gedenktafel erinnert, wurde das Durcheinander der jüdischen Freischule aufgehoben. Die christlichen Kinder mussten auf Befehl der Regierung die Schule verlassen. Das ist die Meldung im Amtsblatt.
Bei Bendavid können wir die Wirkung lesen: «Alles weinte laut auf, als hätten die entlassenen Christenknaben ihre Eltern, die zurückgebliebenen Judenknaben ihre Brüder und die Lehrer und Vorsteher ihre Kinder verloren.»
1826 musste Bendavid die Schule auflösen.
Ja, es ist weit hergeholt. Von jenem Tag im Jahre 1819 bis zu jenem Nachmittag im Jahre 1941, als eine SA-Horde vor der jüdischen Knabenschule die dort im Vorgarten stehende Büste von Moses Mendelssohn so lange mit Steinen bombardiert, bis der Kopf dieser Büste herunterfällt.
Das sieht heute dem Gebäude keiner mehr an, in dem sich eine Berufsschule für Industriekaufleute befindet. Ob sie nach Moses Mendelssohn benannt ist, dem Industriekaufmann, der wenige Schritte von hier begraben liegt?
Brief an die Berufsschule für Industriekaufleute, 104 Berlin, Große Hamburger Straße 27: «Ich wüsste gern, ob sich bei Ihnen jemand mit der Geschichte Ihres Schulhauses vor 1945 beschäftigt, ob es eine Chronik
[339] Kennt jemand diesen Moses? 339
oder dergleichen gibt. Haben Sie eine Gedenktafel für Moses Mendelssohn, dessen Büste vor dem Gebäude stand und 1941 von SA-Leuten zerstört wurde?»
Diese Büste war das Ergebnis eines Wettbewerbs unter einigen Berliner jüdischen Bildhauern gewesen. 1907 wollte Moritz Manheimer, ein Berliner Philantrop, Herrn Moses auf diese Weise ehren und stiftete ein Denkmal, das vor der jüdischen Knabenschule aufgestellt werden sollte. Im Februar 1909 wurde dort die preisgekrönte, von Rudolf Marcuse geschaffene Büste eingeweiht. Ein anderer Entwurf, der von Jakob Pleßner stammte, kam als Bronzeguß in die Aula der Schule.
«Kommunale Berufsschule 23.3.1977
(Prof. Dr. Richard Fuchs>
104 Berlin Große Hamburger Straße 27
Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 8. März und müssen Ihnen mitteilen, dass sich niemand um die Geschichte unseres Hauses vor 1945 kümmert. Eine Gedenktafel für Moses Mendelssohn ist in unserem Hause nicht vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen
Zernikow, Direktor»
Das ist präzise geantwortet. Aber ist es nicht ungeheuer traurig? Bei der Namensgebung hat niemand an Herrn Moses gedacht oder an die Vergangenheit dieses Hauses. War denn das so lange her? Gab es niemand in der Nachbarschaft, den man hätte fragen können? Keine alten Akten über ein Schulhaus? Kein Geschichtsunterricht?
Es kümmert sich niemand um die Geschichte dieses Hauses vor 1945. Nur die ganz kleinen, die eifrigen Pioniere in den unteren Klassen der Oberschulen forschen
[340] Staatsbürgerkunde
andächtig. Die großen Industriekaufleute haben dafür keine Zeit, was durchaus begreiflich ist. Die Impulse müssen von innen kommen, geweckt vom Lehrer, von einer wachen Verwaltung.
Prof. Dr. Richard Fuchs in allen Ehren. Doch schadet es seinem Andenken, wenn irgendeine andere Kommunale Berufsschule Berlins nach ihm benannt wäre? Hier aber, die ehemalige Knabenmittelschule in Sichtweite dieses Friedhofes, dieser Grünanlage - liest denn, wer für ein Haus in der Großen Hamburger Straße eine Namensgebung unterschreibt, nicht die Gedenktafel auf dem Rasen?
Ich stehe nicht für diese schreckliche Gleichgültigkeit gegenüber unserer Geschichte ein. Ich frage laut und hörbar: Warum ist diese Schule nicht nach ihrem Gründer benannt worden? Vielleicht ist der frühkapitalistische Industriekaufmann Moses Mendelssohn kein Vorbild für sozialistische Industriekaufleute. Aber vielleicht der Mensch? «Eine Gedenktafel für Moses Mendelssohn ist in unserem Hause nicht vorhanden», ein fürchterliches Armutszeugnis, dem der Nebensatz fehlt, sechs Millionen ermordete Juden betreffend, von denen einige tausend hier zur Schule gegangen sind, in diesem Gebäude, in diesen Räumen. Staatsbürgerkunde ...
Herr Moses führte, als sein Chef gestorben war, die Seidenfabrik seit 1769 gemeinsam mit der Witwe Bernhard weiter und machte einen Neuerervorschlag. Es gab ein staatliches Magazin, in dem Beamte den Einkauf der Rohstoffe und Kredite an die Fabrikanten regierten. Der Kenner darf vermuten, dass sich der Einkauf nach dem Geschmack der Beamten richtete. Fachleute wie Moses sprachen mit gebührender Zurückhaltung von unzulänglicher Qualität und eingeschränktem Sortiment der Rohseide. Deshalb - so lautete Mendelssohns Empfeh-
[341] Neuerervorschlag 341
lung - sollten die Fabriken sich ihren Bedarf lieber selber aussuchen und bestellen können und über das Magazin beziehen, das auch die Zahlungsfrist regeln würde.
Das Magazin wurde dadurch sein großes, unvorteilhaftes und risikoreiches Lager los, während die Seidenfabriken nach ihren eigenen Plänen produzieren konnten. Im nächsten halben Jahr war der Umsatz höher als im ganzen Vorjahr.
Mendelssohn als Fabrikant, als Unternehmer. Der Philosoph braucht einen Beruf. Wie der Dichter.
«Ich erinnere mich, dass Mendelssohn zu sagen pflegte, dass er ohne die Mühseligkeit des Seidenladens und des Buchhaltens die Seligkeit des Philosophierens nie so innigst gekostet hätte.»
«Er besaß einen ungemein feinen Geschmack; selbst Frauenzimmer suchten seinen Rat bei Farbenwahl und Kleidung»
102 Webstühle war der Gipfel des Betriebes Bernhard, dann ging es langsam abwärts. Die ausländischen Regierungen unterbanden den zunehmenden Import aus Preußen, gleichzeitig änderte sich die Mode und bevorzugte statt der schweren Seide leichte und glatte Stoffe. 1782 gab es in den Bernhardschen Fabriken noch 78 Webstühle.
1781 starb die Witwe; von neun Erben wollten nur zwei Söhne im Geschäft bleiben und es gemeinsam mit Moses weiterführen als Gebrüder Bernhard & Co. oder auch Gebrüder Bemhard&Moses Mendelssohn. Diesem Herrn Moses gewährte der König Eff Zwei sogar eine Konzession, die auch bei begründeter Betriebseinschränkung in den kommenden Jahren die Fabrik nicht
[342] Wo Mendelssohns Büste stand
durch Rückforderung von Krediten ruinierte. Diesen Mann brauchte er.
Als der technische Oberaufseher der preußischen Seidenfabriken 1782 einen ausführlichen Bericht über deren Stand und Einrichtung in französischer Sprache vorlegte, wurde dieses Schriftstück drei der bedeutendsten Berliner Seidenfabrikanten zur Stellungnahme vorgelegt. Zwei christlichen, die ebenfalls in französisch antworteten, und Moses Mendelssohn, der sein Gutachten, nebbich, in deutscher Sprache vorlegte. Er wehrt sich darin vor allem gegen die staatlichen Eingriffe, durch die die industrielle Entwicklung gehemmt wird.
Als Mendelssohn starb, betrug die Zahl der Webstühle trotz schlechter Geschäftslage noch 70 Stück. Knapp zwei Jahre nach seinem Tode wurde die Fabrik auf Bitten der Gebrüder Bernhard aufgelöst.
«Die Gebrüder Bernhard und Komp. (Moses Mendelssohn) (in der Spandauer Straße), seit 1750; 29 Stühle in Sammet und Seide in Berlin 580 Stück für 58 000 Reichstaler verfertigt; doch lässt sie auch in Potsdam stark arbeiten.»
Wir bleiben noch in der Großen Hamburger Straße, die eine kleine Straße ist, eng, nicht sehr ansehnlich, aber angefüllt mit Geschichte und Geschichten, so sie sich offenbaren wollen. Gegenüber der Schule, vor der einst Mendelssohns Büste stand, sind im steinernen Bogen über einer Haustür vier Kindlein angebracht, plastisch und puppenähnlich, puttenähnlich. Sie stehen nebeneinander; eine dicke Girlande, an die sich alle lehnen, hängt den Flügelkindern von der Schulter herab. Was mag das bedeuten?
[343] Eine Hand hält die andere 343
Die Kinder stehen da wie die vier kleinen Schwäne im «Schwanensee», dieser Tanz zu viert, er hat einen Namen, wie aber bekommt der Leser die Melodie; wenn hier die Noten stünden, ich könnte sie nicht absingen, helf er sich. Dann gehen Sie doch mal in «Schwanensee». Die vier kleinen Schwäne, das sind vier Fortgeschrittene, die ein Vierersolo haben, ein eigenes Kabinettstück, und so, wie sie sich dabei an den Händen halten, so halten sich diese vier Kinder hier.
Man kann es geographisch-mathematisch angeben, der Leser nimmt einen Stift und notiert. Von links nach rechts, die Hände fortlaufend nummeriert. Hand 1 hält Hand 3, Hand 2 hält Hand 5, Hand 4 hält Hand 7, Hand 6 hält Hand 8, das sind sie schon, so einfach ist das. Eine Kette. Keine leere Hand.
Wenn man wüsste, was das bedeutet? Pausbäckige Kinder, kein einzelnes lässt sich herauszerren. Man hält sich gegenseitig im Stande der Solidarität.
Große Hamburger Straße. Ich hatte eine Hamburger Großmutter. Sie war mehr als deutsch-national. Sie war eine gute Frau, aber - leider muss ich es sagen - sie war für Hitler. Unter gutbürgerlichen, um nicht zu sagen fast großbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen, verlor sie mit 28 Jahren den Mann, zog ihre drei kleinen Kinder groß, heiratete deshalb wieder, verlor den ersten Weltkrieg und in seinen Nachwehen den Rest ihres kleinen Vermögens, auch der zweite Mann starb früh. Man muss dieser Frau Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sie hatte immer Verluste erlitten, wenn es ihrem Lande schlecht ging. Hitler gefiel ihr, weil er dieses Land wieder in die Höhe zu bringen versprach. Ganz gewiss bezauberte er sie mit seinen Reden. Wer nicht glaubt, wie Frauen bei seinem Anblick vor Begeisterung zitterten und aufschrien, der sehe hin, wenn mal wieder ein alter Film gezeigt wird, was leider zu selten vorkommt; da stehen sie
[344] Die Hamburger Großmutter
und reißen den Arm hoch, und nicht nur die Augen sind feucht.
Als Hitler zur Macht kam, war meine Großmutter 61 Jahre alt. Sie starb 1942 in Berlin. Es war die Zeit, als die Gestapo in das Altersheim in der Großen Hamburger Straße eingezogen war und die Juden, gleich welchen Alters, zum Sterben brachte. Ganz bestimmt ist meine Hamburger Großmutter nie in der Großen Hamburger Straße gewesen. Ganz sicherlich hat sie diesen Namen nie gehört. Wahrscheinlich hat sie auch von den Verbrechen kaum gewusst oder zu wenig. Wie soll ich ihr Schuld geben, wie Rechtfertigung?
Wenn ich nun aber in der Großen Hamburger Straße eine Großmutter gehabt hätte, eine jüdische Großmutter?
«Die sogenannte Evakuierung, in Wahrheit aber Abtransport zur Vernichtung der Juden, begann jetzt. Auch in unserem Altersheim steigerte sich die Panikstimmung Tag für Tag und Monat für Monat. Die Alten, die oft noch auf dem angrenzenden alten Friedhof zwischen Grabsteinen wandelten, sahen schmerzerfüllten Herzens und tränenden Auges schon ihre eigenen Gräber.» Rabbiner Martin Riesenburger, (1896-1965) in seinen Lebenserinnerungen.
Und wenn meine Großmutter als Christin in der Großen Hamburger Straße gewohnt hätte und das mitangesehen?
Meine Kollegin Irina Liebmann, die über diese Straße schreibt und dort viele Bewohner befragt hat, erzählt von einer Bemerkung, die man nicht vergisst.
Dazu muss man auf den Stadtplan sehen. Das jüdische Krankenhaus in der Auguststraße grenzt an das Katholische Sankt-Hedwigs-Krankenhaus in der Großen Hamburger Straße. Dessen Oberin ist 1938 als junge Schwester nach Berlin gekommen. Sie erinnert sich an die
[345] Kristallnacht und später 345
Kristallnacht. «Das war schrecklich. Wir waren ja jung, wir sollten nicht auf die Straße gehen. Aber es war so eine unheimliche Stimmung, man hat das gespürt. Ich habe das Fenster aufgemacht; der Himmel war rot vom Feuerschein. Die Synagoge in der Oranienburger Straße brannte doch.» Es ist Gelegenheit, eine immer wieder kolportierte historische Fehlinformation zu berichtigen. Dr. Hermann Simon, der sich damit beschäftigte, schreibt: «Die Synagoge in der Oranienburger Straße brannte nicht in, der sogenannten Kristallnacht, sondern wurde im Krieg durch Bomben getroffen.» Das bekannte Foto der brennenden Synagoge stammt nicht aus dem Jahre 1938, sondern «aus dem Krieg, was allein aus der Tatsache hervorgeht, dass auf diesem Bild ein Turm fehlt».
Der Feuerschein, den die junge Krankenschwester sah, wird von der nahegelegenen Synagoge in der Johannisstraße gekommen sein. Wie dem auch sei. «Feuerwehren hörte man, die kamen zur Sicherheit, aber löschten nicht. Als unsere Oberin mich am Fenster sah, erschrak sie. Sie rief: «Gehen Sie da weg, um Gottes willen! Machen Sie sich nicht zum Zeugen!»
Mitschuldig durch Zusehen? Unschuldig durch Wegsehen?
Was ist denn, wenn man mich nach der Kristallnacht befragt? Im Stadtbezirk Kreuzberg gab es keine Synagoge in unserer Nähe. Nichts brannte. Kein Lärm. Am anderen Morgen auf dem Schulweg zu zweit, zu dritt, wir wunderten uns, an der Ecke Obentrautstraße und Belle-Alliance-Straße eingeschlagene Schaufensterscheiben zu sehen. Es war aber alles ordentlich weggefegt und dunkel. Fragezeichen.
Da die Alten wegsterben und die jungen zu wenig wissen, bleiben Ereignisse mit einem Satz übrig. Und das ist zu wenig.
[346] Auf den Umgang achten
Ich war zehnjährig aus Dresden nach Berlin gekommen. Hatte zu tun mit der neuen Umwelt, musste sie verdauen; die Leute redeten anders. Verlust der Herkunft. Wie sollte ich wissen, warum sollte mir auffallen, dass ein jüdischer junge in meine Schulklasse ging? Der Lehrer tat ihm nichts. Er lebte unbeachtet, wohnte gleich neben der Schule, hatte daher keinen Nachhauseweg. Das war 1936, im olympischen Jahr, in dem gut getarnten in Berlin.
Wie dieser junge hieß, weiß ich nicht mehr. Und wenn ich genau nachdenke, habe ich seinen Namen vielleicht nie gewusst. Nach einem Jahr kam ich in eine andere Schule, hatte einen anderen Weg, sah ihn nicht mehr; wünschte später manchmal, er möge davongekommen sein.
Eines Nachmittags jedenfalls kam er, wie wir in irgendeiner Pause verabredet hatten, zu mir nach Hause spielen. Wir jagten ungestört kleine Rennautos durch den langen Korridor.
Damals waren Autorennfahrer und die dazugehörigen silbernen Wagen Jungenmode.
Meine Hamburger Großmutter, die gern reiste und gerade einige Wochen bei uns wohnte, kam nach Hause, musterte den Besuch; doch nun war die Ruhe gestört im Korridor, der junge ging bald. Wenn ich doch nur seinen Namen wüsste. Ich mag ihm keinen erfinden, weil er wenig später den Zwangsnamen «Israel» angepasst bekam. Auch bei längerem Nachdenken fällt mir sein Vorname nicht ein. Wahrscheinlich wird er Siegfried geheißen haben.
Als der Spielgefährte gegangen war, kam meine Großmutter und fragte leise und gar nicht unfreundlich: «War das wohl ein kleiner Jude, der zu dir s-pielen kam?» Man muss sich den Hamburger Unterton vors-tellen beim Lesen, das vom t getrennte s. Dann sagte sie, wiederum
[347] Was ist kluges Verhalten? 347
nicht drohend, sondern eher sachlich und ermahnend: «Es ist aber nicht gut für einen deutschen jungen, mit einem jüdischen jungen zu s-pielen, weißt du.»
Keine Standpauke, kein Verbot, keine Drohung, nur freundlich ruhiger Rat. Sie erklärte nicht das Warum. Ich fragte nicht nach dem Wieso. Das Seltsame ist, dass dieser junge und ich noch nie zuvor gemeinsam gespielt hatten, auf der Straße nicht und nicht in der Wohnung; es war ein einmaliges zufälliges Zusammentreffen. Wäre die Großmutter eine Stunde später gekommen, hätte sie nicht im Korridor über unsere Rennwagen steigen müssen. Nein, keine Freundschaft, kein Verabreden, keine Nachbarschaft. Man spielt einmal mit einem anderen, geht seiner Wege.
Und gerade weil ich hier die Gelegenheit auslasse, eine tragfähige Dichtung zu bieten, eine durchaus schreibwürdige Geschichte daraus zu machen, will ich die Situation weiterdeuten. Die Hamburger Großmutter, diese kluge, ehrenwerte Frau' die in ihrem Leben vielen Menschen Gutes getan hat und selber oft zu kurz kam, sie hat an jenem Nachmittag bei uns im vierten Stock auf dem Korridor mitgespielt, als sie sich aussondernd auf die Auschwitz-Rampe begab: mit dem dort ja, mit jenem nein.
Soll ich so hart urteilen?
Die Hamburger Großmutter, welterfahren, in einem Haushalt mit Dienstmädchen und Kinderfrau aufgewachsen, wollte sie ihrem Enkel nicht beistehen gegen mögliche Nachteile und schlimmere Dinge? Sorgt eine Großmutter sich nicht um den Umgang? War es nicht klug, keine Bekanntschaft mit einem kleinen Juden zu haben? Es war sogar klüger, nicht wahr?
Die Großmutter war nicht in der Nazipartei. Bei uns war überhaupt niemand irgendwo Mitglied, von den Pflichtübungen im Luftschutz und der Hitlerjugend ab-
[348] Wenn die Patrioten singen
gesehen. Im Bücherschrank stand in der zweiten Reihe «Im Westen nichts Neues» neben Thomas Mann und Emil Ludwig.
Die deutsch-national gesinnte Großmutter mochte den Mann Hitler und sein Angebot sehr, weil in ihm das Wort National so groß geschrieben stand. Ich habe vergessen, wie wir eines Tages auf das Lied kamen von der Fahne Schwarz-Weiß-Rot. Großmutter war eine Seemannstochter. War es das wieder einmal gedruckte Gemälde eines Matrosen in Seenot, auf einer Planke treibend, ohne Schwimmweste, aber die Fahne in der Hand, die Fahne Schwarz-Weiß-Rot. Kriegskitsch. Es kann, und das ist wahrscheinlicher, während des Krieges gewesen sein, dass sie es sang oder summte, denn sie mochte es sehr. «Stolz weht die Flagge Schwarz-Weiß-Rot von unsres Schiffes Mast, dem Feinde weh, der sie bedroht, der diese Farben haßt.» Die Melodie beschwingt und als nationaler Ohrwurm wirkend.
Nun war zwar die Flagge Schwarz-Weiß-Rot, die deutsche Nationalfahne, ersetzt worden durch die Hakenkreuzfahne, doch der Schluss des Liedes, wo es heißt « Ihr woll'n wir treu ergeben sein, getreu bis i-i-i-in den Tod, ihr woll'n wir unser Leben weihn, de-er Fa-ahne Schwarz-Weiß-Rot», der war ohne Worte in den Schlussschnörkel des, anderen, höchst populären Kriegsliedes gelangt: «Denn wir fahren, denn wir fahren gegen Engelland», das immer fröhlich aus dem Rundfunkkasten klang, wenn feindliche Schiffe versenkt worden waren.
Stolz wehte die Flagge Schwarz-Weiß-Rot auch in der Brust der Großmutter. Lacht nicht, ihr Lieben, sondern seht nach, welche Melodien in euch flattern und welche Texte ihr plappert. Und Schauer über den Rücken.
Wenn meine Großmutter geahnt hätte, dass ein Jude diesen Text verfaßt hat. Der Schriftsteller Robert Linderer, 1824 in Erfurt geboren und seit 1866 Mitinhaber der
[349] Die wahre Aufklärung 349
Frankeschen Theateragentur in Berlin, war Herausgeber der «Neuen Schaubühne». Unter seinen zahlreichen, von E. F. R. Thiel vertonten Humoresken war das Singspiel «Unsere Marine», 1886 aufgeführt, in seinem Todesjahr. Noch war Kaiser Wilhelm II. nicht gekrönt und in Admiralsuniform zu sehen, noch hatte er nicht verkünden können «Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser», da hatte ein prognostisch denkender Jude allverwendbar geschrieben «Stolz weht die Flagge Schwarz-Weiß-Rot von unsres Schiffes Mast» ... Mit patriotischem Humor dargeboten von bärtigen Männern mit Matrosenkragen, von Soubretten im fleischfarbenen Trikot.
Wenn Hitler das geahnt, wenn meine Großmutter das gewusst hätte. Aber so ist Historie. So muss sie geschrieben werden, wenigstens hinterher.
Manchmal fragte Herr Moses seine Freunde: Wird dadurch die Kenntnis der Menschen berichtigt oder vermehrt? Das Nachdenken gestärkt? Und der Weg zur Glückseligkeit gebahnter und sicherer? Einen Zweck muss doch die Arbeit haben.
«Dass nun jeder einzelne Mensch, wenn er seinen Anteil von Kräften zur Erhaltung des Ganzen aufgewandt hat, sich auch als den Zweck dieses Ganzen betrachten lerne und auch von jedem anderen so betrachtet werde - darin besteht eigentlich die wahre Aufklärung, welche notwendig allgemein verbreitet sein muss, wenn sie nicht als bloße Täuschung und Blendwerk betrachtet werden soll.»
Im Dezember 1790 schrieb Lessing aus Wolfenbüttel zum letztenmal an Mendelssohn. Moses' hatte ebenso wie Nicolai seit einigen Jahren keine Briefe mehr von dem Freund erhalten. Er nahm das in Kauf. Lessing
[350] Letzter Brief von Lessing
«war, wie seinen Freunden bekannt, nie der rüstige Briefschreiber» schrieb Moses «auch eben im Beantworten nicht pünktlich, wenn ...
...

------------- E N D E --------------