RR ««« - zurück zur Bücherübersicht - Textübersicht - Startseite (Gesamtübersicht)
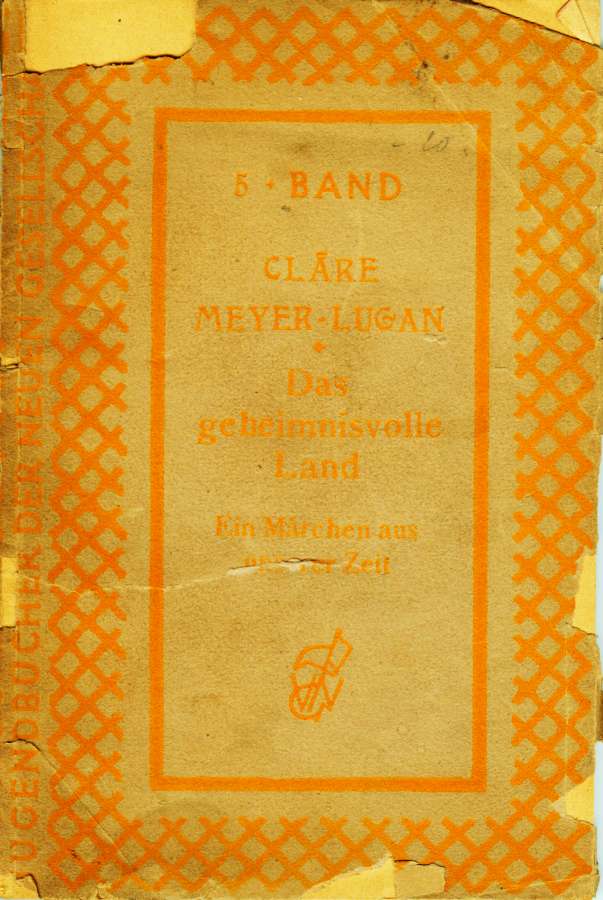
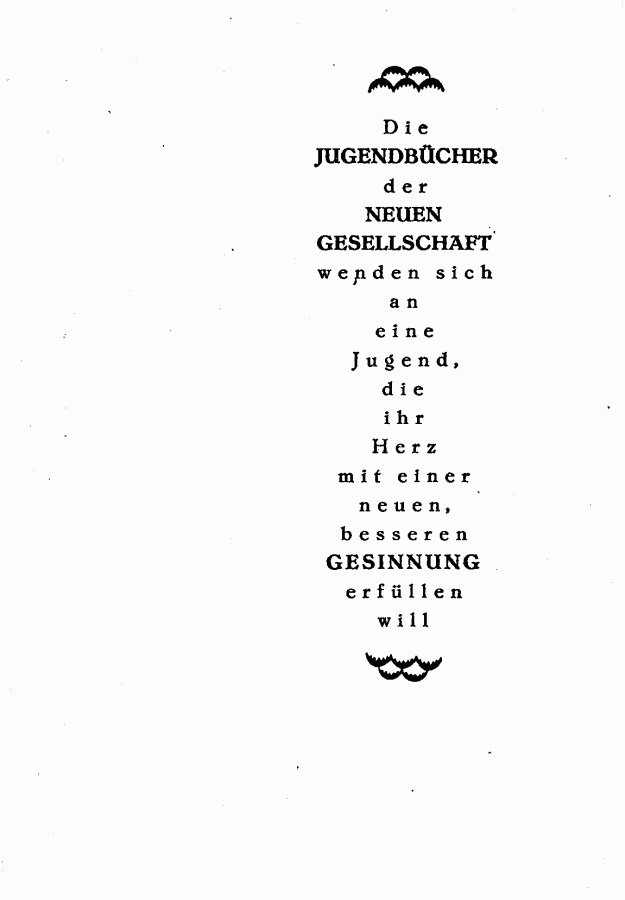
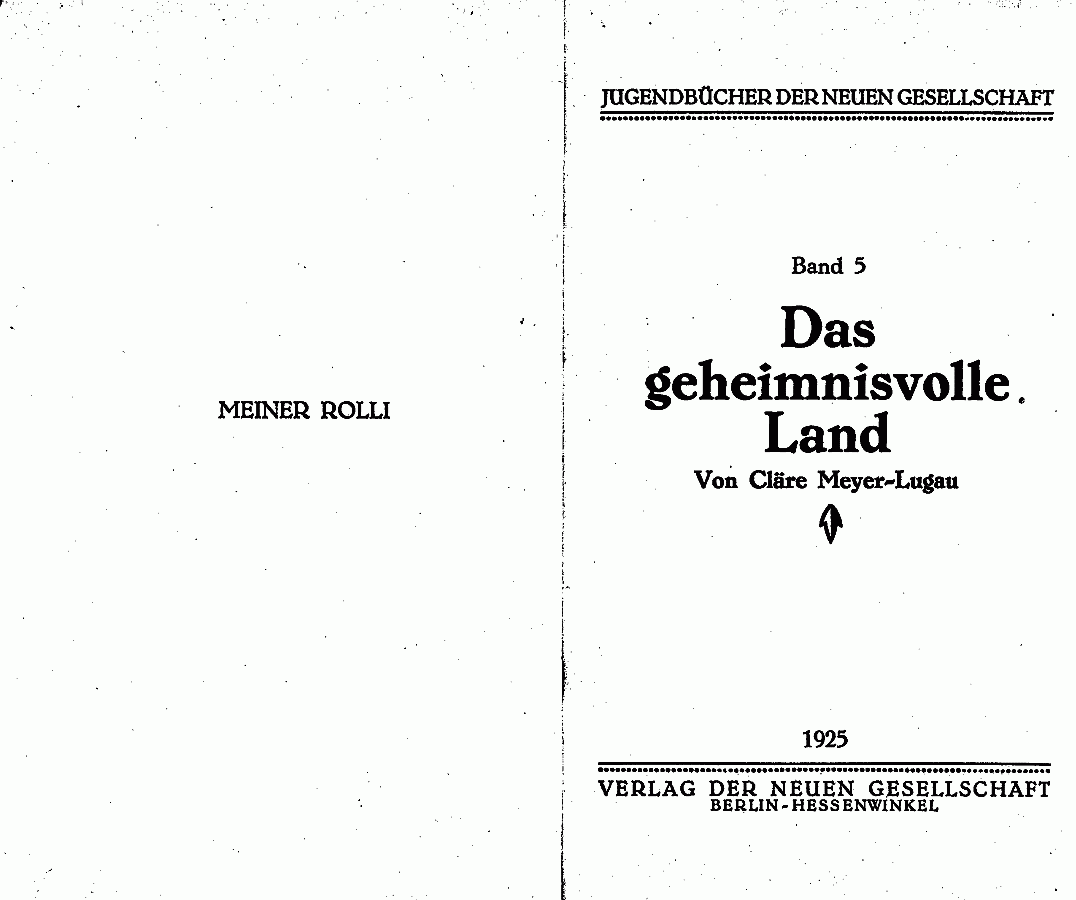
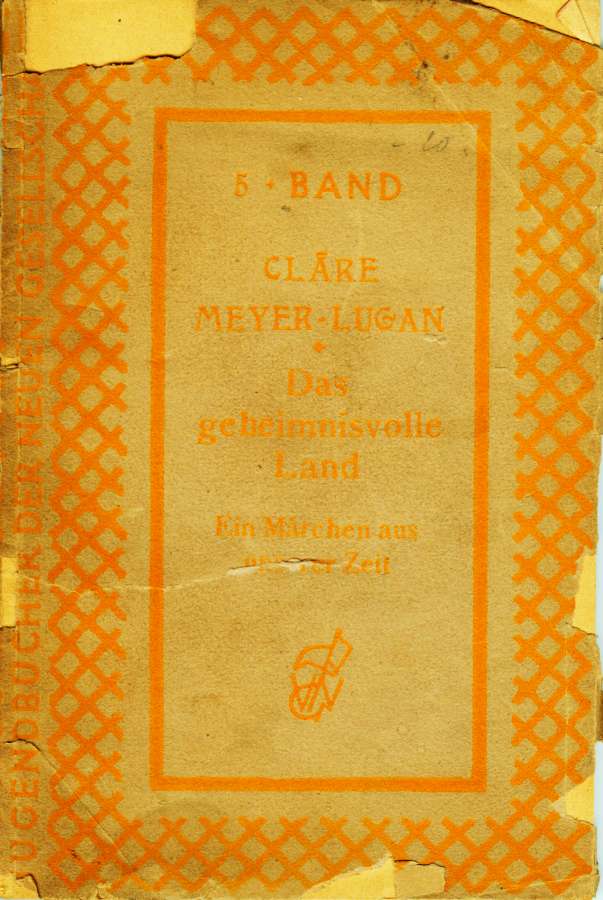
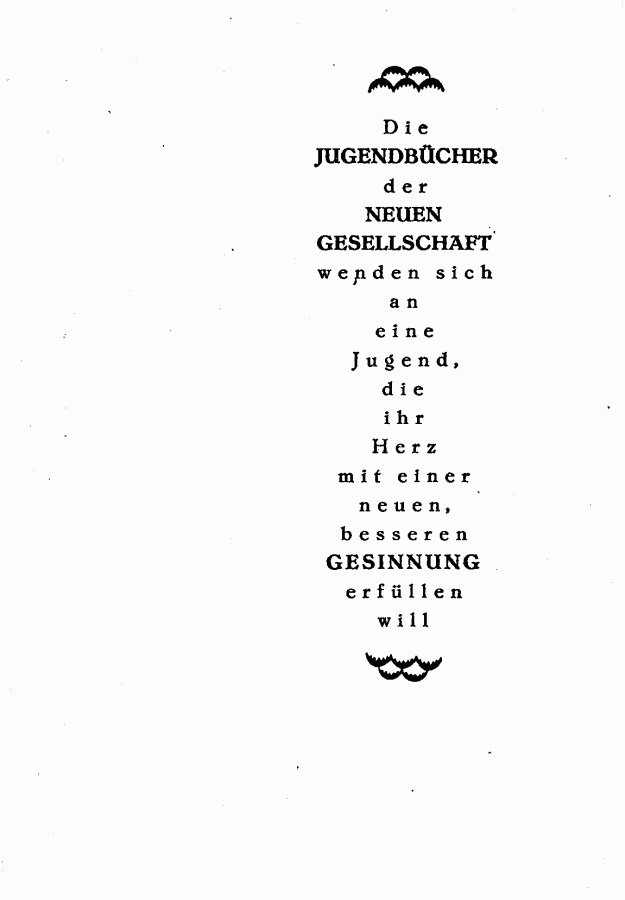
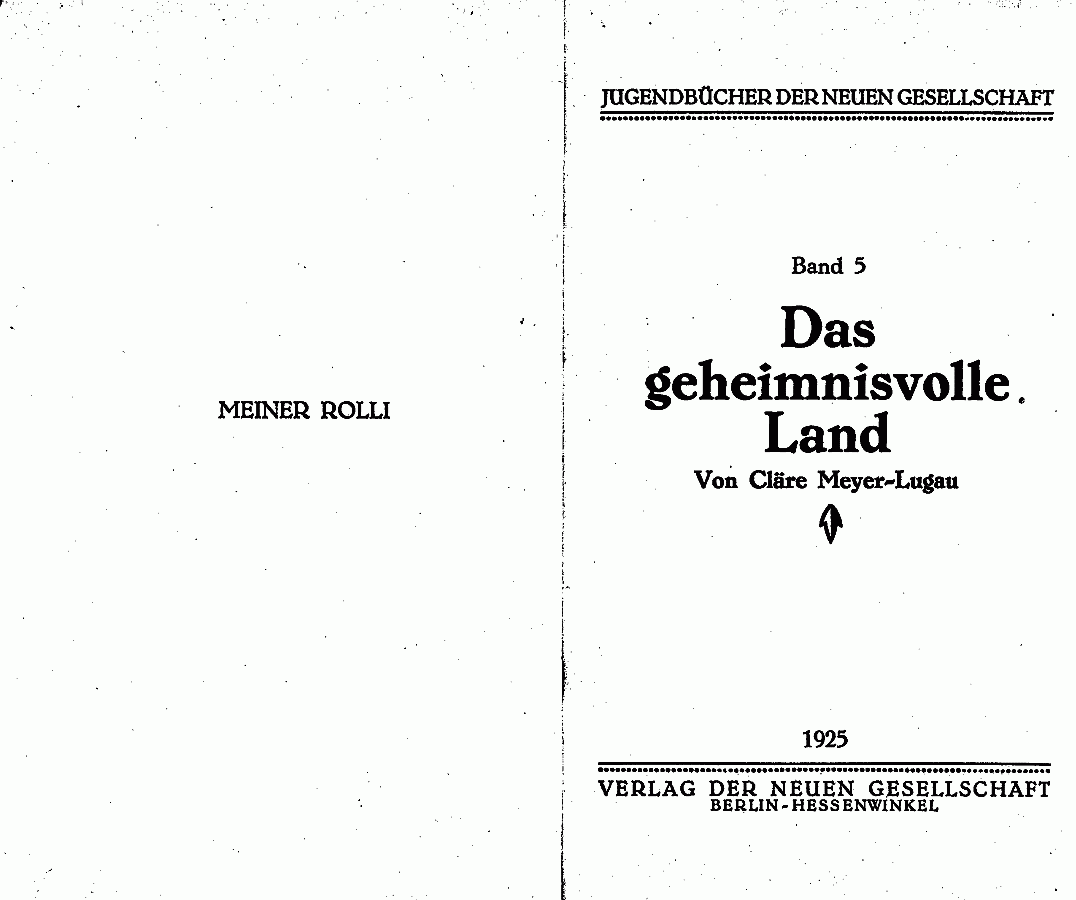
(Seitenzahlen im Text am Anfang der Seite in eckigen Klammern)
JUGENDBÜCHER DER NEUEN GESELLSCHAFT
Band 5
Das geheimnisvolle Land
Von Cläre Meyer-Lugau
1925
VERLAG DER NEUEN GESELLSCHAFT
BERLIN - HESSENWINKEL
Inhaltsverzeichnis
1. Teil: Die Tochter der Fee ......................... 05
2. Teil: Eine seltsame Landung .................... 14
3. Teil: Die ewigen Gärten und neue Wunder . 24
4. Teil: Der Baum der zwiefachen Frucht ....... 34
5. Teil: Das eherne Lied ............................. 44
6. Teil: Der stählerne Riese ........................ 52
7. Teil: Gerdas neue Heimat ....................... 58
8. Teil: Der Fluch des Goldlandes ................. 65
9. Teil: Die vergebliche Befreiung ................ 73
10. Teil: Am Urquell des Alls ....................... 80
11. Teil: Das ewig-neue, alte Lied ............... 88
12. Teil: Der fremde Gast ........................... 89
1. Teil.
Die Tochter der Fee.
Es war ganz früh am Morgen. Die Sonne hatte sich noch nicht aus ihrem Meeresbette erhoben, perlgraue Dämmerung goß sich aus der Schale des Himmels über die See und das Land der glücklichen Inseln und hüllte alles in mattes, grau-blau-sanftes Licht; tiefste Ruhe herrschte. Der Wind schlief und bewegte nicht ein Blättchen. Leise, schlaftrunken murmelnd rollten die kleinen Wellen an den Strand; sogar die Frühaufsteher, die beschwingten Sänger, hielten die Köpfchen noch tief in die Flügelfedern gesteckt. Die Gräser schliefen und auf ihnen die Tautropfen, ja, selbst die Wolken lagen ruhig im Himmelsbett.
Und doch wachte hier ein lebendes Wesen, das noch gar nicht hätte munter sein dürfen.
Auf einem Sandhügel des Strandes saß ein kleines Mädchen und sah sehnsüchtig und traurig aufs Meer hinaus. Es hatte das Köpfchen auf die schmale, weiße Hand gestützt, seine wirren Haare, fein und gelb wie Dünensand, fielen über das blasse Gesicht, während die großen Augen, die in allen Meeresfarben, vom lichtesten Blau bis ins tiefste Dunkel, spielen konnten, feucht wurden vom gespannten Hinaussehen.
War es schon sonderbar, daß ein so kleines Mädchen am frühesten Morgen hier ganz allein saß, so war es doch noch merkwürdiger, daß es sich nach etwas zu sehnen schien.
Sehnsucht war ein Gefühl, das sonst unbekannt an diesem Strande zu sein pflegte.
Das Land, das hier vom Meer umspült wurde, hieß die
[06]
„glücklichen Inseln”. Es war, wie viele Länder der Erde, grün und hügelig, im Sommer sonnengeküßt, im Winter schneegebettet, hatte Flüsse und Wälder, Wiesen und Felder, Berge und Täler, und war somit äußerlich wenig verschieden von anderen Erdstrichen. Und doch war es ein wunderbares Land, denn alle seine Bewohner waren glücklich. —
Von Geschlecht zu Geschlecht hatten die Menschen der glücklichen Inseln verstanden, einem Gesetze zu leben, das immer auf die gleichen, einfachen Lebensformen hielt.
Weder reich noch arm, waren sie gesund an Leib und Seele und daseinsfroh.
Alles Land gehörte Allen. Jeder arbeitete mit Freuden auf dem geliebten Heimatboden.
Feld-, Baum- und Wiesenfrüchte wurden gesammelt und Allen gleich zugemessen; alle Frauen des Landes bekamen die gleichen Mengen blaublühenden Flachses zugeteilt, jede setzte ihren Stolz darein, ihren Faden so fein und dünn wie Seide zu spinnen und sorgsam zu weben. Somit waren Alle einfach und doch kostbar gekleidet.
Jeder Mann, der sich eine Familie gründen wollte, baute sich sein Haus und fertigte sich seine einfachen Geräte selbst, doch nur die zum Leben nötigen, denn keiner tat Unnützes oder Ueberflüssiges.
So kam es, daß die Bewohner der glücklichen Inseln immer Zeit hatten, froh und gesellig zu sein, Musik, Tanz und Spiel und andere Künste zu pflegen. Im Sommer schafften sie, hart und froh, im Winter saßen sie in gemeinschaftlichen Hallen und feierten. Jeder steuerte zu den Festen bei, was er hatte an Gaben seines Geistes und Herzens. All diese Menschen waren so lebensselig, weil sie wußten, daß sie die Gesetze des Lebens erfüllten, und daß kein Wesen auf Erden glücklicher sein konnte als sie, die gesund waren und es leicht hatten.
Daher liebten alle Inselleute ihre Heimat mit glühendem Herzen. Keiner kannte die Sehnsucht, nicht ihre Süße, noch ihre Qual.
Mit dem kleinen Mädchen am Strande aber hatte es
[07]
seine besondere Bewandtnis. Es gehörte nur halb der Insel an. Der Vater der Kleinen war der Inselkönig, den die Gemeinschaft als Würdigsten zum Oberhaupt gewählt hatte, ihre Mutter aber war eine Fee gewesen, und sie selbst somit die Enkelin des mächtigen Geisterkönigs von Insulinde.
Und das war so gekommen.
Vor vielen Jahren dämmerte auch einmal so ein heller, totenstiller Morgen wie dieser herauf, da hatte der Inselkönig nicht schlafen können. Eine seltsame Unruhe, ihm fremd und unbekannt, scheuchte ihn von seinem Lager. Leise war er durch die hallenden, stillen Straßen geschlichen, um niemand zu wecken, und hinunter nach dem Strande gegangen, wohin es ihn mit unsichtbaren Fäden zog.
Da sah er auf demselben Hügel, auf dem seine Kleine jetzt rastete, eine Frau sitzen. Wie das Kind hatte auch sie den Kopf in die Hände gestützt, hatte auch ihr langes wirres Goldhaar den Sand gestreift. Aber ihr ganzer Körper zitterte, denn sie weinte bitterlich.
Der König, dessen Schritte auf dem Sande nicht zu hören waren, stand alsbald hinter ihr und berührte leise ihre Schulter. Sie fuhr heftig erschreckend zusammen, hob ihr schönes, tränenüberströmtes Gesicht zu ihm auf und schaute ihn furchtsam an. Als sie aber in sein gütiges Antlitz sah, faßte sie sofort Vertrauen, blickte ihn unergründlich an, und ihre Tränen versiegten.
In tiefem Schweigen sahen sie einander an, der König vermochte nicht gleich zu sprechen und auch die Fremde blieb stumm. Sie begann wieder leise zu weinen.
Der König wunderte sich, wie noch nie in seinem Leben, über das Erscheinen der fremden Frau. Er sah kein Fahrzeug, das sie gebracht hatte, er konnte sich nicht enträtseln, woher sie gekommen sein mochte. Noch mehr aber staunte er über ihre Kleidung.
Das Gewand der Fremden war aus feinstem Goldstoff, bestickt mit lauter kunstvollen Mustern und Ranken, alle golden, aber in vielen Abtönungen. Helles Goldgelb, tiefstes Goldrot, wie Abendsonnenglut, feinstes Goldgrün,
[08]
gleich dem der jungen Triebe des Vorfrühlings, leuchtete auf. Dazu war es über und über besät mit Edelsteinen und Perlen, die aus den gewobenen Blumen und Blütenkelchen hervorblitzten, und wirkte doch bei allem Reichtum nicht überladen, sondern ganz wie eine ihrer Schönheit würdige Hülle.
Die reine Stirn aber umzog ein Diadem aus funkelnden Steinen, darüber schloß sich ein Schleier, wie aus glitzernden Schneesternen, gewoben an hellen Wintertagen. Als sie sich jetzt emporrichtete, schwebte eine Wolke von Gold und Diamantstaub um sie her.
Da faßte sich der König.
„Willkommen auf den glücklichen Inseln!” begrüßte er sie. „Was bedrängt dich? Kann ich dir helfen?”
Die Unbekannte wunderte sich, daß der Mann vor ihr sie nicht fragte, wer sie sei und woher sie komme. Sie konnte nicht wissen, daß Neugier keine Eigenschaft der Inselbewohner war, aber Gastrecht eine Heimstätte bei ihnen hatte.
„Bin ich auf den glücklichen Inseln?” fragte sie.
„Das bist du,” antwortete der König, und konnte seine Augen nicht von ihr abwenden.
„Wer bist du?” fragte die Fremde weiter.
„Die Inselbewohner wählten mich zu ihrem König.” erwiderte ihr der Mann.
Die fremde Frau sah den Inselkönig ungläubig und groß an. Welch armes Land mußte das sein, wo ein König Arbeitskleidung trug wie ein Landmann. Aber es mußte doch so sein, wie er sagte, denn die Augen dieses Mannes waren klar wie die Wahrheit.
„O, König,” sagte sie daher sanft, „wie danke ich Dir für deine Teilnahme. Da ich in dein Land versetzt bin, und, wenn du mich duldest, auch hier bleiben möchte, so sollst du wissen, warum ich hier bin, und wie ich hierher kam.”
Und wieder stiegen ihr die Tränen in die Augen. Weh schluchzte sie auf, bezwang sich aber und fuhr fort:
„Wisse, ich bin Gerdarudana, Tochter des mächtigen Beherrschers des Geisterreiches Insulinde. Unsterblich
[09]
lebte ich bei den Meinen, mächtig gebietend über die Kräfte des Alls. Die Geheimnisse der Welt lagen offen vor meinem Blick. Ich schwang mich in die höchsten Regionen des Aethers, wo in schön geordneten Bahnen die Gestirne ihren ewigen Reigen schwingen und lauschte dem Gesange der Sphären. Zum Grunde des Ozeans tauchte ich, im Spiele den schnellsten Fisch zu haschen, oder erfreute mich am gewaltigen Treiben der Feuerriesen, die in der Tiefe des Erdballes, gefesselt durch Schicksalsspruch, Wärme und Gedeihen des Erdsternes hüten. Aber die Allmacht, die ich hatte, machte mich keck und übermütig, und eines Tages verging ich mich gegen die unumstößlichen Gesetze unseres Reiches. Spielerisch, mutwillig, löste ich die Ketten der Feuerriesen. Die wußten kaum, wie ihnen geschah. Jahrmillionen waren die Wilden gefesselt gewesen, nun tanzten sie einen tollen Reigen in der Freude wiedererrungener Freiheit. Herrlich stoben die Funken, tief leuchtete die Glut und ich jauchzte vor Wonne des Anblicks. Toller und toller wurde ihr Reigen, erst angstvoll, dann mit wachsendem Entsetzen merkte ich, daß ihre wilde Freude keine Grenzen mehr kannte. Höher und höher reckten sie sich, ihre geballten Fäuste stießen mit wildem Krachen gegen die Erdrinde, bis sie barst. Da stieg die Feuerlohe empor, glühende Ströme flossen über blühende Städte und grünende Saaten, in das wilde, kreischende Jauchzen der endlich Befreiten mischten sich die Angst- und Todesschreie der verzweifelnden, untergehenden Geschöpfe, letztes Röcheln von Mensch und Tier! Da schrie ich auf in namenloser Pein. Erzürnt stürzte mein mächtiger Vater herbei, bändigte die Kraft der Ungeheuren und fesselte sie mit doppelter Fessel. Ueber die sengende Glut blies er dahin, daß sie zu Lava erstarrte.
Mich aber würdigte der sonst so Gütige keines Blickes mehr. Ausgestoßen von den Meinen, ohne Gnade und Vergebung, der Allmacht und Sehergabe beraubt, wurde ich auf dem Rücken eines riesigen Geistervogels dahingetragen, Tag und Nacht, durch Sonnen und Monde, durch Raum und Zeit, und heute Nacht niedergeworfen an diesen Strand!”
[10]
Von neuem, über ihr Geschick verzweifelt, brach die Fee in schmerzliches Weinen aus.
Der König schwieg noch eine Weile still. Rührung und heißes Mitgefühl ließen ihn verstummen, endlich aber sagte er leise:
„Was hast du verloren, Aermste!”
Und wieder mußte er um Worte ringen:
„Nun aber mußt du dich fügen in das Unvermeidliche. Je williger du das tust, um so leichter wirst du das Schicksal ertragen. Willst du mit mir und meinem Volke leben, sei willkommen! Mein Haus sei dir Wohnung, mein Weniges dein! Aber auch bei uns gibt es Gesetze. Denn das Gesetz ist das Höchste. Durch das Gesetz wandelt sich das Chaos selbst in die Harmonie des Alls. Einfachheit und Gehorsam ist das Unsere; darum, willst Du mit uns leben, muß diese Pracht, die du an dir hast, dem Meere geopfert werden. Keiner darf hier besitzen, was der Andere nicht hat. Willst du dich dem fügen, dann kannst du bei uns bleiben!”
Die verstoßene Fee sah an sich herab und auf ihr Gewand, aber ihre Gedanken konnte der König nicht erraten. Er fühlte sein Herz erzittern bei dem Gedanken, sie möchte nicht einwilligen. Er liebte sie, seit er sie nur gesehen, die Reinheit ihrer Stirn, die kosmische Schönheit ihres Wesens war schon ein Teil seines Ichs geworden. Was sie auch verschuldet haben mochte, er hätte nicht mehr von ihr lassen mögen. Aber auch die Fee dachte, es sei unter guten und glücklichen Menschen besser zu leben und zu sühnen, als in der Einöde und gar unter Wilden und reißenden Tieren. So reichte sie dem König gesenkten Hauptes die Hand.
Da stieg die Sonne aus dem Meere empor und ihre Goldglut tauchte die herrliche Frau zum letzten Male in überirdische Pracht. Sie breitete die Arme gegen den strahlenden Morgenhimmel und in süßem, singenden Tonfall sprach sie fremde, unverständliche Worte. Dann wandte sie sich ab von Sonne und Himmel, und folgte dem König gesenkten Hauptes in sein Haus.
Hier reichte man ihr ein einfaches Linnengewand und
[11]
sie legte Stück für Stück ihrer Pracht ab. Man band die reichen Gewänder in ein Tuch, legte einen schweren Stein dazu, ruderte weit hinaus ins Meer und senkte dort die kostbare Last hinab. Nur einen ganz winzigen Gegenstand behielt die Fee für sich und versteckte ihn, ehe es irgend jemand bemerken konnte. Darauf sammelte der König sein Volk um sich, stellte ihnen die Fremde vor und bat mit warmen Worten, sie in die Gemeinschaft aufzunehmen. Das geschah gern. Sie schwor auf das Gesetz und war nun ein Kind der glücklichen Inseln geworden.
Seit diesem Tage blieb die Fee im Hause des Königs. Still fügte sie sich den einfachen Sitten, spielte mit den Kindern, webte mit den Frauen, plauderte mit den Mädchen, war immer ruhig und bescheiden, aber nie froh und lächelte nicht ein einziges Mal. Sie lächelte auch nicht, als ihr der König von seiner Liebe sprach, aber sie willigte ein, seine Frau zu werden und verbarg ihm, daß sie durch die Ehe mit einem Sterblichen ihre Unsterblichkeit verlieren mußte. Sie wollte ja nicht länger unsterblich sein. Sie lächelte selbst dann nicht, als ihr ein kleines Mädchen geboren wurde.
Gar zu sehr glich das kleine Wesen der Mutter, drum nannte man es nach ihr Gerdarudana; weil aber der Feenname viel zu lang war für solch winziges Geschöpfchen, wurde es einfach Gerda genannt.
Die kleine Gerda wuchs heran, gesund an Leib und Seele, und weiser als andere Kinder.
Das war nicht weiter wunderlich, saß sie doch viel zu den Füßen der Mutter. Diese, die Keinem, auch dem Gatten nicht, je wieder von ihrer Heimat gesprochen, erzählte dem kleinen Wesen oft unter Tränen von den Wundern des Reiches Insulinde, von dem mächtigen Geisterkönig, der über alle Kräfte gebieten konnte, und der ihr Vater war. Sie weihte Gerda ein in die Geheimnisse des Alls mit seinen, dem Menschenverstände unerschließbaren Wundern. Aber auch von fremder Schönheit und seltenen Zauberdingen erzählte die Fee, und von Pracht und Herrlichkeiten, die es auf den glücklichen Inseln nicht gab.
[12]
So kam es, daß die kleine Gerda ihre Heimat nicht so liebte, wie diese es verdient hätte, und daß sie sich sehnte, das ferne Feenreich kennen zu lernen. Das war aber nicht so schlimm und kein so dringender Wunsch, solange die Mutter lebte, denn bei der Mutter war das Feenreich.
Aber die Mutter wurde immer stiller und trauriger. Sie fühlte, daß sie nicht länger leben könne, Sehnsucht brach ihr das Herz. An diesem geheimen Kummer erkrankte sie lebensgefährlich. Tag und Nacht wachten Gatte und Tochter an ihrem Lager, aber die Fee war schon weit, weit fort von den Ihren. Einmal erwachte sie noch. Der König hatte gerade das Zimmer auf Augenblicke verlassen. Hastig zog sie die kleine Gerda an sich und flüsterte:
„Oeffne die Truhe, Kind, dort liegt etwas, was ich dir geben will. Bringe das Kästchen! Nein, nicht dieses, das goldene!”
Mit müden Händen öffnete sie ein kostbares, kleines Kästchen und entnahm ihm eine winzige, goldene Leier. Wie sie sie in die Höhe hob, wuchs sie und gab einen leisen, wundervollen Klang. Doch die Fee senkte sie wieder. Da wurde sie klein und kleiner und paßte wieder in das Kästchen hinein.
„Höre, geliebtes Kind,” sagte die Kranke, „diese Leier bewahrte ich mir, heimlich, gegen das Gesetz, als mein Feengut versenkt wurde. Ich wußte, ich tat nichts Unrechtes damit. Nun werde ich sie nie mehr brauchen und du sollst sie haben. Für keinen Menschen hat sie einen Wert oder eine Bedeutung, wenn du aber, Enkelin des mächtigen Geisterkönigs und Tochter der Fee, darauf spielen wirst, so wird dir die Sprache der stummsten Dinge lebendig und du wirst das Herz der Weltseele pochen hören. Gib acht, daß die Stimme der Weltharmonie klangvoll zu der deines eignen Herzens tönt. Auch wird dir diese Leier Stimme leihen zu dem, was dich bewegt. Möge sie nur dem Liede der Liebe tönen, der Süße und der sanften Sehnsucht, nie aber der Qual, des Schmerzes oder gar der bitteren Reue. Möge dir ihr Lied ein Trost sein, wie sie mich oft tröstete in einsamen Nächten, wenn der König schlief. Trage sie immer bei
[13]
dir, du wirst sie brauchen, wenn du einst die Heimat gefunden!”
„Werde ich nicht immer auf den glücklichen Inseln weilen?” fragte erstaunt Gerda, denn sie wußte, daß es verboten war, die glücklichen Inseln zu verlassen. Keiner, der je hier fortging, durfte wiederkehren.
„Als ich mich einem Sterblichen vermählte, wurde ich selber sterblich und verlor die Gabe, in die Zukunft zu sehen. Ueber das Meer kommt dein Schicksal, mehr kann ich dir nicht sagen, trage es freudig und ergeben!”
Die kleine Gerda war ganz erregt und hätte gern noch mehr gefragt und gewußt, aber da trat der König wieder ins Zimmer. Die Kranke legte sich nun erschöpft ins Kissen zurück und schloß die schönen Augen. So lag sie noch ein paar Tage.
Dann aber öffnete sie hell ihren Blick und flüsterte wieder süß und halb singend die seltsam fremden Worte, mit denen sie von ihrer Heimat Abschied genommen, breitete ihre Arme aus, lächelte über das ganze Gesicht und war entschlummert. Ihre Seele war heimgeflogen ...
Nun war die kleine Gerda allein auf der Welt, denn der untröstliche König suchte die Einsamkeit. Sie wurde wie die Mutter immer stiller und innerlich unglücklicher. Jeden Morgen vor Tagesgrauen schlich sie an den Strand hinunter, auf das Schicksal wartend, das übers Meer kommen sollte.
Und so saß sie auch heute ....
[14]
2. Teil.
Eine seltsame Landung.
Jetzt tauchte die Sonne aus dem Meere auf und ihr Rosenlicht erfüllte Himmel und Erde. Langsam stieg sie höher und höher, wurde heller und heller, warf goldene Pfeile nach den Morgennebeln, daß sie in Licht zerrannen und der Tag goldenblau heraufzog. Die Fülle von Licht, die der Himmel ausstrahlte und Meer und Sand zurückwarfen, hatte etwas Nüchternes gegenüber der süßen Verträumtheit der Dämmerung.
Obschon es viel wärmer geworden, erhob sich die kleine Gerda dennoch fröstelnd und enttäuscht, um den Heimweg anzutreten. Auch heute war das Schicksal wieder nicht gekommen.
Plötzlich blieb sie wie gebannt stehen. An dem hellen Horizont zeigte sich etwas Dunkles, das mit ungeheurer Schnelligkeit auf die Insel zusteuerte. Es kam näher und näher. Ein Schiff konnte es nicht sein, das hatte nicht diese Riesengröße. Denn, obschon das schwimmende Etwas noch ganz weit draußen im Ozean liegen mußte, erfüllte es doch schon den Rand, an dem Himmel und Meer sich begrenzten, mit einer langen dunklen Linie, soweit das Auge reichte.
Gerda, deren Augen falkenscharf waren, erkannte zu ihrem Erstaunen, daß da draußen ein ganzes, ungeheures Land schwamm. Nein, es schwamm nicht, es mußte gesteuert werden, denn zielsicher kam es der Insel näher. Als es aber fürchten mußte, auf zu flache Meeresstellen zu geraten, machte es plötzlich Halt und blieb liegen.
Die kleine Gerda war aber nicht die Einzige, die den schwimmenden Koloß bemerkt hatte. Der graue Strand
[15]
füllte sich allmählig mit Menschen, die alle mit gespannter Aufmerksamkeit nach dem schwimmenden Lande hinübersahen, unter ihnen auch der König. Sein Gesicht war tiefernst und fast traurig, und da er nicht sprach, wagte auch kein Anderer eine Aeußerung. So stand die Menge, stumm, ernst und in großer Erwartung.
Auf dem schwimmenden Lande wurde jetzt eine fieberhafte Tätigkeit entwickelt. Kähne in allen Größen wurden von der steilen Küste ins Wasser gelassen, Ruder ausgelegt, Segel aufgesetzt, Mannschaften hineingeladen, Körbe und Geräte verstaut. Auf dem Lande selbst sah man hohe Stangen, an denen wurden bunte Tücher hochgezogen, was einen farbigen, lustigen Anblick gewährte. Blitzschnell ging dies alles. Zischend spritzte der Schaum am Bug empor, weiß zog er in langen Streifen den Booten nach. Alles ruderte dem Strande der glücklichen Inseln entgegen. Als die Boote nahe genug waren, sprangen die Ankömmlinge ins seichte Wasser, zogen die Kähne nach sich und pflockten sie an.
Man konnte sich nichts Wunderlicheres denken, als die Menschen, die sich jetzt sehen ließen. Sie waren furchtbar und lächerlich zu gleicher Zeit. Furchtbar, weil sie sich Feuermänner nannten. Blitze schossen aus ihren Augen, und Feuer konnte aus ihrem Munde ausgehen, das alles verzehrte, wenn sie in Wut gerieten. Leicht aber war ihr Zorn entfacht. Dann brachen Strahlen aus ihren Händen hervor, die alles vernichteten und töteten, weit umher. Dazu waren diese Feuermänner putzig gekleidet, bunt wie die Vögel des Südens mit vielfarbigem Tuche. Am Halse und auf der Brust aber hatten sie Kinderspielzeug, bunte Bänder, Sterne, Monde und Kreuze, auf die sie besonders stolz zu sein schienen, denn sie bekamen diese Orden, wie sie die bunten Sachen nannten, von ihrem Könige, wenn sie recht wild und grausam gewesen waren und weder Feind noch Fremdling geschont hatten. Aber das alles galt nur von den vornehmen Feuermännern. Die Niederen, obschon viel größer an Zahl, hatten ein schreckliches Los. Furchteinflößend, waren sie doch nichts als Sklaven der Vornehmen, die jede Willkür
[16]
und Laune schrecklich an ihnen ausließen. Wohl murrten die niederen Feuermänner, aber die Sklaverei lag ihnen so im Blute, daß sie nichts taten, ihr Schicksal zu ändern. Und es gab viele Tausende von ihnen auf dem schwimmenden Lande.
An die Feuermänner schloß sich eine Gruppe Handelsherren; auch sie waren gekleidet wie Pfauen, strotzend von leuchtenden Farben, und ihnen folgten Arbeiter, die eine schmutzige, zerlumpte Hose trugen, den Oberkörper nackt. Die mühten sich, schwere Körbe an den Strand zu schleppen.
Als die Boote leer waren, ordnete sich der Zug und man stellte sich den Inselbewohnern gegenüber auf.
Hochmütig sahen die Ankömmlinge auf die einfachen Menschen in Werktagstracht.
Jetzt trat der Anführer der Feuermänner hervor. Er war über die Maßen prächtig anzuschauen, stolze Federn nickten von seinem Kopfe über einem Helm mit goldener Spitze. Er fragte barsch:
„Wo sind wir hier?”
„Auf den glücklichen Inseln heiße ich euch willkommen.” sagte jetzt der Inselkönig, sich aus der Menge lösend.
„Das sind die glücklichen Inseln?” meinte der Vornehme.
„Sehr glücklich sehen sie nicht aus, eher ärmlich,” fuhr er fort, die Menge aufmerksam messend, „habt ihr ein Oberhaupt, einen König, wo ist er, daß ich mit ihm rede!”
„Er steht vor euch,” sagte dieser.
Der Vornehme musterte den König geringschätzig, verbarg aber sorgfältig seine Gedanken. Ein Volk mit sonderbaren Sitten, dachte er innerlich.
„Wisse, König der glücklichen Inseln, begann er, daß unser schwimmendes Land sich auf der Suche nach dem Goldlande befindet. Die glücklichen Inseln suchten wir nicht. Da wir aber den Weg ins Goldland nicht kennen, besuchen wir jedes Land, was wir auf unserer Reise antreffen, um von ihm den Weg ins Goldland zu erfragen. Da haben wir denn noch überall etwas gefunden was wir
[17]
brauchen konnten, nur den Weg ins Goldland konnte uns keiner sagen. Wißt ihr ihn vielleicht?”
„Nein, Herr, auch haben wir noch nie von einem solchen Lande gehört.”
„Das konnte ich mir denken! Aber es macht nichts. Wir sind nun hier, und wenn es bei euch nicht aussieht, als wäret ihr ein reiches Land, so kann das täuschen. Sicher habt auch ihr Schätze, die unsere Handelsherren eintauschen können, denn wovon solltet ihr sonst leben? Was also könnt ihr geben?”
Der Inselkönig blickte die Eindringlinge an. Sie kamen aus einem reichen Lande, das war gewiß. Aber auch aus einem unersättlichen, das war gewisser. Ihre Gesichter sprachen eine beredte Sprache, daß ihre Schätzegier keine .Grenzen kannte.
„Verzeiht,” entgegnete der Inselkönig, „aber wir haben nichts, was wir einhandeln können. Wir haben nur, was wir brauchen.”
Der vornehme Feuermann unterbrach den König ungeduldig:
„Grün ist Euer Land, da habt Ihr Wälder, das bedeutet Hölzer im Ueberfluß. Habt Ihr nicht Tiere darin? Also, edles Rauchwerk die Menge. Wohnt Ihr nicht auch am Meere? Da fischt man nach Perlen und Schätzen der Tiefe. Ist Euer Land nicht bergig? Da wachsen die Gold- und Silberadern. Wie könnt Ihr arm sein?”
Da lächelte der König.
„Bei uns wird nicht gefischt, und wirft das Meer freiwillig Schätze aus, so werden sie dem Meere zurückgegeben. Wir besitzen kein edles Rauchwerk, denn wir jagen und töten kein Tier. Das Raubtier, aus Notwehr erschlagen, wird sofort vergraben, so will es unser Gesetz. Wir haben auch keine edlen Hölzer, denn wir schlagen nicht mehr, als wir für unsere Notdurft brauchen. Heilig ist uns der schattende Baum, darum ist unser Land so grün und saftig.”
„Aber Jünglinge habt Ihr, stark und mutig, wehrhaft und kühn! Gebt sie uns, wir machen Feuermänner aus
[18]
ihnen, dann haben sie es gut und sind geborgen. Reiche Beute, Ehre und Ruhm wartet ihrer!”
Ein schwacher Schrei durchzitterte die klare Luft! Mit Entsetzen traten die Inselbewohner zurück. War es möglich, es gab Völker, wo Menschen gehandelt wurden? Hatten sie sich getäuscht? So etwas konnten sie nicht glauben.
Der stolze Feuermann vermochte nun seine Verachtung nicht länger zu unterdrücken. Er sah auf die Einwohner der glücklichen Inseln herab und es zuckte durch sein Hirn, daß er nur zu befehlen brauche, um diesen waffenlosen, wehrlosen Menschen alles zu nehmen, die Jünglinge, die Wälder, die Tiere, die darin hausten und die Schätze des Meeres. Doch die Inselbewohner standen ruhig da. Sie schienen das nicht zu fürchten. Fest sah der König dem Stolzen in die Augen. Da zerrannen seine Gedanken. Unter dem hohen, sittlichen Willen des Inselkönigs brachen sie, wie eine dünne Eisrinde, die mutwillige Kinderfüßchen zerstampften. Verwirrt trat der Feuermann zurück.
„Nochmals heiße ich euch willkommen,” sagte der Inselkönig mit edler Würde. „Findet ihr auch nicht, was ihr sucht, so bitte ich euch doch zu verweilen und als unsere Gäste ein Fest mit uns zu feiern.”
Er wandte sich zu den Seinen und bedeutete ihnen, sich zu schmücken und den Festplatz vorzubereiten. Dann nahm er seine Tochter, die tief verwundert zugehört und alles mitangesehen, an die Hand, um den Gästen voranzugehen. Diese ließen die Arbeiter und die niederen Feuermänner als Wachen bei den Körben zurück, obschon sie nicht wissen konnten, daß hierin eine Beleidigung ihrer Wirte lag. Es gab Niemanden auf den glücklichen Inseln, der etwas an sich nahm, was ihm nicht gehörte.
Die vornehmen Feuermänner ordneten sich nun zu einem Zuge und schritten strammen Schrittes hinter dem Könige her, während ihnen die Handelsherren, laut schwatzend und lässig durch die geraden, sauberen Straßen folgten, vorbei an den Häusern, die sich alle so
[19]
ähnlich waren. Keines war größer als das andere, jedem sah man an, daß es Fleiß, Liebe und Freude erbaut hatte.
Endlich gelangte man zu dem Festplatze, einer saftiggrünen, großen Wiese, von schattigen Bäumen umrahmt. Auf diese hatte man Holztafeln aufgestellt, über die man das feinste Linnen breitete. Irdenes Geschirr war dort gedeckt, mit Sorgfalt gearbeitet, künstlerisch in Farben und Mustern. Die Feuermänner und Handelsherren wurden nun zu Tische gebeten, und da für das ganze Inselvolk nicht Platz gewesen wäre, nahmen die zwölf ältesten Männer am Male teil. Schöne junge Mädchen, Blumen im Haare, reichten ihnen feine Kuchen, Obstsaft und Früchte.
Die kleine Gerda, die an der Hand des Vaters dahinschritt, wurde von dem Anführer der vornehmen Feuermänner leutselig angeredet. Sie antwortete höflich und bescheiden und das gefiel dem Stolzen, so daß sie dreister wurde und nun ihrerseits zu fragen anfing.
„Kann dein Land schwimmen, wohin es immer will?”
„Gewiß kann es das!”
„Wirklich? Aber muß es sich nicht der Strömung des Meeres anvertrauen, so daß es doch nicht hinkommen kann, wohin es möchte?”
„Es kann überall hinkommen,” belehrte der vornehme Feuermann, „es schwimmt nicht, es steuert. Riesenmaschinen treiben es dahin. Wisse, einst war es festgewachsen auf dem Grunde des Ozeans, wie andere Länder der Erde auch. Aber da kam uns aus altersgrauen Zeiten die Kunde, daß es auf Erden ein Land gäbe, welches das Goldland hieße. Gold decke anstatt Erde seinen Boden, blitzend höben sich seine Berge gen Himmel, aus Saphir, Rubin und Diamant. Wasserfälle brächen aus ihnen hervor, aber sie sprühten nicht Tropfen, sondern runde, reine Perlen von unsagbarem Glanze. Und alle Bäume, die dort wüchsen, alle Blumen, die dort blühten, seien aus buntem Edelstein, und alles über alle Maßen kostbar und herrlich.
„Und um dieses Goldland zu suchen, um seine Schätze zu gewinnen, ließen wir unsere Arbeiter graben und
[20]
graben, Jahrhunderte lang. Kluge Maschinen erfanden wir, wie sie die Welt noch nicht gesehen, und als wir das ganze Land losgeeist hatten vom Mutterschoße der Erde, steuerten wir los, daß wir das Goldland fänden. Viele Länder trafen wir schon, viele kostbare Schätze bargen sie, wir nahmen sie alle. Aber noch immer haben wir das Goldland nicht gefunden.”
„Dann kommt ihr auch nach Insulinde,” rief Gerda lebhaft.
Der Führer kannte Insulinde nicht, aber er wollte sich einem so kleinen Mädchen gegenüber keine Blöße geben und erwiderte:
„Wir kommen überall hin!”
„Kommt ihr bald nach Insulinde?”
„Sicher sehr bald.”
Da war es der kleinen Gerda, als fielen ihr Schuppen von den Augen. Was konnte ihre liebe Mutter gemeint haben, mit dem Schicksal, das übers Meer käme, wenn es nicht dies schwimmende Land sei, das auch nach Insulinde führe? Aber würde der stolze Mann sie mitnehmen? Gewiß nicht, denn ihr Vater würde sie nicht ziehen lassen. Sie war seine Einzige, der Mutter Ebenbild, sie war noch unerfahren, so klein und jung, sie konnte nicht allein in die weite Welt hinausziehen. Auch verbot das Gesetz, die glücklichen Inseln zu verlassen. Wer sie dennoch verließ, der konnte nie wieder heim, war verbannt auf ewig.
Aber die kleine Gerda war die Tochter der Fee, die sich durch ihren Uebermut selbst aus dem herrlichen Geisterreich ausgeschlossen, und die wilde Entschlußkraft der Mutter lebte auch in Gerdas Herzen. Das Gebot, sich willig dem übers Meer kommenden Schicksale zu fügen und eine Sehnsucht nach dem Unbekannten war stärker in ihr, als das Gesetz der Heimat, und sie beschloß, die glücklichen Inseln heimlich zu verlassen. Ohne, daß man weiter auf sie achtete, entfernte sie sich aus dem Kreise der Gäste. Ihr Entschluß war gefaßt.
Das Fest begann. Das Mahl war nicht nach dem Geschmacke der Feuermänner. Sie waren gewöhnt an das
[21]
Fleisch der Tiere und das Feuerwasser der gegorenen Früchte. Weil sie aber hungrig waren, ließen sie sich die reizlose Kost munden. Dann trug man ab, und nun nahte das ganze Inselvolk in seinen Festgewändern, feierlich in weißem Linnen strahlend. Man setzte sich zwanglos im Kreise umher und die Spiele begannen.
Jünglinge und Mädchen, Blumen und Blüten tragend, drehten sich in rhythmischen Reigen, und Kinder sangen dazu mit ihren lieblichen, klaren Stimmchen. Sanfte Klänge wurden Harfen und anderen Instrumenten entlockt. Die Männer aber trugen Dichtungen vor vom sittlichen Gesetze des Menschen, besangen das Leben der Tiere im Walde und den Lauf der Gestirne im ewigen Wechsel der Zeiten; ergötzten mit Lobliedern auf die Allmutter Natur, die gütig-grausame, die geheimnisvoll-klare, die unerforschlich-gesetzmäßige. Sie, die gekleidet ist in das Sternenkleid der Erhabenheit, gehüllt in Wolkenschleier, die den Fels gründet und stürzen läßt, ihre Geschöpfe mit Wohltaten überhäuft und im Elend verkommen läßt, ihre Kinder zeugt und tötet.
„Habt ihr keine Heldengesänge?” fragten die Feuermänner.
„Gewiß”, sagte der König.
Da sangen die Männer ein Lied von einem Manne, der freiwillig hinausging, ein Meerungeheuer zu töten und nicht wiederkam. Der sich opferte, damit die Seinen verschont wurden. Und sie sangen ein zweites Lied; da war ein Jüngling, der opferte sich für seinen Feind, damit ihm kein Leides geschähe. Der aber wurde dadurch so erschüttert, daß er abließ vom Bösen und mit Wohltat vergalt. All dies war lange her und ragte in altersgraue Zeiten, aber wie dieser Jüngling zu handeln war Jeder bereit auf den glücklichen Inseln.
Doch die Feuermänner waren nicht zufrieden. Nein, Heldenlieder von kühnen Kämpen wünschten sie.
Die kannte man nicht auf den glücklichen Inseln; kämpfen und töten galt dort als Todsünde vor dem Gesetze. Da erhoben sich die Feuermänner, blitzten und donnerten und ließen dröhnende Schlachtlieder erschallen.
[22]
Sie rühmten sich der Feinde, die sie grausam erschlagen, der Frauen, die sie geraubt, der Kinder, die sie nicht geschont, der Greise, die sie gefangen und verschleppt, der Jünglinge und Jungfrauen, die sie zu Sklaven gemacht, des Gutes, das ihnen zugefallen, des Viehes, das sie umgebracht, der Höfe, die sie eingeäschert, der Länder, die sie verwüstet und der blühenden Städte, die sie dem Erdboden gleich gemacht hatten.
Die Inselbewohner hörten schweigend zu mit gesenkten Häuptern, Tränen zitterten an ihren Wangen. Sie schämten sich ihrer Gäste, wagten aber aus Gastlichkeit nicht, es sich merken zu lassen.
Dann neigte sich die Sonne und das Fest war zu Ende. Die Fremden zogen nach dem Strande und die Inselbewohner mit ihrem Könige gaben ihnen das Geleit.
Tief stand die Sonne und legte eine goldene Brücke nach dem schwimmenden Lande hinüber, eine gleißende, verführerische, wie einen Weg ins Land der Verheißung.
Auf einen Wink des vornehmen Feuermanns schleppten nun zwei Arbeiter einen Korb herbei, gefüllt mit Kostbarkeiten, Goldgerät, Schmuck, Seide und Silber und der Anführer sprach:
„König der gastlichen, glücklichen Inseln, nimm dies Andenken an die Bewohner des schwimmenden Landes Eurasia, zum Zeichen der Freundschaft und des Dankes.”
Der Inselkönig neigte sich und entgegnete:
„Dank auch Euch, Herr, für Eure große Freigiebigkeit und Güte. Doch verzeihet und zürnet uns nicht, wir dürfen Euer Gastgeschenk nicht annehmen, das verbietet uns unser Gesetz. Keiner darf auf dieser Insel mehr besitzen, als was seines Leibes und Lebens Notdurft ausmacht, und Keiner wünscht sich mehr. Für Schätze dieser Art haben wir keine Verwendung.”
„Es liegt uns fern, gegen Euer Gesetz zu verstoßen”, sagte der Feuermann. Aber in den Augen der Handelsherren glomm Genugtuung auf, ihre Schätze behalten zu können.
„Lebet wohl!”
Jetzt wurden die Kähne flott gemacht, Feuermänner,
[23]
Handelsherren und Gefolge, sowie die nackten Arbeiter mit sich führend.
Lange sahen die Inselbewohner ihnen nach. Sie warteten, bis auch das schwimmende Land sich in Bewegung setzte und sich von ihrem Horizonte entfernte.
Wie von einem Alpdruck erwachend, erlöst, froh, die sonderbaren Gäste los zu sein!
[24]
3. Teil.
Die ewigen Gärten und neue Wunder.
Niemand ahnte, daß die Feuermänner, ganz gegen ihre Absicht, ein lebendes Geschöpf von den glücklichen Inseln mitnahmen, das sich durch diese Flucht die Rückkehr in die Heimat für immer verschloß.
Tief versteckt zwischen Körben und Geräten kauerte in einem der Boote die kleine Gerda und wartete mit fiebernder Wange und klopfendem Herzen, daß sich das Boot in Bewegung setzen möge. Da draußen, das ungeheuere schwimmende Land war ihr Schicksal, das wußte sie jetzt. Es steuerte nach ihrer Seelenheimat, nach Insulinde. Dort würde sie die Ihren finden, die Geister, die ihrer Seele verwandt waren, drum beugte sie sich gern unter der Mutter Gebot.
Und doch, wie bitter weh tat es ihr in der Brust! Sie dachte an den Kummer ihres Vaters, an die frohen Stunden der Kindheit, an der Mutter Grab, das sie nicht mehr pflegen würde. Alle Bäume und Gräser, ja selbst der ewig gelbe Strand, der jetzt feucht war von der zurückgetretenen Flut und in dem sich die Abendwolken spiegelten, erschien ihr in neuem Lichte, schöner denn je, so nie gesehen und doch so wohlbekannt. Draußen lockte das Neue, Unbekannte, hier hielt das Süßgewohnte fest, und Gerda war froh, als der Boden unter ihr zu schwanken begann und sie den quälenden Vorstellungen und Zweifeln entriß. Nun gab es kein Zurück mehr.
Lange schaukelte das Boot auf den grünen Wogen. Die Sonne war schnell gesunken, die goldene Brücke abgebrochen, aber jetzt wurde das Wasser hell, wie von innen erleuchtet, heller als selbst der noch rosige Himmel.
[25]
Aber der Himmel wurde gelblich und flaschengrün, das Licht des Meeres erlosch und noch immer lag das schwimmende Land weit draußen, wo das Meer in große Tiefen reichte. Der Abendstern schimmerte schon auf, als plötzlich das Boot einen wilden Reigen zu tanzen begann, weil große, schaumgekrönte Wellen an dem Landungeheuer emporspritzten. Feuermänner schrieen Befehle, Arbeiter grölten Antwort, die Handelsherren kreischten, Taue fielen herab, alles wurde emporgehoben, Menschen, Körbe und endlich die Boote selbst. Einer der Körbe war leer und Gerda kroch in ihn hinein.
Sie lugte heraus und es befiel sie ein leichter Schwindel. Hoch schwebte sie zwischen Himmel und See auf endloser Luftreise. Tief unter ihr rauschte die Flut der Wogen, aber so bewegt sie auch waren, von hier oben sah es aus, als ob es eine fast ruhige Fläche wäre, und wenn sie aufwärts blickte, sah sie noch immer keinen Boden vor sich, so steil war die Küste des schwimmenden Landes. Endlich kam sie oben an und der Korb wurde geöffnet.
„Das ist ja eine schöne Bescherung”, rief der Arbeiter, der Gerda heraushob. „Glaubst Du vielleicht, wir können nochmals Stunden um Stunden zurückrudern, um Dich Ausreißerin den besorgten Eltern wiederzubringenl Krabbe, verfluchte! Na, das kann schön werden!”
„Ich will aber gar nicht zurück”, verteidigte sich Gerda. „Ich bin auch nur mitgekommen, weil der Mann mit den vielen Sternen mir versprochen hat, daß er mich zu meinem Großvater nach Insulinde bringen will. Sei nicht böse, und lasse mich, bitte, bitte, hier!”
Sie hatte plötzlich solche Angst, zurückzumüssen, daß sie fast dem Weinen nahe war.
„Na, wenn Du wo anders hingehörst, mir kanns Recht sein”, meinte der Arbeiter besänftigt.
„Lauf aber zu, hier können wir Dich nicht brauchen.”
Da stand nun die kleine Gerda, bei hereinbrechender Nacht, mutterseelenallein auf fremdem Boden, fern der Heimat, unbekannt und verlassen. Aber Unentschlossenheit war keine Eigenschaft des Feenkindes. Sie beschloß,
[26]
sich zuerst mal das schwimmende Land anzusehen und sich einstweilen ein Unterkommen zu suchen, bis man nach Insulinde kommen würde. Dann sollte es ihr ein Leichtes sein, sich zum Geisterkönige durchzufragen. Erkennen würde der sie schon, war sie doch der Mutter Ebenbild.
Tapfer ging sie landeinwärts, aber bald vergaß sie alles um sich her.
Wachte sie? Träumte ihr bloß? War sie vielleicht schon im Feenlande? Ja, so mußte es sein, denn ein Land der Erde war sicher nicht so prächtig.
Die kleine Gerda war noch gar nicht lange gegangen, vorbei an dem lampenbeleuchteten, geschäftigen Landungsplatz, als sie an eine Mauer gekommen war, in der ein goldenes Tor halboffen stand. Sie durchschritt es, weil eine Fülle von Licht durch die goldenen Stäbe drang, als sie in maßlosem Erstaunen stillstand. Sie befand sich in einem Riesengarten, der mit großer Kunst und Sorgfalt angelegt war. Auf großen Beeten, die allerlei künstliche Figuren darstellten, prangten Blumen und Blüten in nie gesehener Fülle und in so üppig leuchtenden und brennenden Farben, wie sie auf den glücklichen Inseln nicht anzutreffen waren. All diese Blumen hauchten einen sonderbaren, süßen und schwülen Duft aus. Der Rasen aber war wie ein Teppich, doch sein Grün war so eigenartig, wie es in der Natur nicht vorkam. Gerda trat näher und berührte ihn und die Blüten. Sie traute ihren Augen kaum, diese Blumen waren kühl und seltsam ihre Berührung, sie waren künstlich gefertigt aus einem fremden, unbekfnnten Stoffe. Marmorbänke standen umher, auf denen lagen Ruhekissen aus Sammet und Seide, mit Gold und Silberbrokat bestickt, und vor ihnen breiteten sich weite Becken mit Springbrunnen. Golden fiel das Wasser in alabasterne Schalen. In kleinen Hallen saßen Musikanten, die ließen süße, sinnbetörende Weisen ertönen, die Herz und Hirn verwirrten.
In all dieser Pracht wogten Menschen auf und nieder, saßen auf Bänken oder lagerten auf dem grünen Teppich des künstlichen Rasens. Sie hörten der Musik zu, ergötzten
[27]
sich mit allerlei Spielen oder aßen feine Kuchen und tranken edle Weine aus dünnen, zarten Gläsern.
War der Garten schon ein Zauberland, so waren die Menschen, die hier lebten, noch viel märchenhafter. Sie waren gekleidet in Goldstoffe, die mit Perlen und Edelsteinen wie übersät waren, und darüber trugen sie noch die kostbarsten Pelze aller Tiere der Erde. Ihre Schuhe waren aus feinstem Leder, reich verziert, und auf dem Kopfe prangten Hüte mit ganzen, schillernden Vögeln, Blüten, Blumen und Bändern. Eine Fülle von Licht, das sich über die Dahinwandelnden ergoß, ließ all diese Kostbarkeiten heller ergleißen, und Gerda war es, als erstrahlten nicht eine, sondern viele Sonnen am Himmel. Dabei war es nicht sonderlich warm, nur mild und angenehm, und so richtete Gerda den Blick nach oben. Erstaunt und geblendet mußte sie sich abwenden, denn der Himmel über ihr war ebenfalls künstlich, purpurschwarz und behängt mit Tausend und aber Tausend Lampensonnen. Hier gab es kein Wetter, weder Regen noch Kälte, weder Tag noch Nacht, weder Wolken noch Stürme und keinen Wechsel der Jahreszeiten. Daher mußten auch die Blumen künstlich sein, weil die lebenden Frühlings-, Sommer- und Herbstkinder ja im Lampensonnenscheine nicht gedeihen können.
Alles hatte hier Dauer, Ewigkeit, Beständigkeit: das Licht, das Wetter, die süße Musik und die ewigen Feste.
Mitten in die Gärten hinein mündete eine lange Straße, durch die gleichfalls die geputzte Menge hineinflutete und sich überall herandrängte, wie ein Fliegenschwarm um besonnte Fensterscheiben. Auch Gerda ging in diese Straße hinein, sie sah hinunter, wo die Häuser fast zusammenliefen im Blickfeld, und es schien ihr, als nähme die breite Straße kein Ende.
Das war die Wunderstraße der tausend Glashäuser, denn alle Häuser waren aus geschliffenem Glas und man konnte in sie hineinsehen.
Alle Schätze der Welt lagen hier aufgestapelt in unabsehbaren Mengen. Die Häuser wölbten sich, daß man ihr Dach nicht sehen konnte. Jedes barg etwas anderes. Eines
[28]
war ganz ausgefüllt mit Gold, Silber und Edelsteinen, zu zierlichem Schmuckwerk gefaßt. Gerda mußte sich über diese Fülle wundern, denn die Menschen, die begehrlich in dieses Haus hineinsahen, waren schon so behängt mit Schmuck, daß man sich gar nicht denken konnte, daß sie noch mehr tragen könnten. Und doch wurden hier Schätze für Unzählige geborgen. Dann folgte ein Glashaus, das war vollgestellt mit Kleidern aus Goldstoff, Spitzen und Pelzwerk. Kleider für viele Menschen auf viele, viele Jahre. Dann kam ein Haus voll seltsamer, blinkender Geräte. Gerda hatte solche nie gesehen und wußte nicht, wozu man sie hätte brauchen sollen. Da stand ein Haus mit kostbaren Porzellanen und eines mit edlem Rauchwerk. Tausende Tiere des Waldes, des Feldes, der Berge und der Täler hatten ihr Leben lassen müssen für diese Herrlichkeiten. Daran reihte sich wieder ein Haus, gefüllt mit Leckerbissen aller Art, Süßigkeiten, Kuchen und Weinen, daß man lüstern wurde, wenn man nur hineinsah. Gerda aber traute ihren Augen nichtl
Da lagen die Fische des Meeres und der Flüsse in ihrem glänzenden Schuppenkleid, tot und bewegungslos. Entsetzt schrie Gerda auf! Hier hing eine Reihe süßer, kleiner Vöglein, alle tot. Aufgebunden die Köpfchen zu einer langen Kette, die zarten, dünnen Beinchen verkrümmt und lasch nach unten hängendl Und große Vögel in herrlichem Gefieder, auch sie tot! Dunkelbraune und grünliche Krebse, rotgesotten und viele, viele Vogeleier! Die Zierde des Waldes, Hirsche und Rehe, zerstückelt und blutig, Rinder, dahingeschlachtet und mitten unter allem ein weißer, herrlicher Schwan mit weitausgebreiteten Flügeln, den Kopf am Boden schleifend. Gerda verstand nicht, wozu man all diese Tiere hier hingelegt hatte und warum sie nicht mehr lebten.
An diesem Glashaus aber stand, ganz in die Ecke gedrückt, ein alter Mann, scheu und ängstlich, als ob er sich fürchte, hier zu sein. Zerlumpt sah er aus, krank und scheußlich in seinen modernden Fetzen. Auch er starrte wie Gerda auf die toten Herrlichkeiten, aber mit lüsternen Augen.
[29]
Jetzt bemerkte Gerda den Alten und staunte ihn an. Nie hatte sie auf den glücklichen Inseln einen Armen gesehen.
Er erregte ihren Ekel und ihr Mitleid zu gleicher Zeit, und sie wagte, ihn anzureden:
„Warum sind all die lieben Tiere tot?” fragte sie.
„Damit man sie essen kann,” sagte der Mann und wunderte sich über die dumme Frage.
Gerda schauderte. Das waren Menschen?! und sie aßen lebende Geschöpfel
Sie sah den Alten an, der in Lumpen vor ihr stand, wo es doch so viele herrliche Kleider gab und fragte weiter:
„Warum hast Du solch häßliche Lappen an Dir, wo es doch hier so viele, schöne Kleider gibt?”
Für den Alten war es klar, dies Kind war nicht richtig bei Verstand, wie hätte es sonst so töricht fragen können? Aber da er nichts weiter zu tun hatte und froh war, zu Jemandem reden zu können, ließ er sich herbei zu antworten:
„Ich habe kein Geld, mir welche zu kaufen.”
„Was ist Geld?”
„Bist Du nicht von hier, daß Du nicht weißt, was die Kinder in der Windel wissen?” fragte er seinerseits.
„Nein”, sagte Gerda, „ich komme von den glücklichen Inseln und da gibt es kein Geld.”
„Da heißen sie freilich mit Recht so”, meinte der Alte, „aber”, krittelte er weiter, „wie kann man dort etwas kaufen?”
„Man kauft nicht, alles gehört Allen.”
„Ein schönes Land, dahin möchte ich wohl auch”, sagte der elende Mann, „aber höre, Geld, das sind die kleinen, runden Blättchen aus Silber und Gold und wer recht viele davon hat, kann alles haben, was sein Herz begehrt, gutes Essen, helle Wohnung, feine Kleider, das Leben hier und in den ewigen Gärten und alle Herrlichkeiten der Welt.”
„Aber warum hast Du kein Geld?”
„Ich bin krank und kann nicht arbeiten, Du siehst doch, ich habe nur einen Arm!”
[30]
Voll Schrecken und Mitleid sah Gerda, was sie erst nicht beachtet hatte: leer hing der eine Aermel des Mannes an ihm herab.
„Aber die Anderen”, Gerda zeigte nach den ewigen Gärten und auf die geputzte Menge, „sie arbeiten doch auch nicht, sie gehen spazieren. Warum haben sie Geld?”
„Ach, die Reichen!” Der Mann spuckte verächtlich aus, „die lassen für sich arbeiten!”
„Das kannst Du doch auch?!” meinte Gerda.
Der Alte wußte nicht, wie er dem fremden Kinde, das aus so fernem Lande gekommen, seine Lage klar machen konnte. Er wandte sich daher mißmutig ab und sagte nur:
„Heute habe ich noch nicht das kleinste Almosen bekommen, und ich habe doch solchen Hunger!”
„So geh doch hinein und laß Dir geben,” riet Gerda.
„Da würde ich schön ankommen, man würde mich hinauswerfen. Ich habe mich hierher geschlichen, um mir etwas zu erbetteln vom sinnlosen Ueberfluß der Reichen, sieht mich aber ein Feuermann, ergeht es mir übel.”
„So will ich für Dich hineingehen!” rief Gerda.
Und schon war sie, ehe der Alte sie auf das Nutzlose ihres Tuns aufmerksam machen konnte, in dem Glashause verschwunden.
Ein höflicher, junger Mann, in einer blütenweißen Jacke mit einer hohen, weißen Mütze, eilte dem vornehm aussehenden Kinde entgegen, um nach seinem Begehr zu fragen.
„Der Mann hat Hunger, er hat kein Geld, sagte er, bitte, bitte, gib ihm zu essen!”
„Hast Du denn Geld?” fragte der junge Mann.
„Nein,” sagte Gerda, „Du sollst es ihm schenken!”
„Geh schnell hinaus, hier wird nichts verschenkt”, sagte der Jüngling, und schob Gerda, ehe sie unter anderen Käufern Aufsehen erregen konnte, rasch zur Glastür hinaus.
Der Alte, der fürchtete, daß man ihn hart anfahren oder verjagen werde, war längst verschwunden.
Betäubt stand Gerda eine Weile still, dann ging sie gedankenvoll und traurig weiter.
[31]
Die leuchtenden Glashäuser wollten kein Ende nehmen, und Gerda wurde nicht müde, sie zu betrachten. Sie fühlte weder Hunger noch Müdigkeit, sie wußte nicht, wieviele Stunden sie schon wanderte, denn unter dem hellen Lampensonnenhimmel gab es keine Nacht. Aber je mehr sich Gerda in das Anschauen aller Kostbarkeiten verlor, desto mehr fühlte sie mit dem feinen Instinkt des Feenkindes, daß all den Schätzen etwas mangelte, was die Dinge der glücklichen Inseln besaßen. Sie grübelte, konnte aber nicht enträtseln, was es sein mochte.
Plötzlich stieß sie einen Ruf der Ueberraschung aus!
Da stand ein Glashaus, in dem eine ganze Schöpfung im Kleinen zu sehen war. Süße kleine Holzhäuser mit allerhand niedlichen Tieren, aber auch Bettchen aus Seide und Spitzen, in denen lagen ganz winzige Menschenkinder nachgebildet, mit Härchen aus goldschimmerndem Flachs und etwas starren Glasaugen. Und Wägelchen, um diese Püppchen spazieren zu fahren, Bilderbücher, Baukästen, Spielzeugschachteln, kurz alles, was ein Kinderherz begehren kann. Aber da lagen auch kleine Anzüge für Knaben, wie die schrecklichen Feuermänner sie trugen, ja, ganze Schachteln mit kleinen Feuermännern aus Blei, großen und festen Burgen, brennenden Häusern und Städten, Gerda dünkte dies kein gutes Knabenspielzeug.
Da öffnete sich die Tür des Glashauses und eine feine Dame trat heraus, ein kleines Mädchen an der Hand, das vor Freude über sein ganzes, schönes Gesichtchen strahlte. Es hatte einen so wunderschönen Wagen bekommen, mit einem Püppchen darin, das aussah, wie ein reizendes, lebendes Geschöpfchen, und auch lächelte wie ein kleines, unschuldiges Menschenkind. Es lag auf einem mit Spitzen umrahmten Kissen von rosa Seide. Da kam ein anderes kleines Mädchen des Weges, das war gut, aber nicht so reich gekleidet. Wie dies den Wagen sah, lächelte es auch vor Freude, näherte sich unbekümmert und begann die süße Puppe zärtlich zu streicheln.
Aber das schöne Kind, dem die Puppe eigen war, wurde plötzlich ein ganz anderes Wesen. Sein niedliches Gesicht verzerrte sich, seine Händchen ballten
[32]
sich zu Fäusten und es wurde ganz häßlich und zornig. Mit Fäusten und Füßen nach dem die Puppe liebkosenden Kinde stoßend, schrie es:
„Was fällt dir ein, Unverschämte, meine Puppe anzufassen, das ist meine Puppe, hörst du!”
Die Kleine taumelte zurück und Tränen traten ihr ins Auge. Kaum konnte sie etwas stammeln. Aber die prächtig gekleidete Dame, die mit dem feinen Kinde ging, schrie das fremde, kleine Mädchen ebenfalls an, sprach von Zudringlichkeit und schlechter Erziehung, nahm ihr Kind bei der Hand und zog rasch mit dem hübschen Wägelchen davon.
Das gescholtene Mädchen aber sah voll Scham und Neid den Davongehenden nach.
Da dachte die kleine Gerda an die glücklichen Inseln, wo die Kinder mit Blumen, Hölzern und Sand spielten, von denen es eine solche Fülle gab, daß gern Jedes mit dem Anderen teilte. Sie sah wieder auf das schöne Spielzeug, das Haß und Neid erweckte bei Denen, die es nicht besitzen konnten, und Härte, Lieblosigkeit und Eigentumsgefühle bei Denen, die es besaßen. Und sie fand es plötzlich nicht mehr schön und begehrenswert.
Die Straße der tausend Glashäuser dehnte sich weiter und weiter, immer gab es neue Dinge zu sehen und zu staunen, und Gerda wurde so müde, daß sie nicht mehr laufen und nichts mehr betrachten konnte. Sie wandte sich daher zurück und kam wieder zu den ewigen Gärten. Sie wußte nicht mehr, ob es Tag oder Nacht war, ewig strahlten die Sonnen, ewig erklang Musik, ewig flutete die geputzte Menge, ewig dauerten die Feste. Gerda aber achtete nicht mehr der prächtigen Kleider, sie sah den Menschen frei ins Gesicht. War es das Licht der künstlichen Sonnen, das alle so bleich machte? Auch schienen sie weder froh noch glücklich, was sie doch hätten sein müssen, nachdem sie alle Schätze der Welt besaßen und im Paradiese lebten.
Aber in ihren heißen Augen glänzte nicht die Freude, sondern brannte die Gier. Ihr Lächeln sah verzerrt aus, ihrem Plaudern fehlte die innere Wärme und Wahr
[33]
haftigkeit, die Menschlichkeit, die den Bewohnern der glücklichen Inseln eigen war, und Gerda kam sich auf einmal so verlassen und einsam vor wie noch nie in ihrem Leben. Es war ihr, als könne sie unter diesem Himmel und diesen Menschen nicht mehr atmen.
Sie ging zu dem goldenen Tore hinaus und landeinwärts. Und siehe, es war Abend. Vor ihr dehnten sich Felder, soweit das Auge reichte und darüber wölbte sich der sanfte Abendhimmel. Graugrün und hoch standen die Halme gegen mildes, gelbes Licht, leise strich der Wind darüber hin, das klang wie ein Abendlied, und die kleinen Vögel stimmten in diese Melodie. Mitten im Felde aber stand ein großer Fruchtbaum auf einem schmalen Wiesenrain, der etwas höher lag als die übrigen Felder und auf dem die einfachen Wiesenblumen saftig standen. Auf den ging Gerda zu. Sie setzte sich in den dunklen Abendschatten des mütterlichen Baumes und da sie plötzlich Heißhunger verspürte, nahm sie sich Früchte herunter und aß sich satt. Dabei schaute sie über das grünende, wogende Saatenmeer der untergehenden Sonne zu. Hier in der Einsamkeit der Natur kam sie sich nicht mehr so verlassen vor, hier sprach alles eine gewohnte Sprache, der Wind im rauschenden Kornfeld, der Vogel im Gezweig, die sanfte, immer heller und gelbgrüner werdende Farbe des Himmels schwangen in einer Harmonie mit ihrem atmenden, kindlich pochendem Herzen.
Sie legte sich unter den großen Baum, der gastlich seine Zweige über sie deckte, und ehe sie noch die Ereignisse des Tages überdenken konnte, war sie eingeschlummert.
[34]
4. Teil.
Der Baum der zwiefachen Fracht.
Gewohnt, vor Tag aufzuwachen, konnte sich die kleine Gerda zuerst nicht besinnen, wo sie sich befand. Sie hörte weder die Wellen rauschen, noch hatte sie die gewohnte Umgebung vor Augen. Rasch sprang sie empor, schüttelte den Schlaf ab und sah umher.
Felder, nichts als Felder, so weit das Auge reichte. Wohlbestellte, segenstrotzende, wogende Saaten. Brot im Ueberfluß!
Gerda sättigte sich wieder von den Früchten des Baumes. Sie erfüllte damit ein Gesetz der glücklichen Inseln, wonach jeder Hungrige von jedem Baume pflücken durfte, was er brauchte. Vorrat nahm sie nicht mit, denn das tat man nicht. Hier aber war es gut, daß weit und breit kein Mensch zu sehen war, denn dann wäre Gerda schwer in Streit gekommen mit den Gesetzen des schwimmenden Landes, das sie als Diebin gebrandmarkt hätte. Hier gab es nur ein Gesetz, das des Eigentumes, und ein Hungriger konnte eher verhungern, als einem Reichen von seiner Fülle nehmen.
An einer murmelnden Quelle wusch sich die Kleine und setzte neugekräftigt ihren Weg fort.
Sie bog eine andere Richtung ein. Nach den ewigen Gärten und der Straße der tausend Glashäuser zog es sie nicht mehr, sie wollte mehr von dem schwimmenden Lande sehen und es ganz kennen lernen. „Wer weiß,” dachte sie, „wie lange ich hier sein werde. Jeden Tag kann Insulinde gesichtet werden, und dann ist es zu spät.” Auch den Feldern bog Gerda aus, denn diese dehnten sich in unermeßliche Weiten. Ein schmaler
[35]
Pfad führte an winzigen Gärten vorbei und plötzlich stand Gerda vor einem großen Hause aus leuchtenden, roten Steinen. An das grenzte ein großer, mit spärlichen Bäumen bepflanzter und mit gelbem Kies bestreuter Hof, der durch ein schwarzes Eisengitter eingezäunt wurde. Fröhlicher Lärm schlug Gerda entgegen.
Lauter junge Mädchen, große und kleine, spielten auf diesem Hofe. Sie lachten, sie schrien, sie haschten und fingen sich. Gerda wurde von dieser fröhlichen Schar mächtig angezogen; das Gitter stand offen und Gerda mischte sich unter die Mädchen. Dieselben aber waren so mit sich beschäftigt, daß sie die neu Angekommene nicht beachteten.
Eine laute, schrille Glocke ertönte. Mitten im Spiel brachen die Kinder plötzlich ab und strömten dem Hause zu.
Gerda hielt sich an die Kinder, die etwa in ihrem Alter sein mochten, und folgte ihnen in ein großes, helles Zimmer. Da standen lange Reihen von Bänken, und als sich die Mädchen gesetzt hatten, nahm auch Gerda unter ihnen Platz.
Sie war sehr begierig, zu erfahren, was nun kommen sollte. Gerda wußte, daß sie sich in einer Schule befand. Schulen gab es auch auf den glücklichen Inseln, aber Gerda war noch nie in einer solchen gewesen, denn dort gingen nur Erwachsene hinein. Alle Kinder erfreuten sich dort der Jugend und der goldenen Freiheit. Was sie für ihr Alter kennen mußten, von Wort und Schrift, vom Leben und Gesetz, lernten sie daheim von Eltern und Geschwistern, halb im Spiel, halb im Ernst. Erst, wenn sie erwachsen waren, selbst denken konnten und keinem Einflusse mehr unterlagen, wurden ihnen die letzten Weisheiten zuteil. Erfahrungen, gesammelt durch Jahrtausende. Dann lernte das gesamte Inselvolk, Männer wie Frauen, was Eltern und Lehrer besaßen an gemeinsamen Gütern der Weisheit. Wie schnell lernte man auf den glücklichen Inseln, wo man ausgereift, gesund und ernst war. Aber vielleicht waren die Kinder des schwimmenden Landes doch viel weiser, von den
[36]
Erwachsenen gar nicht zu reden, denn hier gingen ganz kleine schon zur Schule und auch manche, die blaß, krank und müde aussahen und Gerda innig leid taten.
Doch sie konnte sich nicht lange ihren Betrachtungen hingeben. Ein würdiger Mann trat in die Klasse mit einer Rolle in der Hand. Der fröhliche Lärm verstummte, es wurde mäuschenstill.
Der Mann hängte nun die Rolle über eine Tafel und rollte sie ab. Sie enthielt ein großes Bild und zeigte einen wundervollen Garten. Alle Kinder sahen es an.
In diesem gemalten Garten deckte üppiges, grünes Gras den Boden und über diesem Grase wiegten sich Blumen und Blüten in buntester Fülle. Vielfarbige Falter flogen über sie hin. Dunkle, große Bäume beschatteten den Rasen, an denen hingen mehr Früchte als Blätter. Früchte aller Arten gab es da! Große, goldsatte Bündel der Bananen leuchteten in der Sonne, Glanzlichter spiegelten sich im Rotgold der Orangen, glänzten auf Aepfeln, Birnen und Nüssen und verschimmerten auf dem sanften, dunklen Blau der Pflaumen. Auch Beerensträucher mannigfacher Art standen im Grase, aber, als ob auch damit noch nicht genug sei, waren um die dicken Stämme der Bäume Reben geschlungen, an denen die üppigsten Riesentrauben weißen, roten und blauen Weines hingen.
Aber noch wunderbarer war, daß der ganze Garten von allerlei Getier, sämtlicher Länder und Zonen der Erde, belebt wurde.
All diese Tiere lagen beisammen so friedlich, wie nie in der Natur. Da streckte sich ein grimmer, starker Löwe, an ihn schmiegte sich vertrauensvoll ein Lamm. Auf einem Zweige saß eine Taube, über sie hin glitt ein Raubvogel, aber sie saß ruhig und achtete seiner nicht. Schlangen wanden sich im Grase, aber die kleinen Häschen flohen nicht vor ihnen. Und auf dem Seidenfell einer Katze spielten Mäuschen ihr anmutiges Spiel.
Gerda, von früh an vertraut mit der Lebensweise der Tiere, mußte sich wundern. Auf den glücklichen Inseln jagten die Tiere einander, töteten und verzehrten sich
[37]
und nur der Mensch schonte ihrer durch die sittliche Macht des Gesetzes. Auf dem schwimmenden Lande aber verzehrte der Mensch die Tiere. Lagen sie nicht blutig und tot in den Glashäusern? Was konnte das für ein Garten sein, in dem die Gesetze der Allmutter Natur keine Geltung hatten?
Mitten im Garten aber stand ein alter Mann mit langem, weißen Barte. Der blickte vor sich hin und sah sehr zufrieden aus, was nicht Wunder nehmen konnte, wenn er in einem solchen Garten spazieren gehen durfte. Im Hintergrunde sah man ein Menschenpaar, und das trug gar keine Kleider.
Nachdem die Kinder das Bild sattsam betrachtet, begann der Lehrer zu erzählen. Er sagte, dieser Garten sei das Bild der Erde, wie sie einmal gewesen in den Sonnentagen der Vorzeit. So schön habe der Weltenschöpfer sie geschaffen, so überaus fruchtbar und alle Geschöpfe so duldsam und friedlich. Auf diesem Bilde stehe er und schaue in Schöpferwonne sein Werk an.
Die Menschen aber, die dort stünden, seien die ersten gewesen. In seiner Güte habe er ihnen diesen Garten geschenkt und sie zu Herren gemacht über alle Pflanzen und Tiere.
Es sei ihnen frei gewesen, alle Wonnen des Lebens zu schlürfen und alle Wünsche ihres Herzens zu erfüllen, nur von den Früchten eines einzigen Baumes sollten sie nicht essen. Der Mensch aber, schwach und undankbar, habe das Gebot seines Schöpfers mißachtet und es übertreten.
Dafür sei er bestraft, vertrieben und der himmlischen Heimat für immer beraubt, Not, Tod, Elend, Krankheit und allen Uebeln preisgegeben. Durch diesen Sündenfall trage Alles auf Erden den Keim der Sünde in sich, nichts sei vollkommen, weil die ersten Menschen gefrevelt hätten gegen göttliches Gebot.
Dies aber sei die heilige Wahrheit, wie sie verkündet sei in den heiligen Büchern.
Gerda begann angestrengt über das Gehörte nachzugrübeln. Das kluge Feenkind fand keinen Faden in
[38]
dieser Geschichte. Die heiligen Bücher kannte man nicht auf den glücklichen Inseln, und von den ersten Menschen maßte man sich dort kein Wissen an. Dort ehrte man die Allmutter Natur, weil sie unerforschlich und unergründlich war und ihr Sinn sich keinem Menschen offenbarte. Sie belebte ihre Geschöpfe und gab ihnen die Möglichkeit zu leben, tat aber nichts, um sie zu schützen vor widrigem Zufalle. Sie vereinigte alle Gegensätze in sich, hell und dunkel, gut und böse, zweckmäßig und sinnlos, ihre unerforschlichen Gesetze waren keine Menschengesetze.
Aber die Allmutter Natur hatte den Menschen herausgehoben vom Sein anderer Wesen, indem sie ihm die göttliche Vernunft gab. Nach dieser ordnete er seinen Staat und legte hinein Menschensinn und Menschenrecht. So war es auf den glücklichen Inseln! Menschensinn und Menschenrecht war für Alle das Beste. Warum hätte Einer das Gesetz übertreten sollen? Es wäre gegen sein Wohl, gegen seine bessere Einsicht, gegen sein Glück gewesen.
Töricht waren daher die Menschen in dem wundervollen Garten, und Gerda fand, ihr Schöpfer hätte sie besser belehren sollen.
War dieser Schöpfer aber wirklich allweise, allgütig, allgerecht, wie der Lehrer sagte?
Gerda fand eher das Gegenteil. Wie konnte er allweise sein und nicht wissen, daß seine Menschen das Gebot übertreten würden? Wie konnte er allgütig und allgerecht sein, wenn er die Schwachen grausam und ohne Gnade strafte, und sogar deren Kinder und Kindeskinder und so fort bis in alle Ewigkeit?
Sie sah den alten Mann nochmals genau an, er sah doch so gut und so sanft aus.
Gerda fand noch viele solch unlösbarer Rätsel und sie hätte gerne noch lange über die Schöpfungsgeschichte nachgedacht. Aber ihre Gedankenkette wurde von der schrillen Glocke, die wieder ertönte, jäh zerrissen. Der Lehrer rollte das Bild zusammen und verließ das Zimmer.
Sofort erhob sich heller Lärm. Die Mädchen lachten,
[39]
schrieen, schwatzten und zankten sich. Gerda hätte zu gerne mit ihnen über das Gehörte gesprochen, aber keine kümmerte sich um die Geschichte des Lehrers. Die war entweder schon vergesen, oder die Mädchen harten sie so gut verstanden, daß sich alles Reden erübrigte. Jedenfalls stand fest, sie hatte nicht das Interesse der Schülerinnen. Weise waren sie sicher, die Mädchen des schwimmenden Landes.
Da schoß eine auf Gerda zu und fragte:
„Du bist wohl eine Neue?”
„Wo kommst du denn her?”
„Was, von so weit? das ist fein!”
„Was ist denn dein Vater?”
„König? Du halte uns nicht zum Besten, das werden wir dir bald abgewöhnen!”
„Das würde ich mir gar nicht erlauben,” sagte Gerda ernst, „mein Vater ist König der glücklichen Inseln.”
„Die Neue ist nicht richtig,” rief jetzt das Mädchen, das Gerda examiniert hatte, laut durch die ganze Klasse. „Hört nur, die will Königstochter sein!”
Alle lachten und schrien durcheinander.
„Was ist denn daran so unwahrscheinlich,” sagte Gerda wieder. „Mein Vater wurde gewählt vom ganzen Volke. Er tut seine Arbeit wie Jeder, er bestellt seine Felder und meine Mutter webte mit den Frauen und nur, wenn etwas zu entscheiden ist, wird mein Vater gerufen und dann folgen Alle seinem Spruche.”
„Das muß ein schönes Land sein, wo ein König arbeitet! Ich dachte es mir gleich, daß es kein richtiger König wäre, denn eine Prinzessin geht doch nicht in die Schule!”
„Was ist eine Prinzessin?” fragte Gerda.
„Bist du ganz verrückt? Eine Königstochter weiß nicht, was eine Prinzessin ist? Das ist doch eben die Tochter von einem richtigen König!”
„Bei uns gibt es keine Prinzessinnen,” erwiderte Gerda, „Die Kinder des Königs sind wie andere Kinder auch!”
„Das läßt sich denken, in solch einem Lande,” tat sich eines der Mädchen wichtig. „Wenn du eine wirkliche
[40]
Prinzessin wärest und Dein Vater ein richtiger König, dann brauchtest du doch nicht hier zu sitzen und dummes Zeug zu pauken.”
„Aber warum nicht?” meinte erstaunt Gerda, „muß eine Prinzessin nichts lernen?”
„O, sie lernt schon, aber doch bei Erziehern und Hauslehrern. Nie kommt sie mit gewöhnlichen Kindern zusammen, denn sie ist ja etwas Feines, hat Diener und Zofen, und alle Männer des Volkes, sogar die vornehmsten Feuermänner neigen sich vor ihr.”
Nun war es an Gerda, dies lächerlich zu finden, daß sich Männer vor einem kleinen Mädchen neigen sollten, nur weil sie zufällig die Tochter des Königs war und sie sagte das auch den Schülerinnen.
Aber da kam sie schön an! Alle schrien jetzt durcheinander, um Gerda klar zu machen, daß sie aus einem sehr rückständigen Lande kommen müsse, wo man die einfachsten Begriffe nicht fassen konnte. Mit dem Königsvater, der Felder bestellte, war es auch nicht weit her, das war nur ein Bauer. Sie wollten immer noch mehr wissen, um noch mehr höhnen und Gerda auslachen zu können, aber da schrillte die Glocke von neuem und wieder trat der würdige, alte Lehrer ein. Die Mädchen wollten ihm etwas sagen; sie waren sehr erregt, aber er gebot streng Ruhe und es wurde still.
Wieder hing der Lehrer ein Bild auf, darauf schwebte eine große Kugel. Länder waren darauf gezeichnet, braun und grün, Flüsse, dunkle Linien und Meere, leuchtend blau. Auch dies war ein Bild der Erde, „des Erdballes unserer Tage”, wie der Lehrer sagte. Er begann zu erzählen, daß die Erde einmal, vor Jahrmillionen, ein Tropfen feuriger Glut im All gewesen, der allmählich erkaltet, sich mit Pflanzen und Tieren bedeckt habe, und wie nach langer Umformung und Aenderung aller Arten, nach einer bösen, starren Eiszeit der Mensch geworden sei. Tierähnlich sei der erste Mensch gewesen, habe ein Fellkleid getragen und in schaurigen Höhlen gewohnt, Pflanzen und Tiere verzehrt und selbst seinesgleichen nicht geschont, getötet und gefressen.
[41]
Doch dieser Urmensch, der noch auf Vieren gekrochen, habe sich eines Tages aufgerichtet zu geradem Gang. Der Sternenhimmel der Ewigkeit konnte in sein Auge leuchten, und es mit Seele füllen. Langsam und wieder durch Jahrmillionen habe sich dann sein Aussehen verändert. Er hatte gelernt, Feuer zu gebrauchen und Waffen zu formen, und stetig sei er zu der Kultur gekommen, zu Sitte und Kunst, Staat und Gemeinschaft, deren er sich heute erfreue.
So aber habe man sich die Schöpfung zu denken und nicht anders, denn dies sei die heilige Wahrheit, wie sie aufbewahrt werde in den Büchern der Wissenschaft.
Gerda fing der Kopf an wie Feuer zu brennen! Das war zu viel! Sie sah auf die kleinen Mädchen. Keines regte sich. Stumpf saßen sie da und schrieben mit, was der Lehrer sagte. Nicht eines fragte, als hätte das Gehörte nichts Neues, keine Widersprüche oder auch nur das geringste Interesse für sie.
Hastig sprang Gerda auf und rief:
„Lieber Herr, sage mir bitte doch, wie ich das Alles verstehen soll. Vorhin sagtest du, der alte Mann im Garten habe die Welt aus Nichts gemacht und das sei die heilige Wahrheit. Jetzt sagst du, sie sei von selbst entstanden, und dies sei die heilige Wahrheit. Erst hat der alte Mann die Menschen gemacht und sie waren so schön und gut, und nun sollen sie wieder gewesen sein wie die Tiere. Das eben ist das Wesen der Wahrheit, lehrt man auf den glücklichen Inseln, daß sie einmalig ist und keiner Deutung bedarf. Ich kann dies alles nicht verstehen und mir nicht erklären.”
Der Lehrer, sah auf das Kind und war sehr ärgerlich. Solche Störungen waren ihm verhaßt, denn da war eine, die dachte. Denken aber macht Aufsässige und Rebellen, die am Althergebrachten rüttelten. Aber die Wahrheiten der Religion und der Wissenschaft hatten immer nebeneinander bestanden auf dem schwimmenden Lande, und daher war es gut so.
„Ah, eine Neue,” sagte er wichtig. „Du hättest dich vor der Stunde anmelden müssen. Tue es nachher.”
[42]
„Nun”, begann er weiter zu erklären, „du hast nicht aufgepaßt, mein Kind, das Eine ist die Wahrheit der heiligen Bücher, das Andere die Wahrheit der Wissenschaft.”
„Gewiß habe ich ganz genau zugehört,” verteidigte sich Gerda, „aber es kann doch nur eine Wahrheit geben, entweder ist das Eine oder das Andere falsch, beides zu gleicher Zeit ist nicht richtig.”
„Setze dich und störe nicht den Unterricht, wir wollen fortfahren!”
„Ich will dich gewiß nicht wieder stören,” rief Gerda immer erregter, „sage mir nur bitte, warum es bei euch zwei Wahrheiten gibt! Welche davon nun wirklich wahr ist, und warum du einmal so und ein andermal so sprichst. Du mußt es doch wissen!”
„Wenn du jetzt nicht schweigst, muß ich dich leider bestrafen!”
„Das wäre ungerecht von dir, denn ich habe keine Strafe verdient, bloß weil ich frage und du nicht antworten kannst. Vielleicht weißt du die Wahrheit selbst nicht, aber warum bist du dann Lehrer?”
Der Lehrer und die Schülerinnen starrten Gerda ob dieser kühnen Sprache maßlos verblüfft an. Der alte Lehrer wurde blutrot im Gesicht, die Mädchen fingen an zu kichern. Die Neue war köstlich, das konnte schön werden! Nein, war die dumm! Sagte, was sie dachte! Bei allen Lehrern würde sie sich verhaßt machen, alle Zensuren würde sie sich verderben, aber nett war sie doch! Man konnte über sie lachen und die Stunden wurden amüsant. Gerda war schon beliebt in der Klasse. Man hatte Mitleid mit ihr, sie war zu dumm!
„Hinaus mit dir, man wird dir die Schulordnung beibringen, melde dich bei dem Herrn Direktor,” schrie der Lehrer und vergaß ganz seine Würde.
Ruhig stand Gerda auf. Sie sah noch einmal den zürnenden alten Lehrer an und die kichernden Mädchen, und endlich das Bild der Erde. Sie schüttelte den Kopf, ging langsam zum Zimmer hinaus, hinunter auf den Hof, dann auf die Straße und immer weiter, bis das Schulhaus . ihren Blicken entglitten war.
[43]
Wußten die Menschen des schwimmenden Landes vielleicht gar nicht die Wahrheit über die Schöpfung? Wieso stand die Wissenschaft im Gegensatze zu den heiligen Büchern? Warum lehrte man beide? Warum hatte der alte, einarmige Mann keine ganzen Kleider und kein Essen gehabt bei allem Ueberfluß? Wohin sie auch blickte, nichts als Widersprüche und Gegensätze. Und Gerda, das weise Kind der glücklichen Inseln, ging weiter und weiter, immer grübelnd und nicht des Weges achtend.
Ganz in Gedanken versunken, wußte sie nicht, wohin der Weg führte.
[44]
5. Teil.
Das eherne Lied.
Erschreckt schaute sie auf, als sie in einem großen Saal stand.
Es war eine Halle von so gewaltiger Ausdehnung, wie alles auf dem schwimmenden Lande. Nie hätte Gerda sich auch nur im Traume eine so ungeheure Halle denken können. Ganz aus Milchglas war sie und so hoch, daß man weder ein Dach noch einen Himmel sehen konnte; auch ins Freie blicken konnte man nicht, da das Glas nicht durchsichtig war. Und doch war es tageshell hier drinnen. Den Riesenraum erfüllte ein Brausen wie Meereswogen an Sturmestagen.
Gerda wurde fast schwindlig, als sie in die Halle hineinschaute. Ueberall standen Maschinen, die alle im Wirbel, aber mit rhythmischer Genauigkeit ihre blanken Glieder schwangen. Dazwischen surrten Räder, liefen Bänder, kreischten Feilen. Das brauste, summte und sang wie in einem Riesenbienenstock.
Jezt gewahrte Gerda auch Menschen, die zwischen den Maschinen hin und hersprangen, und hurtig, hurtig herumhantierten. Wie klein nahmen sie sich aus. Wie winzige, dienende Zwerglein dieser großen, lärmenden Riesen, und doch waren es Menschen, die diese Maschinen gefertigt hatten.
Dann folgte eine endlose Reihe von Tischen und auch an ihnen saßen arbeitende Menschen.
Gerda trat einem der hier Herumeilenden aus dem Wege, stolperte ein wenig und raffte ihr Kleid zusammen. Dabei fühlte sie etwas Hartes. Sie zog es hervor, es war das Kästchen ihrer Mutter. Leise öffnete sie es und berührte
[45]
die kleine Leier, und siehe, diese begann zu tönen. Auf einmal verstand sie den Sinn ihres Muttererbes, denn die Leier hatte die Fähigkeit, auch die Sprache der scheinbar unbeseelten Dinge deutlich zu machen, und ihnen Zunge zu leihen. Gerda verstand, was die Maschinen sangen.
Srrrrr, srrrr, srrrr, wir singen das Lied, das Lied von der ArbeitI Wir singen es bei Tag und Nacht, bei Sommer und Winter, bei Jahr und Ewigkeit! Wir schaffen das Brot, wir schaffen das Kleid, erhalten das Heim, erhalten das Haus, wir sind die Welt, wir, die Maschinen! Eure Wohltäter sind wir, Menschenkinder! Wir singen das klingende Lied, das Lied von der Arbeit, wir die Maschinen, srrrrr, srrrrr, srrrrr. .....
Rrradadadat, rrradadadadat, rrradadadat Ihr lügt, Ihr Maschinen, Ihr lügt, Ihr Maschinen, Ihr lügt! schnarrten die großen Treibriemen. Ihr lügt, lügt, lügt! Ihr singt das eherne Lied von der Fron! Tag und Nacht keine Ruhe, Tag und Nacht keinen Himmel, weder Sonne noch Sterne, weder Sommer noch Winter. Schlechte Luft, faulig Brot, karges Essen, ärmlich Kleid! Mühen ohne Ende, Mühen bis ans Ende, das Lied der Fron als Wiegenlied, das Lied der Fron als Grabgesang, das Lied der Fron, der ehernen Fron! Rrradadadat, rrradadadat, rrradadadat. .......
Ssssss, ssssss, sssss, was übertreibt Ihr, Ihr Riemen, schnurrten die Weberschifflein. Seht Ihr denn nicht, was wir weben? Seide, feinste Seide, Seide wie Gold. Weich wie Haar, zart wie Flaum, für den Menschen, für den Menschen, ssssss, ssssss, ssssss. ........
Rrradadadat, rrradadadat, nicht für diese, nicht für diese . . . Srrrr, srrrr, srrrr, wir singen das klingende Lied von der Arbeit, das Lied von der Arbeit, Arbeit ist Segen. .. .
Ihr lügt, lügt, lügt, Ihr singt das eherne Lied von der Fron. ...
Sssss, sssss, sssss, Seide, Seide, Seide. ...
Srrrr, rrrdadadat, srrrr, rrradadadat ....
Während Gerda darauf lauschte, was die Maschinen sangen, hörte sie auch die Menschenherzen klingen. Ihr
[46]
Klang war einförmig und traurig, wie Windgeraschel im Herbstlaub oder der sterbende Ton einer Aeolsharfe:
Harte Herren sind die Maschinen, sangen sie, sie haben kein Herz, sie haben kein Hirn, sie werden nie müde, sie brauchen keine Ruhe, immer schaffen sie und ihr Dienst macht unfrei und unfroh . . .
Wie blaß waren sie alle, wie müde und wie unglücklich sahen sie aus! Gerda, die nur die Lust der freiwilligen Arbeit kannte, sah hier zum ersten Mal die Qual im Dienste der ewig sich gleichbleibenden Fron. Mit Mitleid und Schauder sah sie in die Gesichter der Jungen und Alten, auf ihre gebückten Gestalten und ihre ärmliche Kleidung.
Was schafften denn diese Menschen, was mühten sie sich so? Sie leisteten Handlangerdienste den Maschinen, und diese schafften all die herrlichen Dinge, die hinter den Fenstern in der Straße der tausend Glashäuser lagen. Die entstanden hier, in so unabsehbarer Fülle, daß es selbst den Reichen nicht möglich war, all diese Dinge zu erwerben. Je mehr Kleider die Maschinen nähten, desto kärglicher wurden die Lumpen der Armen; je mehr Brot die Maschinen buken, desto größer wurde ihr Hunger; je mehr Reichtümer hervorgebracht wurden, desto schlimmer wurde ihre Not. Auch dies war für Gerda wieder ganz unverständlich, aber sie wußte, das schwimmende Land barg mehr tiefer Geheimnisse, als ein kleines Mädchen ergrübeln konnte. Sie überließ sich daher ganz ihrem Erleben.
Sie sah sich die Maschinen näher an, und all die Herrlichkeiten, die sie schafften. Und wieder hatte sie das Gefühl, das sie schon bei den Auslagen der Glashäuser beschlichen, all den kostbaren Dingen mangelte etwas. Aber Gerda wußte jetzt, was es war. Ihre Leier tönte es ihr zu, leise, ganz leise. Hier mangelte es an Seele!
Die Maschinen selbst hatten keine Seele, und konnten daher auch ihrer Arbeit nicht geben, was sie nicht besaßen. Aber auch die Menschen würden es wohl nicht besser gemacht haben, nur ungenauer, denn ihnen fehlte die Schaffensfreude. Sie schafften für ganz ferne, ganz
[47]
unbekannte Menschen. Sollten sie Denen Liebe geben, die sie nie gesehen, an die sie kein Band fesselte?
Plötzlich sah Gerda ganz im Hintergrunde der Halle ein Weib tronen, das trug ein zeitloses Gewand über seinem übermenschlichen, majestätischen Wuchs. Es war die Technik, die Mutter all dieser Maschinen, die ihre Kinder waren, und sie war gekrönt mit einer Krone aus Stahl.
Und die Kinder der Technik fragten nichts danach, daß sie keine Seele hatten, denn sie vermißten sie nicht. Im Gegenteil, stolz waren sie auf ihr Werk. Keine Menschenhand konnte etwas so gleichmäßig machen, so genau, so richtig, und sie fragten daher die Mutter: sind wir nicht vollkommen, wer schafft wie wir?! Herrscherkinder sind wir, denn Du bist gekrönt, o Mutter Technik! Beherrschst Du nicht die Welt!?
Da schauten die Menschen zur Technik auf und warteten auf ihre Antwort. Und tönend kam es aus ihrem Munde: schön ist Euer Leben und bequem, Zeitmenschen der Technik! Auf weichem Pfühl streckt Ihr die Glieder, Aetherfunken des Lichtes dienen Euch, sie schaffen künstliche Himmel über Euch und der widerlichsten Arbeiten habe ich Euch ledig gemacht. Meine Kraft ist es, die blitzschnell Euer Land dahinträgt, und die Schrecken der Natur half ich Euch überwinden. Was könntet Ihr Euch wünschen, das ich nicht gewähren kann? Ich war es, die Euch aus den Höhlen holte, Paläste Euch erbaute. Ich förderte Kunst und Wissenschaft! Ich und meine Kinder, die Maschinen, wir überschütteten Euch mit den Gütern des Alls!
Die Lippen der Menschen blieben stumm, aber ihre Herzen tönten:
Du hast die Arbeit wertlos gemacht, das Brot teurer und das Leben seelenlos.
Aber die Stimme der Maschinen war lauter als das Lied der Herzen der Armen, daher vernahm es nur Gerda.
„Ich sehe es Euch an, Ihr liebt die Arbeit nicht,” rief nun die kleine Gerda, so laut sie konnte, die Maschinen zu übertönen. „Warum laßt Ihr sie nicht stehen und geht hinaus, dorthin, wo die Felder wogen und die Vöglein
[48]
singen und alle Bäume voll köstlicher Früchte hängen?”
„Gewiß können wir hinausgehen, kleines Mädchen,” eine müde, blasse, junge Frau, „uns hält keiner! Aber die Ernte ist nicht unser, die Früchte der Bäume wachsen nicht für uns. Wenn uns dann der Hunger zurücktreibt, und wir kommen wieder hierher, dann sitzen andere auf unseren Plätzen, die nur auf unser Fortgehen warten, denn wir sind zahlreicher als der Sand am Meere. Des Einen Brot ist der Mangel des Anderen. Keine Arbeit zu haben aber heißt bittere Not, kein Brot, kein Heim, kein Kleid.”
„Pfui, was für ein Heim,” schrie jetzt ein junger Mann, „saures Brot, häßliche Kleider, Löcher als Wohnung! Verflucht seien die Reichen, die unser Teil mitverprassen!”
„Du lästerst die göttliche Weltordnung,” mischte sich eine Alte grell dazwischen. „Gott selbst will, daß es Arme und Reiche geben soll. Hätten wir die Reichen nicht, die diese Waren kauften, die Maschinen hätten keine Arbeit und wir alle müßten elend verhungern!”
„Die göttliche Weltordnung?! Eine schöne, göttliche Weltordnung! Die Reichen haben sie für uns gemacht; schrie nun die Junge. Wir sollen glauben, was sie nicht glauben, daß dort oben ein Himmelreich ist, mit allen Wonnen der Erde, nur für uns Arme zum Entgelt für unsere Qual. Aber auf Erden sollen wir Demut üben und Geduld, damit sie immer übermütiger werden können; wir sollen schaffen, damit sie prassen können von unserer Hände Arbeit, rasten können auf unserem Schweiße! Sie predigen wohl den Lohn der Armut, aber sie halten ihre Schätze fest. Fluch ihnen allen!”
„Du lästerst Gott!” kreischte die Alte auf. „Sein Wille geschehe! Kein Haar fällt von Deinem Haupte ohne seinen göttlichen Willen. Er ist der Einzige, Allgütige, wir alle sind seine Kinder, aber Euch geht es schlecht, weil Ihr ihn leugnet!”
„Wenn Ihr alle Kinder eines Vaters seid”, begann Gerda sich ins Gespräch zu mischen, „warum seid Ihr dann so ungleich? Warum sind die Reichen nicht besser zu ihren Brüdern und Schwestern? Fürchten sie ihren himmlischen
[49]
Vater nicht, oder lieben sie ihn nicht, oder glauben sie gar nicht, daß er lebt? Schon der Lehrer konnte es nicht sagen.”
„Es gibt gar nicht nur einen Gott, es gibt unzählige Götter,” ließ sich jetzt ein weißbärtiger, lahmer Mann vernehmen. „Ehe ich hier arbeiten mußte, war ich Feuermann! Ein herrliches Leben war das! An vielen Küsten legten wir an, viele Länder sahen wir. Ueberall, wohin wir auch kamen, kniet man vor anderen Göttern, vor guten und bösen, und betet sie an, und alle Völker sagen, daß nur ihre Götter die einzig wahren, richtigen und mächtigen wären. Viel Blut ist schon über die Erde geflossen, viel Elend und Jammer haben die Menschen sich zugefügt, weil sie sich nicht einigen können, welches die wahren Götter seien. Aber noch stieg keiner der Himmlischen zur Erde, sich zu offenbaren, und so meine ich, es wird wohl auch keine geben. Könnte es sonst so sein, wie es ist?”
„O,” sagte jetzt der Junge hastig, „Du hast Recht! Aber das sind die Götter der Völker! Die Reichen jedoch haben ihren ganz besonderen Gott, ich habe ihn selbst gesehen!”
„Du hast einen Gott gesehen? Hör mal, das mußt Du uns erzählen!”
„Ihr wißt es ja, es steht für uns hohe Strafe darauf, die ewigen Gärten zu betreten. Aber ich wollte sie sehen, meine Sehnsucht ließ mir keine Ruhe. Eines Nachts schlich ich mich hinauf. Es war dort gerade eines der vielen, großen Feste, deshalb wurde ich im Gedränge nicht beachtet, sonst wäre ich wohl verloren gewesen. Alles wogte und schob sich durcheinander, alles leuchtete von geputzten Menschen, Tieren und Blumen, die in langen Umzügen nach einer großen Halle drängten. Ich wurde mitgeschoben und kam so hinein.
Aus einer sich hochwölbenden Kuppel fiel grelles, gleißendes, stechendes Licht. Von der Pracht der Halle aber könnt ihr euch keinen Begriff machen, selbst in euren Träumen nicht. Golden waren die Wände, Edelsteine überdeckten sie mit funkelnden Mustern, Teppiche
[50]
zierten sie, die waren aus Seide gewoben und mit Bildern fiberdeckt. Auch sie stellten einen Triumphzug dar, der dem Gotte der Reichen gebracht wurde von seinen Dienern, und es waren darauf zu sehen Menschen aller Zeiten, aller Länder, aller Zonen. Da standen die stolzen Könige der Vergangenheit und schwangen ihre Geißel über ihre Völker, habgierige Freie mordeten im Bruderkriege und der Sieger triumphierte im Zuge. Seine Adler blitzten, und endlos dehnte sich der Zug bis auf die Menschen unserer Zeit. Unter der Kuppel aber stand ein Thron, der war aus glühendem Golde und vor dem Throne breitete sich ein See; auch der war flüssiges Gold, Fontänen rauschten aus ihm empor und ergossen sich zurück in das Gold des Beckens. Das gab jedesmal einen tiefen, metallischen Klang. Eine wahnsinnige Musik, ganz auf diesen Klang gestimmt, begleitete ihn. Auf dem Throne aber saß ein Ungeheuer dick und gewaltig, das war scheußlich anzusehen. Dies war der Gott, um den die Menge wie wahnsinnig tanzte, jauchzte, dem sie zukreischte und zuschrie:
„Heil Dir,” riefen sie, „heil Dir, Mammon, heil Dir, Du, unserm Gotte! Dir gaben wir unser Unsterbliches, Dir gaben wir unsre Seelen. Heil Dir, Mammon, heill
Segne uns mit rotem Golde, halte uns die Welt im Solde, gib uns Ehren, Macht und Glanz, segne uns des Lebens Tanz. Dafür weih'n wir, ewig Heil! Dir der Seele göttlich Teil!”
„Und nun, denkt Euch mein Entsetzen, mir wurde eiskalt und ich glaubte vor Grauen sterben zu müssen! Eine rote Goldflamme brach aus dem Schlunde des Ungeheuers und man warf ihm lebende schreiende Kinder in den Riesenrachen! Unsere Kinder, Kinder der Armen, kleine wimmernde Menschenkinder, viele Tausende, unter dem wahnsinnigen Jauchzen und Gekreische der Reichen!”
„Erzähle doch Anderen Deine Lügenmärchen, Du Träumer!” schrie nun die Alte, außer sich vor Zorn. „Siehst Du Gottes Finger nicht auch bei den Reichen? Haben nicht Viele von ihnen mitleidige Herzen? Sind sie nicht auch elend und krank? Haben sie nicht Kummer
[51]
und Sorgen, wie wir? Erliegen sie nicht auch den Gesetzen der Natur, die Gottes Gesetze sind? Gott aber ist gut und gerecht. Der Himmel ist sein Thron und die Erde der Schemel seiner Füße. Wer ist wie Er?”
„Hör' auf mit Deinen Litaneien, ich weiß, was ich weiß,” rief nun der Junge ungeduldig. „Geht es Dir etwa besser, weil Du zu Deinen Baalspfaffen läufst? Seelen wollen sie fangen, richtig, aber nicht für den Himmel, denn Leiber müssen an den Seelen sein, das stärkt ihre Macht auf Erden. Die Baalspriester und die Könige, sie wollen das Gleiche, Einer ist des Anderen wert!”
Noch immer glühte die alte, erregte Frau. Sie fuhr empor, um dem jungen Manne scharf zu antworten, als ein dicker, roh aussehender Aufseher sich der lärmenden Gruppe näherte und mit rauher Stimme rief:
„Ruhe! Hundepack, Nichtstuer, wollt Ihr schweigen! Stehlt dem Herrn die Zeit und mir das Gold aus der Tasche, Tagediebe, Gesindel; hinausjagen werde ich Euch, faule Hunde!”
Da trat Schweigen ein und die Köpfe sanken tiefer auf die Maschinen und nichts mehr war zu hören als deren Brausen.
Srrrr, srrrr, srrrr wir singen das ewige Lied, das Lied von der Arbeit . . .
Rrradadadat, rrradadadat, rrradadadat, wir singen das ewige Lied von der Fron ...
Da tönte ein Gong. Mitten im Liede brachen die Maschinen ab und machten eine Pause. Schneller aber als ein Gedanke hatten die Menschen die Arbeit aus den Händen geschleudert, als ob sie glühend wäre, und eilig, als entflöhen sie der Hölle, drängten sie dem Ausgange zu. Ein dunkler Strom ergoß sich durch geöffnete Pforten und in diesem Strome wurde die kleine Gerda mit hinweggespült.
[52]
6. Teil.
Der stählerne Riese.
Gerda glitt in der Menschenwoge dahin, denken konnte sie nicht. Was hatte sie nicht alles gehört und gesehen, seit sie die Heimat verlassen; welch unlösbare Widersprüche hatten geheimnisvoll ihr Ohr berührt. Jeder sprach hier die gleiche Sprache und doch verstand Keiner den Anderen. Jeder sprach vom Gesetze, aber Keiner lebte es. Hier haßte der Bruder den Bruder, ohne den er nicht leben konnte. Hier waren Alle auf die Gemeinschaft angewiesen, mehr denn in anderen Ländern, ja selbst mehr denn auf den glücklichen Inseln, und doch war Jeder zum Alleinsein seiner Seele verurteilt.
Aber das Feenkind hatte nicht Zeit, sich seinen Grübeleien hinzugeben; von allen Seiten wurde es gedrängt und gestoßen.
Der Menschenstrom wurde immer dichter, weil er immer enger wurde, denn Alle wollten mit gleicher Hast und Schnelle eine enge Treppe hinunterlaufen. Jeder wollte der Erste sein, und ohne sich um den Anderen zu kümmern, drängte Einer den Anderen rücksichtslos beiseite. Die alte Frau, die an den guten Gott glaubte, kam fast zu Falle. Die Junge hatte ihr einen Stoß versetzt und stürmte vorüber. Gerda half ihr auf und kam als Letzte die Treppe hinunter.
War es möglich, solche Eile zu haben, um hier hinabzukommen? Es war dunkel und erst allmählich gewöhnte sich das Auge an dies Dämmerlicht. Gerda hüstelte. Beißend war die Luft, muffig und faul, kalt und feucht. Es roch nach Unrat, schlechtem Essen und ungelüfteten Kleidern.
[53]
Hier wimmelte es von Menschen. Menschen in unabsehbarer Fülle wie in einem Riesenameisenhaufen. Sie krochen hervor aus Löchern und Stuben, aus Höhlen und Unterschlupfen, rannten durcheinander, schrien sich an, hasteten und erfüllten die Luft mit tosendem Lärm.
Hier waren die zu Hause, die am Tage unter dem dröhnenden Liede der Maschinen frönten. Hierher sehnten sie sich zurück, hierher! Hier wurden sie geboren, hier lebten sie, wünschten, hofften und starben.
Gerda schluchzte weh auf! Wie konnte man hier leben? Hier im Dunkel, in verbrauchter Luft, ohne Sonne, ohne die Allmutter Natur? Waren all diese Menschen so stumpf, oder hatten sie etwas, was ihnen das Leben lebenswert erscheinen ließ, auch hier unten, das sie schützte vor Verzweiflung?
Eine Mutter herzte die langentbehrten Kinder, die hungrig waren und essen wollten. Eine Gattin grüßte froh den heimkehrenden Mann, dort gedieh noch eine Blume, lang, weiß und schmal, auf blaßem Stengel, siechend wie ein krankes Kind. Aber es war doch eine Blume und sie wuchs. Und hier unten lebte auch eine Zauberin, die war es, die die Menschen träge und stumpf machte, müde und gleichgültig, die Gewohnheit.
Je weiter Gerda ging, je mehr sie diesem Leben und Treiben zusah, desto mehr wurde ihr Herz erfüllt von Leid und Mit-Leiden. Sie verstand nichts vom Leben und Treiben dieser Menschen. Ihre Art zu denken war ihr fremd, ihr Handeln und Wandeln sonderbar, ihre Sprache nur dem Klanglaute nach verständlich, sonst ohne Sinn und doch war es ihr, als seien alle diese ganz besonders ihre Brüder und Schwestern. Sie grüßte freundlich, sie lächelte den kleinen, verwahrlosten Kindern zu, sie reichte den Greisen die Hand, aber Alle sahen voll Mißtrauen auf das feine, nicht hierhergehörende Kind und wichen scheu beiseite oder kehrten sich ab.
Traurig und nachdenklich ging Gerda weiter und weiter, so versunken, daß sie weder Hunger, noch Durst, noch Müdigkeit verspürte. Sie hatte seit dem Morgen nichts gegessen, aber sie wußte es nicht.
[54]
Erst ein ohrenbetäubender Lärm ließ sie Halt machen. Da stand sie vor einem Ungeheuer, wie sie sich keines hätte ausmalen können. Leuchtend blank waren seine Glieder aus silberglänzendem Stahle und sie bewegten sich mit solcher Schnelligkeit und Genauigkeit, so voll Kraft und Uebermut, daß man sich hüten mußte, in die Nähe zu kommen. Tötlich wäre solche Umarmung gewesen.
Aber das war kein Wunder, daß dieser Riese so viel Kraft hatte und so übermütig war. Denn wenn man so viel fraß wie er, konnte man satt sein, lustig und schaffen.
Ganze Berge voll schwarzer Diamanten lagen umher und sie alle, so hoch sie auch waren, verschwanden im glühenden Rachen des Ungeheuers.
Nackte Männer, schweißtriefend und keuchend, sprangen umher und mühten sich, den Riesen, die große Maschine, die das schwimmende Land durch die Ozeane trieb, zu sättigen. Aber sie wurde nicht satt. Tag und Nacht, Sommer und Winter, jahrein, jahraus, unermüdlich fraß sie, unermüdlich spielten ihre blanken Glieder, unermüdlich trieb sie das Land dahin . . .
Wenn aber die Männer starben, die die Maschine speisten, dann kamen Andere, nackt und schweißtriefend, die Riesenschaufeln schwarzer Diamanten in den unersättlichen Schlund warfen. Hell und heiß war es rings umher von seinem glühenden Atem, wonnig und schön, hier unten wo es so dunkel und feucht war, in die warme, rote Flamme zu starren.
Auch Gerda wurde unwiderstehlich näher und näher gezogen. Schon stand sie dicht vor der Flamme, schon war es fast heiß, aber Gerda dachte an die Feuerriesen, die die Mutter einst befreit, und warm und vertraut schien ihr die Lohe.
Einer der nackten Männer stieß sie ärgerlich beiseite:
„Weg da, dummes Mädel, willst wohl verbrennen?” Gerda flog zur Seite und unsanft gegen einen Knaben, der gleichfalls hier stand und seine Augen nicht abwenden konnte von dem lustigen Spiele. Der Junge hatte zuerst Lust, das gegen ihn geschleuderte Mädel mit einem kräftigen
[55]
Puff weiter zu befördern. Aber er besann sich eines Besseren und lachte bloß. Er war ein ziemlich hochaufgeschossener Junge, blaß und knochig wie die Kinder der Tiefe. Er hatte einen geflickten, aber sauberen Anzug an, stand keck, die Hände tief in die Taschen vergraben und lachte lustig aus gutmütigen, graugrünen Augen. Seine runde Stupsnase verlieh dem Gesicht etwas Gemütliches, und wie er so dastand, gedankenlos ins Feuer starrend, sah er aus, als sei er der glücklichste Mensch der Erde. Und das war er auch.
Konnte es irgendwo auf der Welt schöner sein als hier am Schlunde des großen Feuerriesen?
„Stell Dich auf die Seite, dann kannst Du zugucken,” sagte er jetzt zu Gerda. „Du, Mädel, wo kommst Du denn her, Du siehst nicht aus, als ob Du hierher gehörst?”
Nein, so sah Gerda nicht aus in ihrem feinen, weißen Linnenkleide, den zarten Schuhen und den goldenen Locken. Hier, in einer Umgebung, wo alles grau, tot und schmutzig war.
Gerda sah den Jungen an und er gefiel ihr.
„Komm, ich will es Dir erzählen,” sagte sie.
Sie gingen etwas abseits. Da lagen lange Reihen großer Baumstämme aufgeschichtet, denen hatte man die schuppige Rinde abgezogen. Nun lagen sie blank, weiß und tot und rochen würzig nach Wald und Sommerleben. Auf diese setzten sich die Kinder und Gerda erzählte. Sie sprach von der Heimat, von Vater und Mutter und dem Leben zu Hause, von ihrer Sehnsucht und ihrem Warten am Meere. Wie dann die Feuermänner gekommen, wie sie geflohen und mit ihnen gefahren war, was sie alles gehört, gesehen und erlebt hatte.
Der Junge hörte zu und seine Augen glänzten. So ein freies Leben, das wäre nach seinem Sinn gewesen. Und ein mutiges Mädel war das, feige war die nicht, sie hätte verdient, ein Junge zu sein!
Er wartete kaum ab, bis Gerda geendet.
„Du,” rief er begeistert, „das muß ich dem Vater erzählen! Da steht er, dort bei den Männern, er heizt die
[56]
große Maschine, und wenn ich mal groß bin, dann tue ich das auch!!” Und mit einem Satze sprang er davon.
Er lief auf den Vater zu und sprach hastig auf ihn ein. Der legte die Schaufel etwas aus der Hand, streichelte mit gütiger Gebärde seinem Jungen den borstigen Kopf und hörte zu. Mitten durch die Unterhaltung tönte der Klang einer Glocke. Der Heizer wischte sich den Ruß etwas vom Gesicht, zog einen Rock an und näherte sich Gerda.
Kritisch betrachtete er das kleine Mädchen, das wie eine Lichtelfe vor ihm stand. Aber je mehr er es ansah, desto sonderbarer wurde dem einfachen Manne zu Mute. Er gewann gleich eine solche Zuneigung zu Gerda, daß es ihm war, als könne er nie wieder recht froh werden, wenn ihn das kleine Mädchen verlassen würde. Dies Gefühl übermannte ihn so, daß er fragte, ob Gerda mit ihm gehen und bei ihm bleiben wolle. Innerlich freilich mußte er sich gleichzeitig über sich selbst wundern, denn das Brot war knapp genug daheim und die Kleine eine Esserin mehr, auch wußte er nicht, was seine Frau dazu sagen würde. Aber er gehorchte einem inneren, unwiderstehlichen Zwange. Auch Gerda willigte ein. Sie hatte schon bedacht, daß sie nicht immer allein sein konnte, bis sie nach Insulinde käme, und sie fühlte sich hingezogen zu diesem guten, freundlichen Manne und dem drolligen Knaben. Aber auch Gerd, so hieß der Junge, war einverstanden. Er war Mutters Einziger und langweilte sich oft, nun hatte er eine Pflegeschwester, das war etwas Neues und schon darum fein!
Zufrieden wanderten die Drei durch viele enge Gassen, bis zum Rande der steilen Felsküste, wo der Heizer eine Stube hatte, die ins Freie hinausging. Das war das Schönste an ihr. Denn durch die Fenster fiel Licht und Sonne. Sonst war sie geräumig, -aber ärmlich genug.
Auch Gerdas [Gerds] Mutter war wider Erwarten gleich einverstanden, das fremde Kind zu behalten. Sie hatte ja nur ihren Buben; dieser war immer fern. Wußte der Himmel, wo der den ganzen Tag über steckte, um des Abends heißhungrig und strahlend heimzukommen. So ein Töchterchen aber war ihr recht, die würde daheimbleiben, zur
[57]
Hand gehen und die langen Stunden des Alleinseins vertreiben helfen.
So hatte die kleine Gerda auf einmal eine neue Heimat, neue Eltern und sogar einen neuen Bruder auf dem schwimmenden Lande Eurasia.
Und sie blieb bei den freundlichen Heizersleuten.
[58]
7. Teil.
Gerdas neue Heimat.
Tage und Wochen verrannen, es wurden Monde und Jahre daraus. Manchmal war es Gerda, als habe sie nur geträumt von den glücklichen Inseln. Ihr Leben verlief in so ruhiger Alltäglichkeit; sie schaffte mit der Mutter im Haushalte und brachte mittags dem Vater das Essen. Das tat sie am liebsten. Dann konnte sie in den Feuerrachen des Riesen sehen und sich der hellen Flamme freuen. Wie ein Märchen aus den Tagen ihrer frühesten Kindheit dachte sie der toten Feenmutter und der Feuerriesen. Wenn aber der Abend kam, hielt es sie nicht mehr. Dann lief sie hinaus, um zu erspähen, ob der Strand von Insulinde nicht auftauchen würde.
„Mußt Du denn jeden Abend gehen, kannst Du hier nie heimisch werden bei uns, die wir Dich lieben wie eigene Eltern, willst Du uns denn wirklich verlassen?” jammerte dann die Mutter.
„Nein, nein, ich verlasse Euch nie,” sagte dann Gerda. „Alle nehme ich Euch mit, denn mein Großvater, der große Geisterkönig, wird es schon erlauben, ich werde ihn sehr bitten! Und dann werden wir alle Wunder sehen und es schöner haben als im Paradiese, und alle Sorge hat ein Ende!”
Das kam so überzeugend von Gerdas Lippen, daß die Mutter nichts mehr sagte und ruhiger wurde.
Und sie wurde noch ruhiger und sorgloser, denn die Tage glitten dahin und Insulinde wurde nicht gesichtet.
Wenn Gerda dann abends von der Küste wiederkam, wo sie das Meer gegrüßt, dann setzten sich Alle um sie. Sie aber nahm die Harfe zur Hand, ihr Feenerbe, und leise
[59]
glitt ihre Hand über die goldenen Saiten. Da wurden die Lieder tönend, die Gerdas reine Seele sang. Leuchtend entstiegen die glücklichen Inseln dem Meere, man sah die Menschen dieses Landes vor sich, ihre einfachen Sitten und Gesetze, die das Glück Aller auf Erden sicherten, soweit Allmutter Natur dies wollte.
Und Gerd lauschte dann besonders innig, und in seiner Brust reiften die großen Gedanken.
Aber es waren doch andere Gedanken, als Gerda sie hatte. Wild waren sie, kühn und eingestellt auf die Menschen des schwimmenden Landes.
„Höre, Vater,” sagte er eines Abends zu dem Heizer, „was Gerda und ich beschlossen haben. Statt bei Euch zu sitzen, wollen wir alle Abend hinausgehen und zu unsern Brüdern sprechen. Wir wollen sie einweihen in das Gesetz der glücklichen Inseln, wir wollen ihnen zeigen, in welcher Ueppigkeit die Reichen leben, und welches Glück ihrer wartet, wenn Alle frei und gleich sind, wir wollen sie aufwecken aus ihrer Dumpfheit und Stumpfheit und sie sollen hinaufziehen mit uns, um sich einen Platz im Lichte der Sonne zu erkämpfen. Gutwillig werden ihn uns die Reichen nicht geben, aber unser Recht wird stärker sein, als ihre Macht. Alle wollen wir arbeiten und Alle ruhen; weder arm noch reich wollen wir Alle sein, weder vornehm noch gering, weder Herren noch Knechte. Wir Beide, Gerda und ich, wollen ihnen die Botschaft bringen!”
Gerds Vater war ein kluger, gütiger Mann, der mehr als Andere über das Leben nachsann. Er schüttelte das ergraute Haupt, schwieg eine Weile und sagte langsam:
„Gefährlich ist es, meine Kinder, die Menschen zu wecken, laßt es sein! Ihr macht sie unzufrieden mit ihrem Geschicke, macht sie wild und unbotmäßig und sie werden es schwerer haben, denn je, wissend hier zu leben, mit dem Hasse im Herzen. Denn sie sind nicht imstande, ihre Ketten zu zerreißen, die um ihre Seelen liegen, und daher nützt ihnen die Freiheit wenig. Niemals werden sie werden wie die Bewohner der glücklichen Inseln!”
„Aber warum nicht!” rief Gerda aus, „es ist doch so einfach, gut zu sein und das Rechte zu tun!”
[60]
„Einfach für Dich, lichtes Feenkind, für diese aber: einfach und doch unmöglich, schwer und leicht, faßlich und doch undurchführbar; Ihr kennt die Menschen nicht, Ihr seid zu jung!”
„Die Menschen sind gut,” rief Gerda, „sie sind wie wir auch, sie Alle haben eine Seele. Aber diese Seele schlummert, man muß sie wecken und dies schwimmende Land, dies reiche Land des Ueberflusses wird zum Paradiese werden.”
„Es waren Viele, die gingen zu ihren Brüdern, wie Ihr gehen wollt, weckten ihre Seelen und sprachen zu ihnen. Fragt mich nicht nach ihrem Lose.”
„Doch, dochl Was wurde aus ihnen?”
„Man tötete sie grausam! Man schlug sie ans Kreuz, verbrannte sie auf Scheiterhaufen, ließ sie in Gefängnissen verhungern und verderben, man riß sie in Stücke, oder man hörte nicht auf sie und verhöhnte sie grausamst. Wahret Euer Herz und Eure Zunge!”
„Vater,” sagte Gerd, „schweres Unrecht laden wir auf uns, wenn wir schweigen gegen besseres Wissen!”
„Vater, wir werden sie erlösen!” rief Gerda, „und sie werden es uns danken. Sie müssen ja einsehen, daß es für Alle das Beste ist und so leicht, das Rechte zu tun!”
„Armes, armes Lichtelflein!” Der alte Arbeiter sah das schöne Mädchen wehmütig an, wandte sich jäh ab und blickte versonnen in das Licht der Lampe. Sollten die Kinder nicht sehen, daß es ihm heiß in die Augen kam? Dann aber ging man zur Ruhe und von der Mission der Jungen war nicht mehr die Rede.
Gerd und Gerda zogen hinaus und sprachen zu ihren Brüdern der Tiefe. Gierig lauschten sie, wenn von dem Leben der Reichen die Rede war; sie begriffen, daß sie es auch gut haben sollten, aber nicht in Einfachheit, sondern in Fülle, dachten sie sich das neue Leben. Wie ein Märchen kam ihnen die Warnung vor, ihre Herzen zu hüten vor der Gier nach Schätzen, da an diesen ein böser Zauber klebe, der die Herzen zu Stein verwandelte. Sie begriffen nur, mit immer wachsendem Empfinden, daß auch sie eine Macht waren durch die Zahl, und daß sie es hell
[61]
und licht haben sollten und satt werden. Und sie verstanden nicht, daß Gerd und Gerda um ihre Seelen rangen. Die Gemeinde aber wuchs von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, und es war Keiner von den Vielen, die da im Dunkel lebten, der Gerd und Gerda nicht kannte und sie nicht liebte.
Der Traum einer besseren Zukunft aber wurde ihre Lebenshoffnung.
So schwanden die Jahre dahin.
Hier unter der Erde aber, wo es dumpf und muffig war und die Sonne nie hinkam, üble Dünste Tag und Nacht lagerten und Finsternis schwelte, da gingen Dämonen aus und ein.
Schlimme Dämonen! und ihnen folgte der Engel mit den schwarzen Flügeln. Frühzeitiges Altern, Not und Krankheit heißen diese Dämonen, aber oft haben sie auch andere Namen, wenn sie daher kommen, rasend als furchtbare Seuchen. Dann sterben Tausende und aber Tausende, Junge und Alte, der Säugling in der Wiege und der Greis an der Krücke. Und immer kehren sie wieder, diese Dämonen, in kurzen und langen Zwischenräumen, und so kamen sie auch eines Tages, als Gerd und Gerda noch halbe Kinder waren.
In den Jammer dieser ungelebten Leben, dieses sinnlosen Sterbens hinein, wimmerten die Glöckchen des guten Gottes in winselnder Ohnmacht. Und der Engel des Todes zeichnete jede Wohnstätte, daß der Toten so viele wurden, daß sie die Erde nicht bergen wollte. Da schaffte man die blassen, grünlichen Leiber hinaus, nur in Sterbetücher gehüllt und senkte sie die steile Küste hinab ins Meer, Dann tänzelte ein Zug der Raubfische um die Küsten, denn der Jammer der Einen war die gute Zeit der Anderen! Ohnmächtig aber rangen die Armen die Hände, Grauen hatte Alle erfaßt. Und der Dämon schritt vorbei an der ärmlichen, reinlichen Stube der Heizersleute und zeichnete sie. Und als der Morgen graute, lagen Gerds und Gerdas gute Eltern still und bleich und ließen die jungen Menschenkinder allein zurück.
Als Gerd und Gerda heimkamen vom letzten Geleit, das
[62]
sie den Eltern gegeben, standen sie in der verwaisten Stube und schauten sich voll Trauer in die Augen. Und plötzlich merkten sie, daß sie keine Kinder mehr waren, sondern Jüngling und Jungfrau. Da faßten sie sich bei den Händen und gelobten, sich nie zu trennen, weiterzuleben hier in diesem Stübchen, im Sinne der guten Eltern; und ihr Herz, ihre Seele und ihr Leben den Armen zu weihen.
Auf grauen Sohlen ging der Alltag aus und ein und das Leben nahm den gewohnten Lauf. Dem kräftigen Gerd hatte man gerne des Vaters Stelle gegeben, statt seiner stand er nun an der Maschine und speiste sie. Gerda aber waltete an der Mutter Platze im Hause. Leicht ging dem Feenkinde alles von der Hand, nichts hatte sich äußerlich geändert in dem einfachen Stübchen, nur daß es noch stiller und einsamer war denn sonst.
Und doch war alles ganz, ganz anders! Ein neues Gefühl, von dem sich weder Gerd noch Gerda Rechenschaft geben konnten, war in ihre Herzen gezogen. Wenn Gerd jetzt öfter Gerda ansah, mit einem Blicke, den er sonst nicht gehabt hatte, wurde Gerda rot und verlegen und begann irgend eine nutzlose Arbeit. Aber da kam der Tag, an dem Klarheit kam über Gerd. Er faßte Gerda bei der Hand und drückte einen langen Kuß auf ihre Lippen. Sprechen konnten und wollten sie nichts, es gab keine Worte für ihr Gefühl und das war auch nicht nötig, sie verstanden einander.
So kurz die Tage auch waren, Gerda dünkten sie lang. Gab es doch nicht viel Arbeit in der kleinen Häuslichkeit für zwei bescheidene Menschenkinder. Dann nahm Gerda die Leier der Feenmutter zur Hand und sie tönte neue Lieder zur Melodie ihres Herzens. Verklungen waren die Lieder der Sehnsucht, verklungen das Rauschen des Meeres, das an die Küste der glücklichen Insel schlug. Verklungen das Lied der Allmutter Natur, das Lied des sittlichen Menschengesetzes, verklungen, verweht! Nur Gerds Stimme tönte, nur Gerds Gedanken zogen durch Gerdas Herz, das war die Melodie ihrer Jugend.
Abends aber kam Gerd heim, wie der Vater heimgekommen,
[63]
rußig, schweißbedeckt. Dann wusch er sich und setzte sich zu Tisch und aß heißhungrig, was Gerda auftrug; dann aber kamen die schönsten Stunden.
Gerd und Gerda lebten nur für diese Abende. Sie vergaßen es, zu ihren Brüdern zu gehen, und Gerda stellte die Spaziergänge zur Küste ein, nach Insulinde auszuspähen. Sie hätte nicht einmal sagen können, ob sie froh gewesen wäre, wenn man das Geisterreich gefunden. Sie wollte nichts mehr wissen von den Herrlichkeiten der Welt, sie brauchte keine neue Heimat. Gerd war die ihre, ihr Schicksal, Gerd der Inbegriff alles Hohen und Schönen, Gerd war ihr Feenreich. Die glücklichen Inseln, ihre Flucht von dort, ihr Sehnen nach Insulinde, all das kam ihr vor wie ein Märchen, das sie nur geträumt hatte.
Weit, weit lag das alles zurück, verblaßt, ein Kästchen voll zarter Erinnerungen, über die sich die Zeit wie feiner, dichter Staub gelegt hatte.
War das Abendessen vorüber, setzte sich Gerda in den Stuhl der Mutter, dicht am Fenster und Gerd setzte sich zu ihren Füßen. Da neigte Gerda ihr schönes Haupt herab, ihre goldenen Locken fielen tief herüber und kosten Gerds zu ihr emporgerichtetes Antlitz und sie neigte sich, bis ihre Lippen auf Gerds Stirn ruhten. Mit schmalen, kühlen Händen zog sie Gerds Gesicht zu sich empor und suchte seine Lippen, und es war ihr, als könne sie nicht ausdrücken, was sie erfüllte, und als müsse ihr die Haut reißen, damit sie überströmen könne auf Gerd, eins mit ihm zu werden. Und sie nahm ihre Leier und sang Lieder, neue, nie gehörte, in denen es keinen Raum gab für Vater- und Mutterländer, rauschende Lieder eines erfüllten Herzens, Lieder mit Ewigkeitsmelodie. Da war auch Gerd in Insulinde.
Die Abendsonne sah zum Fenster hinein, ihre Lieblinge zu grüßen. Der Mond machte ihnen seine Aufwartung und die Sternlein kamen ungeladen zu Gaste. Aber Gerd und Gerda waren unhöfliche Wirte. Sie waren so mit sich beschäftigt, daß sie ihres Besuchers gar nicht gewahr wurden. Gerd sah die Welt nur durch den Goldschleier von Gerdas Haar, Gerdas Himmel war Gerds Gesieht,
[64]
seine Augen ihre Sterne. Aber den Gestirnen des Firmamentes, die schon so lange auf die Erde schauen, war der Anblick der in sich versunkenen Menschenkinder nichts Neues, wie oft hatten sie schon solche Weltentrücktheit erlebt. Sie waren daher Gerd und Gerda nicht gram und stellten ihre Besuche nicht ein, wollten sie doch sehen, ob ihre Lieblinge wohlauf waren und glücklich.
Ach, sie wußten nur zu gut, daß auf Erden kein Glück Dauer hat, und nur zu schnell blickten glückverträumte Augen naß und trüb wieder zum Himmel auf.
Gerd und Gerda würden die Sterne verlacht haben mit ihrer grauen Weisheit. Ihre Gefühle dünkten ihnen unzerstörbar und ewig. Um sie herum duftete es von Jugend, Lenz und goldenen Träumen.
Hatte ihr Glück kurz oder lang gewährt? Es war, als ob die Zeit den Atem angehalten und still gestanden hätte. Gerda wußte es später nicht mehr zu sagen.
[65]
8. Teil.
Der Fluch des Goldlandes.
Der Bug des schwimmenden Landes hatte sich durch den ewigen Anprall der Wogen schmal geschliffen und an diese Stelle hatte man einen hohen Turm gebaut, auf dem ein Wächter Tag und Nacht Ausschau halten mußte nach fernen Küsten.
„Land! Land! Land!” scholl es eines Tages vom Turme hernieder.
Eine ungeheure Aufregung bemächtigte sich der Bewohner des schwimmenden Landes, denn man sah bald mit bloßem Auge in der Ferne einen Streifen aufleuchten. Aber nicht wie sonst, wenn man Küste fand, dunkel, schmal als Linie am helleren Himmel, sondern hell und glänzend, daß man die Augen schließen mußte und sich geblendet abwandte, wenn man hinaussah. Da wußte man, daß man sich dem langersehnten Ziele näherte.
Man hatte das Goldland gefunden!
Auf dem schwimmenden Lande herrschte ein solcher Jubel und eine Begeisterung, die gar keine Grenzen kannte. Die Reichen hatten das Gefühl, daß irgend etwas geschehen müsse, um ihren Taumel auszudrücken, und sie waren auf den Gedanken gekommen, die Armen aus ihren Löchern ans Licht zu holen, damit auch sie die Größe des Augenblickes begreifen sollten. Man erlaubte ihnen, zu feiern und am Ufer der Küste zu stehen, mitten unter den Reichen, die Brüder zu ihnen sagten, auszuspähen, wie man dem hellen Strich näher und näher kam. Um Mitternacht erreichte man den fremden Strand.
Welch ein Land war dies Goldland! Es lohnte sich
[66]
schon, daß man Zeit und Mühe, Gut und Blut daran verwendet hatte, dies Land zu finden!
Ein heller Schein ging von ihm aus und erleuchtete das Meer mit zauberhaftem Glanze. Berge begrenzten es, wie zum Schutze, aber die Berge waren nicht aus Kalk und Granit, wie die übrigen Berge der Erde, sondern aus Edelgesteinen. Blitzend schossen weiße Berge empor, die waren aus Diamant, tiefrote aus Rubinen warfen Rosenlichter umher, solche aus Saphir leuchteten wie ein auf die Erde gesunkener Himmel, und kaum ertrug ein menschliches Auge das blendende Grün der Smaragden. Aus diesen Bergen brachen Wasserfälle hervor, die sprühten nicht Tropfen, sondern große, reine Perlen. Die Seen aber waren aus flüssigem Gold, Goldstaub deckte den Boden in weiten Flächen.
Trotz ihres großen Reichtumes aber mußten die Bewohner des Goldlandes Mangel leiden. Kein Fisch tummelte sich in ihren goldenen Gewässern, keine Blume und kein Korn wuchs auf den mit Goldstaub bedeckten Wegen, kein Tier des Waldes konnte sich nähren mit den smaragdnen Blättern der Bäume. Nur, wo das Land etwas erdig war, hatten sie zu essen. Nun hätten sie freilich in Fülle leben können und Handel treiben mit den Herrlichkeiten ihres Landes, aber sie waren hart und geizig und gönnten Niemanden etwas von ihren Schätzen. Sie waren auch kriegerisch und wild, nicht nur die Herren und die Knechte, sondern auch ihre Frauen und Kinder, denn sie lebten in steter Gefahr, beraubt zu werden.
Kaum waren sie des ungeheuer daher schwimmenden Landes ansichtig geworden, als sie ein Boot abschickten mit Gesandten, dessen Bewohner zu warnen und ihnen den Krieg anzukünden, falls es ihnen einfallen sollte, die Küste des Goldlandes zu betreten.
Das aber schreckte die Bewohner Eurasiens nicht. Ihre Schätzegier kannte keine Grenzen. Galt es doch, rotes Gold, Glück, Ruhm und Ehre zu erbeuten.
Die Feuermänner donnerten voll Ungeduld; solch wehrhaftes Land zu besiegen war ihr Beruf und ihre Aufgabe.
[67]
Und der König kam aus seinem prächtigen Schlosse. Stattlich sah er aus, den Purpurmantel um die Schultern, die Krone auf dem Kopfe. Er sichtete seine Feuermänner, viele hunderttausend, gab ihnen bunte Tücher an langen Stangen, Orden und Bänder und sprach zu ihnen. Er lobte sie, um ihren Mut noch mehr zu befeuern, er befahl ihnen, alles zu nehmen und nichts zu schonen. Dann wurden die Boote flott gemacht und unter wilder, tapferer Musik wurden die Feuermänner eingeschifft.
Da wurde der König der Armen ansichtig. Wie er wahrnahm, daß es ihrer so viele waren, wurde ihm heimlich bange. Der Feuermänner entblößt, brauchte er die Arbeitskraft der Armen doppelt. Sorgfältig verbarg er seine Gedanken und sprach liebevoll. Er sagte ihnen, sie sollten wieder zurückgehen in ihre Wohnungen, denn nun, da die Feuermänner nicht mehr da wären, gäbe es doppelt zu schaffen. Dafür aber sollte eine neue Ordnung auf dem schwimmenden Lande gemacht werden, eine menschliche, gerechte. Auch an Beute und Lohn sollten sie gemessenen Anteil erhalten. Nun endlich sollten sie einmal wirklich erfahren, daß sie alle Kinder seien eines Vaters im Himmel, Licht und Luft, Kleid und Heim, Anteil an der Seligkeit der ewigen Gärten werde ihnen zu Teil werden, sei erst der Krieg mit dem Goldlande glücklich beendet. Das aber könne nicht lange dauern, unbesiegbar und tapfer seien die Heere, gerecht und wahr die heilige Sache, für die sie kämpften.
Wie der König so redete, vergaß er ganz und gar, daß es die Angst war, die ihm diese Worte eingegeben hatte, und er fing an, an seine Größe und seinen Edelmut zu glauben und ihm wurden die Augen feucht ob der eigenen Güte.
Keiner aber war berauschter als die Armen. Nie hatte man so zu ihnen gesprochen! Wie hatten sie ihn verkannt, ihren gütigen König, wie hatte man ihn verleumdet, obwohl er das beste Herz der Welt besaß. Sie schrien ihm immerfort Heil zu, ja sie eilten geradezu an die Maschinen, schafften und schafften und gönnten sich weder Rast noch Ruh, weder Schlaf noch Nahrung. Wußten sie doch jetzt,
[68]
warum sie schafften und fronten, harrte ihrer doch eine Zukunft, wie sie sie kaum erträumt, das Paradies auf Erden!
Sie fühlten zum ersten Male, daß sie ein Vaterland hatten, das sie lieben konnten, und sie lobten den König ob seines Edelmutes und die Reichen ob ihrer gütigen Herzen.
Gerd und Gerda jedoch konnten ihre Angst nicht bannen! Sie waren die Einzigen, die dem Könige nicht trauten, die nicht glaubten, was die Reichen sagten, denn sie kannten den Zauber des Besitzes, und sie zweifelten daran, ob die starken, tapferen Bewohner des Goldlandes besiegbar wären. Und sie zogen wieder zu ihren Brüdern und warnten sie.
Aber diesmal konnten sie ihren Stimmen kein Gehör verschaffen. Flüche hallten ihnen entgegen, Drohungen trafen sie, sie mußten schweigen. Ohnmächtig kämpfte ihre bange Gewißheit gegen den Rausch der Masse.
Größer und größer wurde der Taumel. Das kam daher, daß täglich Blätter über das schwimmende Land dahin flogen, die waren weiß und licht wie Mövenflügel. Aber in sie hineingeritzt waren kleine, dunkle Zauberrunen, die gaukelten den Menschen alles vor, was sie zu hören wünschten. Sie erzählten von den Wundern des Goldlandes, die nun bald den Bewohnern des schwimmenden Landes eigen sein würden, sie sprachen von der Freiheit und Gleichheit aller Bewohner, sie kamen im Kleide der Wahrheit und waren die Lüge und sie waren es, die die Luft vergifteten und alle Köpfe wirr und taumlich machten.
Diese weißen Blätter trugen die Schuld, daß keinem so recht bewußt wurde, daß allnächtlich Feuermänner kamen und die Arbeiter von den Maschinen holten, junge wie alte, und diese verschwanden.
Dunkel waren die Gänge, durch die man die unseligen Scharen führte. Sie gingen wie Opfer, schweigend und sanft, Tränen in den Augen, milde und menschlich, schicksalsergeben. Man brachte sie in eine Halle des Schlosses, da stand eine Maschine, die webte Feuermannskleidung. Man riß den Armen die Lumpen herunter und steckte
[69]
sie in die Zaubergewänder und schon schossen Blitze aus ihren Augen, Feuer ging von ihnen aus und Strahlen zuckten von ihren Händen. Wie wild, wie schrecklich, wie furchteinflößend waren die Harmlosen, Milden geworden!
Sie wurden in Boote geladen und nach dem Goldlande gebracht. Aber dort wurden immer mehr und mehr Feuermänner nötig, und auch die Reichen mußten ihre Väter und Söhne ziehen lassen.
Da kam heißes, tiefes Leid über die Herzen des schwimmenden Landes. Aber je tiefer ein Leid ist, desto stiller ist es auch. Die Tränen versiegten vor allzu großem Wehe, die Herzen der Mütter und Frauen brachen lautlos, denn keiner wagte zu klagen im allgemeinen Jubel.
Und auch an diesem Jubel waren die Zauberrunen Schuld. Sie waren es, die die Trauer ächteten, denn sie hatten alles umgekehrt, Wahrheit wurde Lüge, Lüge Wahrheit, gut böse, klein groß.
Boote kehrten heim und brachten unermeßliche Schätze. Die wurden ins Schloß gebracht. Von den Feuermännern aber erhielt man keine Kunde.
Eines Morgens aber schäumte das Meer rot an den steilen Felsen empor, da war die Macht der Zauberrunen gebrochen vor der Wahrheit des Tages. Blut war in den Wellen und sie wälzten Leichname vor sich her. Alle Feuermänner kamen wieder, als Tote, als Ertrinkende, als Krüppel und Kranke. Boote kehrten zurück, aber nur verwundete Feuermänner bargen sie. Wie Wenige waren es, die Meisten lagen begraben im Goldlande.
Wieder begann ein Hasten auf dem schwimmenden Lande, die Feuermänner zu bergen. Schulen wurden geleert, so daß die Kinder nichts lernen konnten, man legte die Kranken in die großen Hallen neben die Maschinen, man steckte sie in die feuchten Löcher der Armen. Kaum aber hatte man ihnen die schmutzigen Feuermannskleider von den Leibern gezogen, als es vorbei war mit dem Zauber ihrer Schrecklichkeit. Nichts blieb von ihnen übrig als ein jammerndes, schwaches, mitleidheischendes Häufchen menschlichen Jammers.
[70]
Alle aber wollten leben, leben um jeden Preis! Doch der Tod hielt reiche Ernte, er kümmerte sich nicht um Menschenwunsch. Er kam zu den Jungen und verschonte die Greise, er kam zu den Heilen und ließ die Krüppel zurück, er nahm den Müttern die Einzigen, ließ die Zahlreichen leben. Den Fischen im Ozean, den Hyänen des Meeres aber ekelte es ob der reichen Speise, die ihnen wurde.
Totenblaß, mit verweinten Augen, die Hände ab und zu auf das zuckende Herz pressend, lief Gerda durch die Säle. Ueberall hatte sie ein trostreiches Wort, einen liebevollen Blick, überallhin legte sie lindernde, kühlende, schmale Hände.
Unterdessen hatte man so viel Schätze im Goldlande geraubt, daß die Zimmerleute und Baumeister emsig schaffen mußten, dem Könige große Speicher zu bauen, um alles zu bergen. Den Armen von dem großen Reichtume zu geben, daran dachte der König nicht.
Der großen Gerda aber war es, als sei sie wieder die kleine Gerda und erst vor wenigen Stunden von den glücklichen Inseln auf das schwimmende Land gekommen. Wieder verstand sie nichts von dem, was um sie vorging, wieder mußte sie sich wundern, wieder schien ihr alles tiefster Geheimnisse voll. Warum tat man das, worunter man litt? Warum hungerten die Armen mehr denn je, weil man ihr Brot zu den Feuermännern ins Goldland brachte, und wagten doch nicht, zu murren? Wie zitterten die Männer, die man nachts heimlich holte, vor dem unbekannten, grausamen, unnatürlichen Tode, und doch wagte keiner, sich aufzulehnen? Jeder fühlte, wie das sinnlose Morden, der Krieg das Verderben des Landes werden mußte, aber alle gebärdeten sich, reich und arm, jung und alt, als geschähe das einzig Wahre und Rechte.
Wieder wimmerten die Glöcklein des guten Gottes bei Tag und Nacht.
„Du sollst nicht töten!” stand in den heiligen Büchern, aber die Priester sagten, Mord sei erlaubt im Kriege! „Du sollst nicht stehlen!” sagten die heiligen Bücher, aber die Priester sagten, Beute machen sei erlaubt im Kriege. „Du
[71]
sollst nicht begehren” stand in den heiligen Büchern, aber alle begehrten. Und der Krieg war verboten von Gott, aber erlaubt, wenn der Staat ihn befahl. Und alle taten, als seien die heiligen Bücher das Gesetz des Landes, und doch gab es keinen, der sich nach ihnen gerichtet hätte.
Gerd kam wenig heim. Er stand an der Maschine, ölte und heizte. Eines Tages brachte ihm Gerda, wie gewöhnlich sein Töpfchen mit Essen. Gerd setzte sich auf die Kohlen nieder und löffelte gierig, während Gerda vor ihm stand und ihm liebevoll zusah, ob es auch schmecke.
War es der Widerschein der Flamme, war es Fieber? Gerd sah ungewöhnlich erregt und erhitzt aus.
„Gerda, höre, ich will dir etwas anvertrauen. Komm näher, ich muß es ganz leise sagen. Heute Nacht, als alles schlief, kam der König hier hinab. Er war ernst und bleich, seine vornehmen Feuermänner waren bei ihm und sprachen mit ihm. Sie sprachen sehr leise, indem sie die Maschine von allen Seiten besichtigten, aber ich verstand sie dennoch. Du weißt, es geht vom Könige aus, nur gute Runen auf die weißen Blätter zu setzen, die Wahrheit zur Lüge machen. Er aber hat die wahre Kunde. Zauberkugeln gießt man im Goldlande, in denen wohnt ein tausendfacher Tod. Damit wollen sie das schwimmende Land treffen und es versenken in den Fluten des Meeres. Nur schnelle Flucht kann uns retten. Heute noch soll das schwimmende Land flott gemacht werden, denn alle Feuermänner, die noch im Goldlande sind, gibt man preis. Die Vornehmen, die an den gesicherten Stellen standen, sind schon alle heimlich zurückgekehrt, um die anderen aber trauert man nicht. Dann bleibt alles wie es war, seit eh und jeh, denn der König denkt nicht daran, sein Versprechen zu halten. Er hat sein rotes Gold, wir unsere Not, und so werden wir dahin treiben, sie oben, wir unten, durch Zeit und Ewigkeit!”
„Entsetzlich!” hauchte Gerda.
„Siehe, Gerda, jetzt ist meine Zeit gekommen!”
„Deine Zeit, Gerd? Was meinst du mit deiner Zeit, Liebster?”
[72]
„Wir werden uns selbst helfen und Gerd wird König sein!”
„Und das Gesetz der glücklichen Inseln erfüllen?”
„Und das Gesetz der glücklichen Inseln erfüllen!”
O, Gerd, mein Gerd! Dann hat doch all die Not, der Jammer, die Tränen einen Sinn gehabt!”
„Schweige, gehe heim, warte!” flüsterte Gerd.
Gerda legte die Arme um Gerds Hals. All ihre Hoffnung, ihre Liebe, ihre Angst drückte sie in einem langen Kusse auf Gerds Lippen.
Dann ging sie und sah sich immer wieder und wieder nach Gerd um, der ihr freundlich jedesmal von neuem zuwinkte.
„Machet das Land flott, eilig, eilig!” tönte der Befehl. Aber es war zu spät. Heimlich hatten die tückischen Bewohner des Goldlandes unterirdisch die Wogen durchschwommen und der großen Maschine ein Leck beigebracht. Ueberallhin warfen sie ihre tötenden Goldzauberkugeln, auf Riesenflügeln durchschwirrten sie die Luft, von unten und oben kam der Eroberer Tod und häufte Not und Jammer auf das schwimmende Land.
Da kam der König aus seinem Schlosse, sein Gesicht war bleich und Angst lag auf seinen Zügen. Er bat die grimmen Bewohner des Goldlandes um Frieden. Auch die waren des langen Mordens müde und willigten ein, wenn man ihnen alle Nahrung gäbe, die auf dem schwimmenden Lande zu haben sei. Der König billigte dies zu, erlaubte aber, daß die Reichen heimlich ihre Vorräte beiseite schafften und gab die der Armen. Da es nun so viel Arme auf dem schwimmenden Lande gab, so machten ihre kleinen Teile doch eine große Menge aus. Damit waren die Goldmänner zufrieden. Sie bauten große Kähne, verluden ihre Beute und zogen von dannen. Inzwischen war auch die große Maschine wieder heil geworden und blitzschnell floh das schwimmende Land dahin. Hinaus in die blaue Unendlichkeit des Weltenmeeres!
[73]
9. Teil.
Die vergebliche Befreiung.
Wieder senkte sich der graue Alltag über das schwimmende Land. Aus den ewigen Gärten tönte Musik und man feierte Feste, und der König residierte in seinem wundervollen Schlosse. In der großen Halle aber sangen die Maschinen wieder ihr Lied, das Lied der Arbeit und das Lied der Fron. Wieder wimmelte es in den dunklen Löchern voller Menschen, noch immer waren es viel zu viele und keiner sah die Lücken, die der Tod gerissen.
Von den Reichen aber gedachte keiner der Armen.
Diese hofften und harrten, denn sie glaubten den Worten ihres Königs. Sie litten mehr denn je.
Als aber der Hunger so quälend wurde, daß er nicht mehr ertragen werden konnte, als die Kinder in der Wiege starben und die Alten dahinwelkten wie Gras an heißen Sommertagen, da erfaßte die Armen eine nie gekannte Verzweiflung.
Sie wählten drei ihrer klügsten Männer aus und sandten sie zum Könige, ihn an sein Versprechen zu mahnen.
Aber der König war ärgerlich, daß man es wagte, ihn zu stören, denn er hatte in der Tat nie daran gedacht, sein Wort zu halten, und er gab den Armen eine harte Antwort. Voll Trauer verließen sie das Schloß und kehrten voll Zagen zu ihren Brüdern heim.
Da mußten sich die Armen selbst helfen, wollten sie nicht alle elend verkommen.
Auch einen Führer wollten sie wählen. Das konnte nur einer sein, und sie kamen zu Gerd!
„Gerd, du hast uns die Sehnsucht gelehrt, du hast uns das Auge geöffnet, du hast vorausgeschaut, wie es kommen würde! Du bist der Würdigste, hilf uns, sei unser Führer!”
[74]
Gerd reckte sich hoch! Er war ein Mann, ein starker Mann, der Mut lachte aus seinen graugrünen Augen, seine buschigen Brauen zogen sich hoch und seine Muskeln spannten sich. Er dachte der Worte seines Vaters, hob seine großen Hände zum Himmel und sprach:
„Ruft ihr mich, meine Brüder! Wohlauf, wohlan, ich will euch nicht folgen, sondern vorangehen. Wir wollen unsern Platz erkämpfen, der uns als ihren Brüdern gebührt im Paradiese der Welt. Dort oben wollen wir die glücklichen Inseln errichten! Aber schwören müßt ihr, eines schwören. Verzaubert ist das Gold, verzaubert die Herrlichkeiten der Reichen. Wer sie berührt, dem versteinen sie das Herz und er kann nie wieder erlöst werden. Manche von uns fanden den Weg nach oben, aber sie kehrten nicht mehr zurück, sie vergaßen ihre Brüder, der Zauber nahm ihnen die Erinnerung. Darum hütet euch, irgend etwas zu berühren oder an euch zu nehmen, esset auch nicht von ihren Speisen, sondern wartet, bis man euch geben wird. Schonet die Reichen, denn wenn ihnen ihr Gut genommen, sind sie wie wir und werden wieder unsere Brüder sein und mit uns leben. Kein Blut rinne über eure unbefleckten Hände, damit unser neues, heiliges Gesetz rein bleibe.
Schwöret mir dies, schwöret mir dies, o, meine Brüder!”
Da trat Gerda hinzu, entfaltete ein großes Tuch und heftete es an eine Stange. Das Tuch war blau wie der Himmel, aber nach unten wurde es dunkler und dunkler, tiefblau wie die Wogen des Meeres. Ueber diesen dunklen Wellen aber schwebte eine silberweiße Taube, die trug einen Oelzweig im Schnabel.
„Dies webte ich für euch,” sagte Gerda mit nassen Augen, „dies ist eure Fahne, tragt sie treu!”
„Es lebe Gerd, es lebe Gerda!” riefen hunderttausend Kehlen, „wir schwören, wir schwören!”
„So gelobe ich euch, euch frei zu machen und glücklich! Ich will der erste Hüter des Gesetzes sein, die Tage der glücklichen Inseln sollen erstehen und euch eine neue Jugend geben und Gerda eine neue Heimat, die Heimat
[75]
ihrer Kindheit! Deshalb wurde uns das Feenkind gesandt, daß ihr Schicksal uns zum Segen werde!”
Da fielen sich alle in die Arme, weinten und küßten sich!
Und es drängte sich ganz von selbst ein Lied auf ihre Lippen und eine Melodie in ihre Kehlen, als sie sangen:
Zum heilgen Kampf ziehn wir hinan,
Zum Kampf für unsre Menschenrechte,
Wir wollen leben nur im Sonnenlicht!
Wir wollen weder Herren sein, noch Knechte!
Uns lockt nicht euer rotes Gold,
Nicht euer Tanz um hohle Güter,
Nicht länger stehen wir in eurem Sold,
Wir wollen Menschen sein, des Rechtes Hüter!
Dann fluteten sie hinauf, ein Riesenstrom, der alle Dämme bricht!
Schweigend zogen die Massen dahin. Zogen durch das goldene Tor. Der künstliche Himmel über ihnen mit den tausend Lampensonnen, die Straße der tausend Glashäuser, die Musik, die Fülle der Blumen mit ihren berauschenden Düften, alles benahm ihnen zuerst den Atem, verwirrte sie ganz. Die geputzte Menge der Reichen, nicht wissend, was das alles zu bedeuten hatte, sah zuerst halb ängstlich, halb neugierig zu. Als sie sich aber klar wurden, daß all diese Menschen waffenlos waren, sie aber die Feuermänner zu ihrem Schütze hatten, fielen höhnische Reden.
Als aber die Armen sahen, um welche Güter man sie betrogen, wie entsetzlich ihr Leben gewesen, wie hier eine Fülle herrschte, wo vieles verdarb durch das Uebermaß der Menge, da bemächtigte sich ihrer eine dumpfe Wut und eine solche Raserei, daß sie alles vergaßen, was sie eben noch gelobt hatten. Wie Rasende stürzten sie auf die Reichen zu, rissen ihnen die Kleider vom Leibe, schlugen mit Fäusten auf sie ein, so daß die Luft zitterte von den Schreien der Angst, dem Röcheln der Sterbenden und der saftgrüne Rasen rot wurde vom Blute der Erschlagenen.
Woher kamen sie alle, die Steine? Sie waren da und
[76]
flogen in die großen Scheiben der Glashäuser. Splitter krachten heraus, die Menge fiel über die kostbaren Dinge her, stopfte sich die Taschen voll mit dem Sinnlosesten und verschlang voll Gier die langentbehrten Speisen. Die Kuchen und Weine erhitzten ihren leeren Magen noch mehr, sie kannten sich selbst nicht wieder, kein Zuruf, keine Stimme der Vernunft, kein Wort der Menschlichkeit erreichte ihr Ohr, vermochte ihrem Treiben Einhalt zu gebieten. Der böse Zauber war am Werke.
Wie ein Lauffeuer drang die Kunde der Selbstbefreiung der Armen durch die ewigen Gärten. Hin zum funkelnden Schlosse drang sie, wo der König wohnte. Der sammelte seine Feuermänner, legte seinen majestätischen Purpur um die Schultern, setzte seine goldene Krone aufs Haupt und kam eilends heraus. Sein Gesicht war blaß und verzerrt, aber diesmal vor Wut.
„Zerschmettert sie!” schrie er den Feuermännern zu.
Die vornehmen Feuermänner stellten sich schützend, vor den König, sie feuerten die niederen an, aber diese standen unschlüssig. Blitzschnell zog das harte Los vorüber an ihrem inneren Auge, das sie jahrelang erduldet von den Reichen, auch ihnen dämmerte es, daß die Stunde der Befreiung schlug. Plötzlich drehten sie dem Könige den Rücken, stürmten unter die Masse der Armen, ihren Brüdern zu helfen.
„Verräter, Treuloser, ehrloser Bube, wortbrüchiger Schuft!” so schrien sie dem Könige entgegen. Sie stürmten auf ihn ein, blitzschnell hatten sie ihm die Krone vom Haupte geschlagen und den Purpur von den Schultern gezerrt, und ehe die bestürzten Vornehmen auch nur ein Glied rühren konnten, ihn in Stücke gerissen. Weit umher spritzte sein Blut.
Gerd hielt noch immer Gerdas Fahne in der Hand. Sein Gesicht war entstellt vor Entsetzen über den allgemeinen Wahnsinn, der seine Brüder erfaßt hatte. Er schrie Befehle, aber er wurde gar nicht beachtet. Und diese Nichtbeachtung schmerzte. Da blitzte ein Gedanke durch sein Hirn.
„Ich werde mich zum Könige machen,” dachte er, „mir
[77]
werden alle gehorchen, die Armen wie die Reichen, ich werde Ruhe und Ordnung stiften.” Er bückte sich nieder, ließ die Fahne fallen, die blaue Fahne mit der weißen Taube und dem Oelzweige des Friedens und griff nach Purpur und Krone.
Aber Gerda, die nicht von Gerds Seite gewichen und ängstlich auf ihn geschaut hatte, fiel ihm in den Arm.
„Gerd, Gerd,” flehte sie, „laß die Krone liegen! Hast: du nicht beschworen, daß nichts berührt werden soll?! Wahre deine Seele. Siehe, auch diese werden zur Besinnung kommen und sich schämen, dann aber war Gerd der Würdigste, denn seine Hände allein blieben rein!”
Gerd hatte schon die Krone berührt. Glatt und süß schmeichelte der Reif den rauhen Händen, wundersam blitzten die Edelsteine, herrlich war die Krone, über alle Maßen herrlich!
„Laß mich los, Gerda,” rief er mit veränderter Stimme, „laß mich los, halten die etwa ihr mir gegebenes Wort? Ich komme aus ihrer Mitte, warum soll ich anders sein als sie? Nur wenn ich ihnen gleiche, werde ich sie zwingen. Feenkinder und solche von glücklichen Inseln haben keine Macht über solche Gemüter. Kleine Idealistin, du kennst die Menge nicht!”
Ehe es Gerda hindern konnte, war sie bei Seite geschoben, und schon lag der Purpurmantel um Gerds Schultern und die Krone blitzte auf seinem Haupte.
„Es lebe Gerd, es lebe unser König Gerd! Der Volkskönig Gerd, er lebe!” riefen jetzt alle Armen und die Reichen stimmten ein. Es trat Ruhe ein, die Arme sanken herab. Gerd winkte den Feuermännern. Die brachten Nahrungsmittel aus dem Schlosse und Gerd ließ reichlich verteilen. Er sprach zu allen, versprach allen, was sie hören wollten, den Armen wie den Reichen, winkte den Feuermännern und ging ins Schloß.
Als Gerd dahinschritt durch die hohen Säle, die durch, große Spiegel sein männliches Bild hundertfach zurüwarfen, war es ihm, als sei er zum Herrscher geboren. Die ganzen Ereignisse seiner Jugend, sein Erleben, sein Kampf, es waren nur Stufen gewesen, ihn zu dem zu
[78]
machen, was sein wahrer Beruf war, zum Herrscher! Der Glanz der Krone umnebelte seinen Sinn, der Purpur schmeichelte warm und weich, der Zauber wirkte und die Not der Armen verblaßte mehr und mehr, wurde immer unwirksamer und entschwand seinem Gedächtnis. Er setzte sich an die prächtigen Tafeln, er trank aus den goldenen Pokalen, er kostete die süßen Speisen und es durchzog seinen Sinn, daß doch die Armen selbst schuld seien an ihrem Lose, indem sie nicht genüg arbeiteten und sich auflehnten gegen die Ordnung der Welt. Diese Weltordnung bestand nun schon Jahrtausende lang, keinem war es gelungen, sie zu ändern, und daher war sie die einzig mögliche Ordnung überhaupt, gottgewollt und gottgegeben, und Gerd beschloß, sie wieder herzustellen. Aber so fest und unerschütterlich, daß ihm keiner nach der Krone greifen konnte, wie man es dem Könige getan hatte, der nun tot auf dem grünen Rasen lag, ein Opfer der Empörung!
Kluge Gedanken kamen Gerd, sehr kluge Gedanken. Sinnend stand er vom Mahle auf und ging in den Schloßhof. Er sammelte seine Feuermänner um sich, vor allem die Vornehmen und sprach milde Worte zu ihnen, und ließ die Schatzspeicher öffnen. An Gold und Silber hing sein Herz nicht. Wenn ihm die Krone blieb, floß dieses wie ein Zauberstrom wieder in seine Speicher zurück. Verschwenderisch senkte sich die gleißende Pracht auf die Erstaunten, auf hohe wie niedere Feuermänner, und da waren sich alle einig, daß nur Gerd der König sei, dem man die Treue halten müsse. Keiner vor ihm und keiner nach ihm konnte im Lande gefunden werden, wie Gerd, so freigebig, so stattlich, so reich an allen Herrschertugenden. Und sie huldigten ihm!
Der König Gerd ging hinaus zu seinen Brüdern und sprach zu ihnen:
„Gehet ruhig zurück an eure Arbeit, ich will darüber nachdenken, wie euer Los zu bessern ist. Aber arbeiten müßt ihr, sonst verhungern wir alle und das ganze Land geht zu Grunde. Ihr seid das Fundament des Volkes. Euer sittlicher Wille sichert das Bestehen des Landes, es
[79]
kann also euer Wille nicht sein, daß wir nicht fortbestehen sollen. Wohl sind wir alle gleich und alle Kinder der Mutter Natur, aber sie selbst, die Unerforschliche und Allmächtige hat gewollt, daß Ungleichheit bestehe. Gibt es nicht hell und dunkel, Tag und Nacht, Sommer und Winter, heiß und kalt? So will es die natürliche Ordnung der Welt und sich gegen diese auflehnen, ist Frevel an ihren göttlichen Gesetzen. Aber ich will alles für euch tun, was geschehen kann, ich selbst will versuchen, die Gesetze der Natur zu mildern und verbessern; gehet an eure Arbeit, ich denke für euch und gebe euch mein Wort als König!”
„Höret doch den Verräter! Sein Wort will er uns geben, das wird das einzige sein, was wir bekommen! Wir sind es, die ihn zum Könige machten, und schon sind wir verraten und verkauft! Der Schuft, der Wortbrecher, der Teufel! Nieder mit ihm, zerschmettert ihn, reißt ihn in Stücke!”
„Das will ich euch lehren, ihr Lumpengesindel,” schrie Gerd, außer sich vor Zorn und Wut! „Wer hat denn geraubt, geplündert und gemordet, wenn nicht ihr. An meinen Händen klebt kein Blut, sie sind rein!”
„In Stücke mit ihm, in Stücke mit ihm!” tobte die Menge und drang auf Gerd ein.
Im selben Augenblick aber donnerten und blitzten die Feuermänner, Feuer brach aus ihrem Munde und Strahlen gingen von ihren Händen aus.
Ein Wehegeschrei, lang und gellend, hallte durch die Luft! Feuer spritzte umher, grau, dunkel, zerrissen, in blutigen Fetzen lagen die Leichname der Armen auf dem Sammetteppich des Rasens, zwischen den Spiegelscheiben, auf goldenen Kleidern, zwischen Perlen und Edelsteinen. Schritt für Schritt drängten die Feuermänner vor bis zu der engen Treppe, die zu den Löchern der Armen führte, und mit dumpfem Klagelaute sanken alle hinab, die hoffnungsvoll das Licht der Sonne begehrt hatten.
[80]
10. Teil.
Am Urquell des Alls.
Ganz betäubt, unfähig sich zu rühren oder auch nur einen Laut hervorzubringen, stand Gerda noch immer an dem goldenen Tore. Sie sah die Feuermänner anrücken, sie streckte die Arme gegen Gerd aus, ließ sie aber kraftlos wieder herabsinken. Sie wollte schreien, aber sie konnte es nicht. Da zuckte eine Flamme neben ihr empor. Ein ganz kleines, unschuldiges Kind, das an der Hand einer Frau trippelte, wurde davon erfaßt. Mit einem Wahnsinnsschrei lief die Mutter davon, das Kind aber wimmerte tierisch in solchem Jammer, daß Gerda die Sinne verließen. ......
Als sie erwachte, befand sie sich noch immer an dem goldenen Tore. Sie saß auf dem Boden, den Kopf gegen das Gitter gelehnt. Es war sehr still und nicht sehr hell um sie, der künstliche Himmel lag in purpurner Schwärze, nur verstreut glomm ab und zu eine der Lampensonnen. Die Maschinen die sie speisten lagen still. Verschwunden war die geputzte Menge, verschwunden die Toten und die Feuermänner, aber Gerda dachte über nichts nach, nur eines durchhallte ihren Sinn: „zu Gerd, zu Gerd, vielleicht kann ich ihn retten!”
Sie näherte sich dem Schlosse. Vor diesem stand eine lange Reihe von Feuermännern und ihre Augen leuchteten bedrohlich.
„Laßt mich hineingehen,” sagte Gerda zu ihnen, „ich muß Gerd sprechen!”
„Der König ist für keinen zu sprechen,” sagte ein Feuermann barsch.
[81]
„Du kennst mich sicher nicht, ich bin Gerda und muß zu Gerd!”
„Bist du taub! Der König empfängt nicht!” schrie jetzt der Feuermann.
„Dann werde ich warten, bis er empfängt,” sagte Gerda und preßte die Hände aufs Herz. „Liebe wird ihn erlösen,” dachte sie.
„Nochmals, hinweg da!”
„Ich sagte dir, ich stehe hier und werde warten, bis Gerd kommt,” wiederholte Gerda.
Da begann der Feuermann zu donnern, laut und heftig, um Gerda einzuschüchtern und zum Davonlaufen zu bewegen. Aber Gerda blieb ruhig stehen.
Schon wollte der Feuermann Hand an Gerda legen, um sie gewaltsam zu entfernen, als König Gerd aus seinem Schlosse kam, um zu sehen, was es gäbe.
Als er Gerda sah, zuckte er zusammen. Diese Erinnerung an die Tage der Kindheit im engen Stübchen, am Feuerloche der Maschine waren König Gerd gar nicht willkommen.
„Ach Du bist es, mein weißes Hühnchen”, lachte Gerd gezwungen. „Jetzt bin ich König, bist Du nun zufrieden?”
„Zufrieden? Gerd! Bist Du von Sinnen! Ich soll zufrieden sein? Du hast unsre Brüder verraten, Du hast gemordet, Blut klebt an Deinen Händen. Lege die Krone ab, und sie werden vergeben und vergessen. Dein ist jetzt die Macht, erfülle das Gesetz der glücklichen Inseln!”
Es schien dem Könige Gerd, als sähen die Feuermänner, die noch dem alten, echten Könige gedient, verächtlich auf einen Mann, der so stark und stattlich war, und einem jungen Weibe diese kühne Sprache gestattete. Der Zorn kam in ihm hoch.
Aber etwas in ihm hinderte ihn, Gerda ohne Antwort zu lassen.
„Erinnerst Du Dich des Vaters,” begann er, „er war es, der da sagte, daß man diesen Menschen nicht das Gesetz der glücklichen Inseln lehren dürfe, da sie nicht reif seien es zu leben. Haben sie nicht, was sie brauchen? Jedes Volk hat das Maß Freiheit, das ihm zukommt, und
[82]
das es sich erringt im Laufe der Jahrtausende, Wenn sie nicht mehr haben, ist es ihre Schuld, nicht die Meine. Darum schweige Du. Was kann ich für Dich tun? Du warst mein Pflegeschwesterchen, und ich will Dir Deinen Wunsch erfüllen.”
„Gerd, Gerdlein, Einziger, wirf diese Krone von Dir, und der Zauber wird weichen. Kehre mit mir zurück in das Heim der Eltern, Gerdas Hände sollen Dir ein Schloß aufbauen, Gerdas Goldhaar soll Deine Krone sein, Gerdas Herzblut Dein Purpurmantel! Die Sterne werden uns besuchen, der Mond wird unser Schloß versilbern, die Sonne vergolden, Tag und Nacht werden wir im Paradiese sein, wir werden glücklich sein und glücklich machen, König Gerd, Königin Gerda!”
Unbeweglich, eisern standen die Feuermänner. Kein Zug ihrer Gesichter verriet, was sie über diesen Vorgang dachten. Sie schienen nicht zu sehen, wie Gerda auf Gerd zulief, wie sie seine Hände erfaßte, an ihm niederglitt und mit Inbrunst jeden Finger zu küssen versuchte und wie diese Hände feucht wurden von Gerdas Tränen. Aber König Gerd stand in tödlicher Verlegenheit, er wurde rot und blaß und beugte sich nieder. Hastig flüsterte er:
„Steh' auf! Willst Du wohl aufstehen, was soll denn dies hündische Gebahren, es ist Deiner und meiner unwürdig! Hast Du einen Wunsch, so sage ihn schnell; denn mich rufen wichtige Geschäfte von hier!”
Gerda hatte sich erhoben. Sie wußte nicht wie ihr war. Dicht über dem Herzen fühlte sie eine leere Stelle, sie taumelte und schloß die Augen. Dann aber öffnete sie sie wieder und suchte die Gerds. Der aber hatte sich abgewandt, fremd, verzaubert, verloren!
„Armer, armer Gerd, was könntest Du Gerda geben?” sagte sie leise und traurig. Und sie sah ihn nochmals an mit den Augen der Liebe und legte ihre ganze Seele in ihren Blick, dann wandte sie sich um und ging von dannen. Gerd war schon auf dem Wege zum Schlosse.
Wohin? Gerda wußte es nicht. Die Füße konnten sich kaum vom Erdboden heben. Alles verloren, versunken. Was hatte sie gemeinsam mit diesem schwimmenden
[83]
Lande, das ihre Heimat nicht war, weil es von Wesen bewohnt war, die noch nicht Menschen waren? Was hatten diese Wesen gemeinsam mit Gerdas Seele? Und mit Schrecken erkannte Gerda, daß auch sie nicht mehr die Seele hatte, die sie von den glücklichen Inseln mitgebracht. Wohl blutete ihr Herz noch um ihre armen Brüder, aber sie fühlte, daß auch sie eines Verrates fähig wäre, um ihrer großen Liebe willen!
Gerd! Gerdlein! Aber Gerd war nicht mehr, und König Gerd glich ihm nicht, er war verzaubert. Und selbst Gerda konnte ihn nicht erlösen.
Wohin? Nach Insulinde würde das schwimmende Land nie kommen. Gerda wußte plötzlich, daß es auf einem andern Sterne liegen mußte. Aber auch nach den glücklichen Inseln würde es nie mehr finden. Warum auch? Dort würde der Vater tot sein, und Keiner würde der Schuldig-Unschuldigen vergeben.
Aber sterben, das konnte sie. Sie würde sich von der steilen Küste ins Meer fallen lassen. Die Fische würden das Kind der Fee verschonen, die Wasser würden es sanft dahintreiben bis zum Strande der glücklichen Inseln. Die tote, kleine Gerda würde man dort aufnehmen, hob doch der Tod die strengsten Gesetze auf, und sie würde Ruhe und Frieden haben, und man würde sie betten neben der Mutter Grab. ...
Bald stand sie an der steilen Küste und breitete ihre Arme aus. Unergründlich rauschte das Meer unter ihr-seine Ewigkeitsmelodie, Perlmutterglanz schimmerte über Himmel und Wasser. Da neigte sich Gerda weit über die steilen Felsen, die ins Meer hinabschossen. ...
Aber sie fiel nicht. Sanft wurde sie zurückgezogen und stand wieder auf dem Boden. Neben ihr stand ein Jüngling, herrlich wie kein irdisches Wesen, in nackter Schöne. Regenbogenfarbige Fittiche flockten an seinen Schultern, seine Augen leuchteten wie Sonnen, sein Haar flammte gen Himmel. Er faßte Gerdas Hand, sein anderer Arm wies ins Unendliche.
„Siehe!”
Gerda sah in den Raum hinaus, der war dunkel und tief
[84]
wie purpurschwarzer Sammet. Der Genius erfaßte Gerda und glitt mit ihr hinein ins unendliche Dunkel. Mit Gedankenschnelle glitten sie dahin, durch Raum und Zeit, auf einen Lichtpunkt zu. Der weitete sich. Ein Feuerozean, unermeßlich, wie Milliarden Erdenmeere glühte den leeren, dunklen Raum an, aber die unendliche Nacht war weder zu erwärmen noch zu erhellen. Stumm ruhte sie in ewiger Schwärze und Eiseskälte. Da schwang sich ein Riesenweib heran, das warf gläserne Pfeile in den weißglühenden Urnebel. Die zergingen wie nichts. Aber das Weib warf mehr und mehr, des Spieles nimmermüde, sie griff sie in ewiger Fülle aus der Nacht selbst. Da begann der Feuersee zu wogen und zu brausen.
„Wer ist die Riesin?” fragte es wortlos in Gerda.
„Die Weltraumkälte!” entgegnete der Jüngling ebenso.
Die Urnebel begannen sich zu drehen, erst langsam, dann schneller und schneller in rasendem Wirbel.
Funken flogen heraus aus dem See, Riesentropfen, jeder eine ungeheure, weißglühende Sonne. Von den Sonnen aber lösten sich Monde, von den Monden Nebenmonde, und nun leuchtete der Raum, übersät von Sternen. Eine göttliche Kraft erhielt sie schwebend, rhythmisch ordneten sich ihre Bahnen zum Weltentanze, und ihr Kreisen erzeugte Klänge, Gesänge der Sphären, unvernehmbar einem irdischen Ohre. Wohl verfehlte der eine oder andere der Sterne die Bahn, zerschellte, erlosch und löste sich in Urnebel auf. Der aber gebar einen neuen Stern an Stelle des vergangenen, jung, leuchtend hell, Wunder der Welten! Kaum geboren, stimmte auch er ein in das Preislied des Alls. Im ewigen Wechsel des Werdens und Vergehens schmückte sich die Weltnacht mit immer neuer Sternenpracht.
Der Genius glitt vorbei mit Gerda an Sonnen, deren Größe kein Hirn faßt, bis zu einer, die kleiner war als die anderen, aber noch riesig genug. Und von ihr wieder zu einem Sternchen, einem der winzigsten im Raume, gemessen an der Majestät der anderen.
Als sie näher kamen, sahen sie eine herrliche, rotglühende Kugel.
[85]
Diese Kugel drehte sich in rasender Schnelle um sich selbst und dann um ihre Sonne. Sie glich einem Feuerriesen und atmete Dampf und Glut, aber auch mit ihr trieb die Weltraumkälte ihr Spiel. Schon nach ein paar Umdrehungen wurde sie dunkel und fest, aber immer wieder brach Feuer aus ihr heraus. Doch nicht lange, und nach ein paar Umdrehungen wurde sie dicht und grün. Aus ihrem dunkelen Schoße schossen Paradiese empor, Pflanzen und Tiere in sonderbarer Gestalt, märchenhaft, koboldartig, herrlich im Wechsel von Tagen und Nächten.
Wieder machte der Ball ein paar Umdrehungen, und die Pflanzen wurden bunt, die Tiere noch abenteuerlicher und seltsamer. Drachen und Kröten von Fabelgröße, Ungeheuer aus einem Riesenbilderbuche. Die tummelten sich in warmen Meeren, die jagten sich, mehrten sich und verschwanden. Aber sie machten nur Neuem Platz. Immer neue Formen von Pflanzen und Tieren kamen heran. Alle Geschöpfe wurden zierlicher, formvollendet, die Blumen leuchtend bunt, so daß ihre älteren Geschwister sich ausnahmen, wie drollige Erstlingsversuche einer noch ungelenken Schöpferhand. Aber es war, als sei der Erdball auch dieser Geschöpfe müde; denn plötzlich neigte er seine Achse und änderte seinen jahrmilliardenlangen Lauf. Da erwachten die Eisriesen, die an seinen Polen geschlummert hatten, schüttelten die ungelenken Glieder und begannen ihre Wanderung nach Süden. Weit hinab wagten sie sich, die mächtigen Giganten, gehüllt in Mäntel aus Kristall und blitzendem Schnee. Mit harten Füßen zertraten sie die wehrlosen, zarten Pflanzen, und die beweglichen Tiere flohen vor ihnen, weit hinab zum warmen Erdgürtel. Nur Wenige trotzten den eisigen Herren; nur eine kleine Zahl hatte den Mut, bei ihnen zu bleiben.
Inmitten dieser winterlichen Zeit wurde der Mensch geboren. Er glich den angepaßten Tieren, rauh war sein Haarkleid, wild sein Sinn, winterlich sein Herz. Aber in ihm lebte etwas, was er allen Tieren voraus hatte. Die Mutter Erde aber sah ihr spätes Kind an, und erbarmte sich seiner. Sie richtete sich wieder empor und versuchte,
[86]
Ihre Sommerbahn einzunehmen, die sie gezogen war in den Tagen ihrer Jugendzeit. Senkrechter schossen die Strahlen ihrer gelben Sonne herab, so daß es den Eisriesen zu heiß wurde und sie zurückflohen zu den Polen, und es wurde wieder grün und freundlich.
Freilich nicht für alle Menschen gleichzeitig.
Es gab Länder, die näher den Polen lagen. Da kehrten die Eisriesen immer wieder, immer zu der Zeit, wo die Erde in bestimmter Bahn zu ihrer Sonne stand. Aber der Mensch überwand Hitze und Kälte, und jeden Wechsel der Zeit. Er wuchs langsam, aber stetig, sein Aussehen wurde lichter und heller. Er lernte es, aufrecht gehen. Da hob er seine Augen empor von seiner Mutter Erde und sah zum ersten Male den über sich, der ihn gezeugt, seinen Vater, den Himmel. Und er sah die Wunder der Welt und in die Sternenaugen der Ewigkeit. Da fiel ein Strahl der Weltenseele in sein Menschenauge und entzündete das göttliche Licht in seinem Inneren, so daß sich sein Auge mit Seele füllte. Er breitete die Arme in unendlicher Sehnsucht zum Himmel, aber mit den Füßen mußte er stehen bleiben auf der Mutter Schoße, die ihn geboren, und die von dichterem Stoffe war, als der Himmel über ihr. So ward der Mensch zwiegeteilt, erdgebunden, himmelsehnend, Gottheit und Tier.
Und der Tiermensch ging hin und häufte Greuel über Greuel auf seine Seele und befleckte seine Mutter Erde, aber da, wo sein Göttliches nach den Sternen langte, tat er Wunder der Gottheit. Seine Kulturen wuchsen und blühten, bunt wie die Blumen und welkten dahin wie diese. Doch er selbst blieb sich gleich!
Himmelstrebend, erdgebunden, höchste Güte, tiefste Grausamkeit, Alliebe, Allvernichtung!
Gerda sah den Genius an und verstand plötzlich das Rätsel des schwimmenden Landes. War es nicht der Erdball selbst, der durch den unendlichen Ozean des Raumes eilte?
„Wer bist Du?” fragte es in Gerda den Jüngling.
„Der Genius der Menschheit!”
[87]
„Bleiben sie immer an Dunkles gekettet? Werden sie nie ganz Kinder des Lichtes? Gibt es keine Erlösung?”
„Es gibt eine, und sie wird kommen!”
„Durch wen wird sie kommen?”
„Durch die Liebe!”
„So will ich mein Schicksal zu Ende tragen”, sagte Gerda.
Sie öffnete die Augen und saß im Stübchen der Pflegeeltern, im Stuhle der Mutter, am Fenster, das aufs Meer hinausging.
[88]
11. Teil.
Das ewig-neue, alte Lied.
Die Armen waren in ihre Löcher zurückgeschleudert, dort hockten sie in dumpfer Verzweiflung. Sie arbeiteten nicht, konnten nicht arbeiten. Sie fingen an, sich untereinander zu beschuldigen, daß sie ihren Eid gebrochen, und zu all ihrem Elende häuften sie noch Leid und Kummer, so viel, als sie sich nur gegenseitig zufügen konnten. Von Gerd sprach keiner. Er war ihnen ein Toter. Es war, als ob sie seinen Namen nicht aussprechen konnten; nie wurde er genannt, so entsetzlich war er ihnen. Auch Gerda ging man scheu aus dem Wege, war sie es nicht, die Fremde, die hierher gekommen und Gesetze gelehrt, die nun Schuld waren, daß das Unglück nur größer wurde?
Aber selbst am Rande des Abgrundes liebt der Mensch das Leben. Als der Hunger unerträglich wurde, begann auch die Arbeit wieder, lustloser, stumpfer, verzweifelter denn je. So steuerte das Land dahin.
Aber Gerda gehörte nicht zu den Menschen, die sich zufrieden geben. Sie wollte retten, was noch zu retten war. Sie sammelte die Jungen um sich, und ihnen sang sie wieder Lieder der Hoffnung, Lieder des Glaubens an bessere Zeiten, Lieder des Gesetzes der glücklichen Inseln. Dann glomm in den Augen der Jungen ein Funken Gold empor, reines Gold des Herzens, das nichts gemeinsam hatte mit dem Golde der Erde, das die Herzen versteinert. Die Jungen waren Gerdas Hoffnung, aus ihren reinen Händen sollte die Befreiung kommen, In endloser Selbstläuterung, unblutig, rein, notwendig! Nur durch die göttliche, sittliche Macht würde das Gesetz siegen.
[89]
12. Teil.
Der fremde Gast.
Jahre kommen und vergehen, Monde wechseln ihre Sichel hinüber und herüber, in ihrem einsamen Stübchen aber sitzt Gerda. Sie weiß es nicht, daß ihr Scheitel silberweiß, daß ihre Hände zittern und ihr das Gehen sauer fällt. Sie hat auch nicht bemerkt, daß die Jungen nicht mehr kommen und es täglich weniger geworden sind, die der alten Frau zuhören wollen. Alt und verschollen dünkt der Jugend diese Melodie; sie leben in neuen Zeiten und wollen neue Lieder hören. Aber was kümmert dies Gerda. Ihre schwachen Augen übersehen kaum die Zeiten, und das ist auch nicht nötig. Längst lebt sie nicht mehr in der Gegenwart!
Sie entsinnt sich der naheliegenden Dinge nicht mehr genau; sie weiß nicht, was gestern war, sie ist wieder die kleine Gerda und lebt auf den glücklichen Inseln, sie spricht mit der Mutter, zu deren Füßen sie sitzt, sie geht an des Vaters Hand, spielt am Strande und wartet auf das Schicksal.
Aber dann kommt es vor, daß sie mit Gerd spricht! Sie tastet nach ihrem Schosse, sie beugt sich tiefer und tiefer, um seine Stirn zu küssen, seine Augen, die zu ihr emporlächeln. Sie weiß gar nicht, daß er in einem goldenen Schlosse wohnt, alt, einsam, umschmeichelt von habgierigen Feuermännern. Und sie lächelt vor sich hin. Manchmal kommen ihr trübe Bilder, dann weint sie, aber nicht lange; bald ist sie wieder beruhigt.
Sie weiß es, ja, weiß es ganz gewiß, Gerd wird heimkommen. Nein, er ist ja König, er läßt sie holen, dann wird sie seine Königin. Sie zieht nach dem prächtigen, geräumigen Schlosse, und die Armen alle, sie wird sie mit
[90]
hinauf nehmen, und sie werden in den ewigen Gärten wohnen und es wird ihnen gut gehen, so gut wie den Menschen auf den glücklichen Inseln, nein, weit besser!
Als ihre matten Augen fast gar nichts mehr sehen, wird es immer heller und lichter in ihrem Innern und die trüben Bilder verschwinden ganz. Gerd wird kommen, ihr angebeteter Gerd, ihr Gerdlein, ihr Schicksal, ihr Feenland, das ist ihr Lebensinhalt und sie wartet!
Da klopft es eines Tages an die Türe und Gerda zuckt zusammen. Sie will sich erheben und öffnen, aber die Füße versagen den Dienst.
„Willkommen!” ruft sie mühsam.
„Gerd, Gerd!”
Nein, es ist nicht Gerd, sondern ein Fremder. Ein hoher Mann mit undurchdringlicher Miene, gehüllt in zeitloses Gewand.
„Sei gegrüßt, Gerdarudana, ich komme, Dich mit mir zu nehmen.”
„Schickt Dich Gerd?”
„Gewiß schickt er mich, ein König kann doch nicht selbst kommen!”
„So soll ich ins Schloß kommen?”
„Nein, unsere Reise geht wo anders hin!”
„Wohin?”
„Das will ich Dir zeigen!”
Der Fremde berührt Gerdas Augen und sie werden hell und klar. Das Zimmer weitet sich und in der Ferne taucht ein goldener Tempel auf. Er ist nicht, wie die alten Kirchen, dumpf, dunkel und enge, er besteht nur aus Säulen und sein goldenes Dach überschirmt ein ganzes, weites All. Unter seiner Kuppel aber leuchten alle Gestirne des Himmels.
Ein goldener Altar steht da, auf dem lodert eine reine, helle Flamme. Der Genius der Menschheit steht vor ihr als Hüter. Es rauscht von frohen, hellen, niegehörten Klängen. Da stehen auch alle die Armen, aber in Festgewändern und wie Gerda mit ihren klaren Augen an sich
[91]
herabsieht, ist auch sie festlich gekleidet, kostbar geschmückt. Sie trägt wieder ihr feines, weißes Linnen, das die Mutter gewebt und all ihre Tränen glänzen darauf, wie keine irdischen Perlen glänzen können. Golden wallt ihr Haar herab, und ihre weißen Hände breiten sich aus!
Gerd, Gerd, da steht er, dicht neben dem Genius, und wie jung er ist, wie stark, wie kraftvoll! Wie rein seine Augen leuchten, wie seelenvoll, wie gut!
Welche Liebe glänzt auf seinem Angesichte, als er nun die Arme ausbreitet, Gerda zu empfangen, um sie nie, nie wieder zu lassen! Der Zauber ist gebrochen, die Erlösung bewirkt, bewirkt durch die Liebe! . . .
Da füllen sich Gerdas meerleuchtende Augen mit Tränen der Seligkeit.
Da läßt sie sich vom Tode leiten in das unbetretene Land.
ANHANG: Anzeigen von Vereinen und Veröffentlichungen, deren Ziele mit dem Zwecke dieses Büchleins übereinstimmen.
Erstellt am 18.09.2010 - Letzte Änderung am 20.09.2010.