
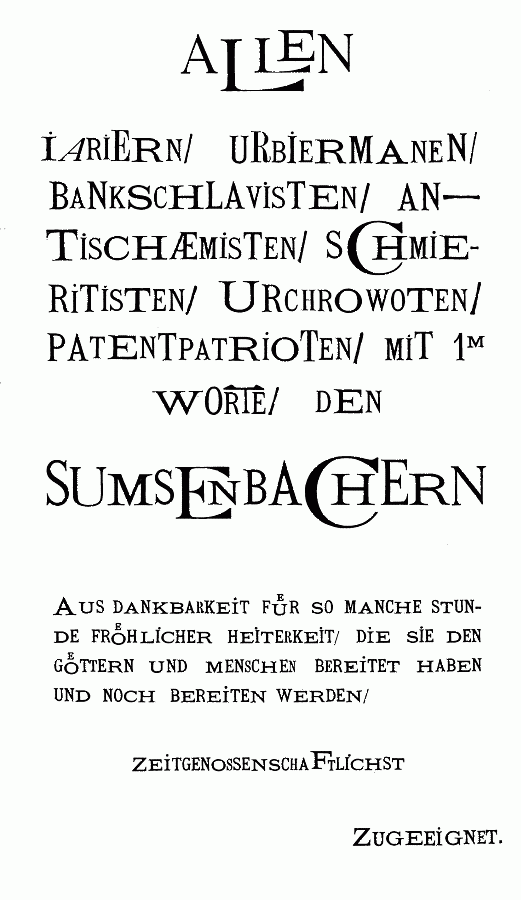


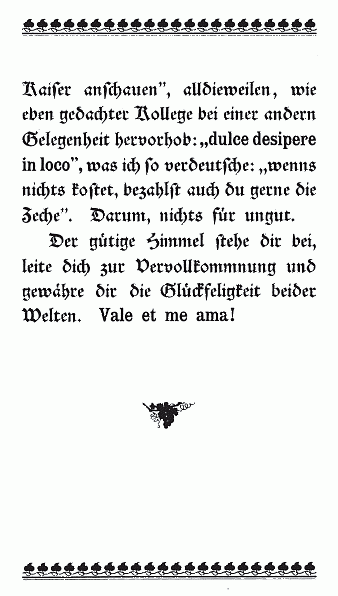


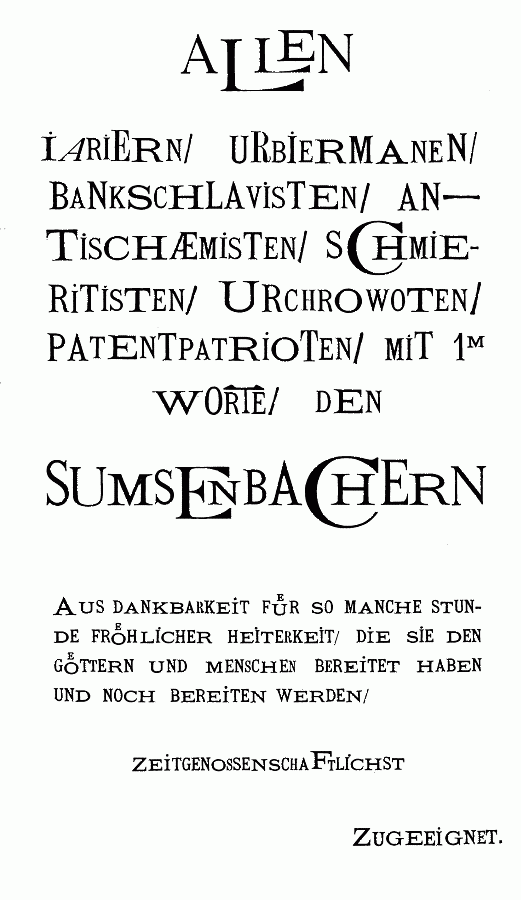


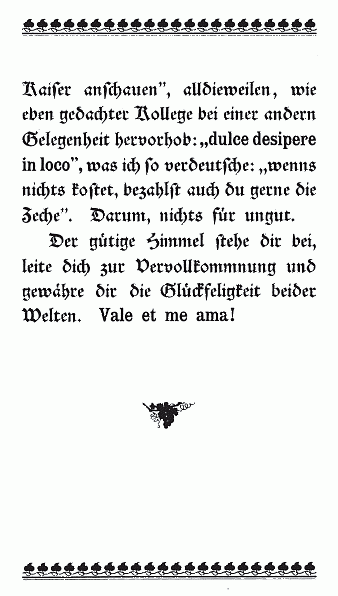

INHALT dieser Seite
zur Abbildung der ersten Buchseite
zur Besprechung des Buches
(in der ersten Auflage von 1893) im ARCHIV FÜR DAS STUDIUM DER NEUEREN SPRACHEN UND LITTERATUREN, Georg Westermann Verlag, Braunschweig 1894.
Sprung:
[Teil I - Seite 1]
[Teil II - Seite 77]
Seiten:
[001], [003], [007], [014], [017], [023], [025], [029], [034], [043], [044], [050], [051], [055], [060], [064], [066], [072], [073], [076a], [076b], [080], [081], [083], [086], [087], [088], [091], [095], [096], [098], [102], [105], [109], [112], [120], [127], [130], [139], [145], [147].
Buchbesprechung
[Seitenende].
(Seitenzahlen im Text am Anfang der Seite.)
Böhmische Korallen aus der Götterwelt
147 Seiten Author: Friedrich Salomo Krauss Publisher: A. Reimann, 1897 Possible copyright status: NOT_IN_COPYRIGHT Language: German Digitizing sponsor: Google Book from the collections of: Harvard University Collection: americana Internet Archive Full text of Böhmische Korallen aus der Götterwelt: folkloristische Börseberichte vom ... http : //books . google . com/ FROM THE FUND OF mrs. harriet'j. g. denny, OF BOSTON. Gift of $5000 from the children of Mrs. Denny, at her request, ** for the purchase of books for the public library of the College. Digitized by Google
Böhmische Korallen aus der Götterwelt
I ¹)
Die holde Prinzess Sosa, anmutiglieblicher war nie eine, versichert uns Giambattista Basile, und wir wollen es ihm aufs Wort glauben, Prinzess Sosa bemerkte, nachdem sie gegen ihre Rivalin, die Mohrin, wegen schwindelhafter Geschäftgebahrung vor dem Richterstuhl des vertepschten Prinzen das Concursverfahren eingeleitet: „Die Wahrheit, o Prinz, war immer die Mutter des Hasses, aber ich bin nicht klug genug, um Geschichten zu ersinnen oder Märchen zu erdichten!”
Meiner Treu und Seligkeit! Das Frauenzimmerchen verstand es, sich dümmer zu stellen, als der Prinz ausschaute! Es war klug von ihr, dass sie sich schon in frühester Jugend mit Ausdauer und Beharrlichkeit dem Berufe einer Märchenprinzessin zugewandt; denn mit ihrer freimütig eingestandenen, unzureichenden Begabung würde sie, auf sich allein gestellt, ohne Basiles Hilfe niemals ihren stolzen Weltruf erlangt haben. Leider fördert mich, obwohl ich von Haus aus nicht um vieles vernagelter und nicht um vieles witziger als sie, die blaublütigste Prinzess, bin, nicht einmal ein Börserat, geschweige denn ein Basile, der italienische König im Folklorelande. Ich sehe mich darum angewiesen, da ich mir auch keine Übung mit der Couponschere für meine Rechnung erworben habe, mit der Donna Wahrheit eine bescheidene Wirtschaft zu führen. Nachdem wir durch jahrelanges Zusammenleben
- 2 -
einander allseitig kennen und achten gelernt - meine Freunde munkeln gar, sie schwinge über meinem Haupte ihren Pantoffel! - und ich grundsätzlich nur sittlich makellose Personen meines näheren Umganges würdige, nehme ich keinen Anstand, schon zur Ehrenrettung meines kleinen Heimwesens, ein für allemal zu erklären, dass meines Wissens die keusche Wahrheit (obgleich einige Wüstlinge, sie selber hat es mir erzählt und nur errötend wiederhole ich es, gar oft es versuchten, ihr Gewalt anzutun und sie zu schänden) niemals schwanger gegangen sei und daher unmöglich den kreischenden Fratzen, den giftigen Bosnickel Hass in die Welt gesetzt haben kann.
Da ich nun weder Tarok spielen noch tanzen gelernt, d.h. mit mir in der Gesellschaft gar nichts Gescheidtes anzufangen ist, ich aber doch leben, meine müssige Zeit nämlich mit irgend einem Steckenpferde totschlagen möchte, tummle ich mich mit meiner Hausverweserin, die treu wie das böse Gewissen ist, häufig auf der Götter- und Alythenbörse herum und stecke meine Ohren zwischen die Leute, um mich als Berichterstatter nützlich zu machen. Es ist ein allgemein verbreiteter Köhlerglaube, dass auf der Börse nur Juden spielen. Wieso dieser Glaube entstehen konnte, ist ein grosses Rätsel oder gar keines; denn die mit allen Salben geschmierten Juden enthalten sich des Spieles völlig, während es ausschliesslich und mit Leidenschaft von Sumsenbachern gepflegt wird. Wenn die dann, was unausbleiblich ist, 'reinfallen, wenn gar ein Krach ausbricht, so schimpfen sie, wie die Rohrspatzen, über die Zuschauer, die Juden, und leider, was mich aufs Tiefste kränkt, schieben sie die Schuld auch uns Berichterstattern in die Schuhe und erklären uns schlankweg in Bausch und Bogen gleichfalls für Juden. Wir Berichterstatter, die wir so arme Leute sind, dass wir selbst unsere einzige Beraterin und Freundin, die Wahrheit, Leuten zu Schanden, zum Spott der Welt, splitternackt einherwandeln lassen müssen, verdienten doch mehr Schonung.¹)
- 3 -
Mit Hinweis auf diesen Sachverhalt, bitte ich um Nachsicht für nachfolgenden Bericht, den ich nur als Dolmetsch unserer geschäftkundigen, edlen, tugendhaften und gütigen Freundin wiedergebe. Wer nun mit dieser so arg verleumdeten (siehe oben, was Prinzess Sosa sagte!), missachteten, zuweilen jämmerlich verkannten, ehrwürdig jungen Dame unglimpflich umzuspringen gewohnt ist, soll unseren Marktbericht ungelesen einem Käsehändler widmen und mag selber gleich in die Gegend zwei Stunden rechts von Puntingham fahren, wo er zuversichtlich die herzlichste Aufnahme finden wird.

Ich darf es stillschweigend voraussetzen, dass alle meine geduldigen Leser - die ungeduldigen Frauen, diese Perlen im Leben der Männer, ausgenommen - aus eigener Erfahrung, Witzigung und Anschauung schon lange wissen, was böhmische Korallen sind, ja, ich getraue mich zu wetten mit jedem, ders Wetten liebt, dass es unter ihnen - mich mit eingeschlossen, der ich mir eine eigene Sammlung angelegt - - mehr Besitzer böhmischer Korallen gibt, als solcher Herren, die über einen Vorrat sogenannter echter Korallen und Perlen verfügen.
Man unterschätze den Wert und die Bedeutung dieses Handelartikels in der Geschichte der Menschheit nicht. Die böhmischen Korallen beherrschten einst den Weltmarkt. Einst schacherten portugiesische Händler für böhmische Korallenschnüre mit Leichtigkeit afrikanische Fürstentümer ein, während in unseren Tagen die deutschen und englischen Congoreichgründer, um Ländereien zu erwerben, volle Ladungen der ungleich kostspieligeren Messingpatronenbohnen den afrikanischen Fürsten, Häuptlingen und deren Mannen zu Gemüt führen müssen. Ja, täglich wird es schlimm und schlimmer; denn die Welt wird immer gescheidter. Heutigentags sind böhmische Korallen ¹) fast wertlos. Erstens versteht man es nämlich derzeit, dank den grossen technischen Fortschritten,
- 4 -
mit verhältnismässig geringen Kosten und verminderten Gefahren echte Korallen aus den Meerestiefen ans Taglicht zu fördern, und zweitens erzeugt man auch in Deutschland, Frankreich, England, Italien, Russland und sogar auf der Balkanhalbinsel riesige Schiffladungen nachgeahmter böhmischer Korallen, so dass die echten unechten Korallen aus der Heimat des zweischwänzigen Löwen einen furchtbaren Niedergang und Preissturz erfahren haben. Das sind die schädlichen Folgen der Concurrenz und der capitalistischen Überproduction.
Aus den dunklen Schrunden germanischer Vergangenheit haben mit Hilfe sinnreich, kunstvoll und mühsam zusammengesetzter Tauchapparate schwergepanzerter Gelehrtheit Grimm, Simrock, Uhland, Schwartz, Weinhold und so manche andere Tiefgrundforscher kostbare Perlen und Korallen heraufgeholt, vom Schlamm und sonstigen Ansätzen der Zeitflut gereinigt und fein säuberlich der überraschten Mitwelt einen Zauberschatz an Wissen und Wert als Liebegabe dargebracht. Das ist sehr viel für das deutsche Volk, aber lange nicht genug den neidischen Augen der Xachtaucher selbst in heimischen Gauen, und vollends zu wenig für die Scheelsucht und zu viel für die Geduld der guten Nachbarn, die auf einmal leer und blos dazustehen schienen.
Jeder freundliche Leser - die Damen, Gott erhalte und vermehre deren Heil! sind ohnehin alle freundlich - wird doch zugeben müssen, dass solch ein Missverhältnis auf die Dauer nicht zu ertragen war. Die echten Korallen der germanischen Vergangenheit sind so schmucklos wie meine obgedachte Freundin, aber auch leicht nachzuahmen wie russische Fünfzigrubelscheine. Um das ungestillte Verlangen und Sehnen minder beglückter Völker zu stillen und zu befriedigen, erstanden nach und nach edelmütige Charaktere, die weder Plage noch Mühe scheuten, um mit allem Aufgebote eines umfangreichen, verzwickten Tümpelwissens und argonautischer Kenntnisse auch bei anderen Völkern solche Korallen, oder lieber - es geht ja in einem Aufwaschen - gleich Korallenbänke, sagen wir, zu entdecken.
Doch des Glückes ungetrübter Frieden, nimmer ward den Irdischen beschieden! Die erst bescheiden und vereinzelt auftretenden Entdecker und Erfinder böhmischer Korallen aus der Götter- und Mythenwelt hatten den Fehler begangen, ohne Patent und Schutzmarke den Markt herauszufordern.
- 5 -
Die Nachräusperer und Nachspucker fingen an, in besorgniserregender Weise sich zu mehren, und was der Übel grösstes ist, die nach echten Korallen fischenden Gelehrten erhoben darüber den unschicklichsten Heidenspektakel, der schier nicht zur Ruhe kommen will. Man befürchtet nämlich aus übertriebener Ängstlichkeit, die echten Korallen, die ohnehin schwer zu gewinnen sind, könnten allmählich durch den nachgemachten Schmuck aus dem Handel verdrängt werden, so dass es sich vielleicht nicht einmal mehr lohnen dürfte, echten Kostbarkeiten nachzuspüren. Zum Überfluss wird die Börse durch das Gerücht in nervöse Stimmung versetzt, dass einige pfiffige Korallensucher böhmische Fabrikate in die Tiefen versenken, um sie dann unter geschickter, theatralischer miseen-scène zufällig wieder heraufzuholen. Was Concurrenzneid nicht alles ersinnt!
Eigentlich kann man es ihnen gar nicht verargen. Über Nacht und im Handumdrehen lässt sich auf dem Gebiete des Folklore nichts gewinnen, am wenigsten Perlen und Korallen. Um Volküberlieferungen gut sammeln zu können, bedarf es vor allem innigster Vertrautheit mit der Volksprache, allseitiger Kenntnis von wirklichen Sitten und Bräuchen des Volkes, oder noch lieber mehrerer Völker neuer und alter Zeit, um nicht falsch zu beobachten oder hinters Licht geführt zu werden; Geduld, Ausdauer, Findigkeit, Spürsinn und viel, sehr viel Gemütlichkeit und Leutseiigkeit ist erforderlich, um sich mit den Leuten im Volke gemein und vertraut zu machen, um sie auszuhorchen und auszuholen. Dazu gehört noch ein grosser Grad von Selbstlosigkeit, Liebe und der reinsten Freude am Sammeln, sonst foppt man sich selber und kommt nicht vorwärts. Die Leute dürfen gar nicht merken, wie lieb man sie hat; denn es trifft sich leicht, dass man einem da und dort aus lauter Gegenliebe und Gefälligkeit allerlei unverwendbare Geschenke aufdrängt, so z. B. böhmische Korallen oder gar Bären und andere wilde Tiere.
Musterhafte Sammler waren oder sind z. B. die Gebrüder Grimm, Kuhn, Schwartz, Müllenhoff, A. Campbell, Kolberg, Karłowicz, Karadžić, die Miladinov, Dragomanov, Wolter, Pitré, Gatschet, Mooney und noch manche ihresgleichen. Aus den guten Sammlungen entspriesst unberechenbar reicher Nutzen für die verschiedensten Wissenzweige. Welchen Aufschwung hat nicht allein die Lexikographie und die vergleichende Sprachwissenschaft oder die Geschichte der Medizin dem
- 6 -
Sammeleifer der Folkloristen zu verdanken! Die darstellende Kunst und das Kunsthandwerk schöpfen aus der Volkkunde Anregung und Belehrung jeder Art. Selbst die gesetzgebenden Körperschaften aller Länder, die Richter und die Staatenlenker fangen an zu begreifen, dass sie aus ihrem gesunden Menschenverstande, d. h. der landüblichen Durchsrhnittdummheit, wie Post sagt, sich heraus- und in die Volkkunde hineinarbeiten müssen. Es schwant oder dämmert so manchem, dass man nicht blos mit dem Orientexpresszug, sondern auch mit der Volk- und Völkerkunde besser fährt als mit dem (Jevatter Posthorn und dem alten dogmatischen Rumpelkarren.
Der Sammler muss nicht notwendigerweise ein gelehrter Philologe, Historiker, Jurist, Mediziner, Theologe oder Inhaber des goldenen Vliesses und des Strumpfbandordens sein, aber unbedingt Sinn und Verständnis für naturwissenschaftliche Beobachtung besitzen, damit er es verstehe, der gelehrten Forschung vorzuarbeiten. Er soll nämlich zum mindesten darüber im Klaren sein, wie die Materialien beschaffen sein müssen, damit sie in der Wissenschaft vom Menschen als Bausteine eine Verwertung finden können.
Was die gewissenhaften Sammler bringen, sind nicht immer Korallen und Goldgestein; es kommt sogar häufig vor, dass die Sammler den Wert ihrer Funde gar nicht bemessen können. Das Einzelne gewinnt erst, wie jeder Handelartikel, als Vergleichungstück gegenüber gleichen oder ähnlichen Erscheinungformen bei anderen Völkern, seinen besonderen Wert. Sowie kein Mensch ausserhalb der Gesellschaft steht, in der er zur Welt gekommen, erwachsen ist und in deren Mitte er lebt und webt, ebenso ist noch kein einzelnes Volk aus dem Rahmen der Gesammtmenschheit herausgetreten, um sich nach ganz eigenen physischen und psychischen Gesetzen vierdimensional zu entwickeln.
Unser wetterfeste Steuermann Post bemerkt nach einer ähnlichen Auseinandersetzung ¹): „Damit kehrt sich die ganze bisherige Betrachtungweise des Völkerlebens um. Anstatt das Völkerleben am Masstabe der individuellen Vernunft zu
- 7 -
messen, misst der Ethnologe seine eigene Vernunft an den Empfindungen, Gefühlen und Gedanken, die im Völkerleben zum Ausdruck gelangt sind. Anstatt durch seine Vernunft die Völker zu belehren, lernt er von ihnen, um sich selbst zu erkennen. Anstatt vom Katheder der individuellen Vernunft aus den Glauben eines Volkes für Aberglauben, seine Sitten für Unsitten zu erklären, sind ihm Glaube und Sitte der Völker die geheimnisvollen Offenbarungen des Geistes der Menschheit, dessen wunderbares Schaffen er in der eigenen Seele nicht mehr ergründen, sondern höchstens in weihevollen Stunden ahnend empfinden kann.”
Das sind keine schreckhaften gruseligen Tauchererlebnisse, sondern eine durch inductive Forschungweise längst festgestellte Wahrheit, auf der die Völkerkunde fusst. Forscher, wie Bastian, Andree, Post, auf den wir uns just berufen, Reinhold Köhler, A. Wesselofsky, H. Gaidoz, Brinton, Tylor, Lubbock, Andrew Lang und so mancher andere, die als Begründer der Völker- und Volkkunde gelten, haben mit emsigstem Sammelfleisse und mit einer unvergleichlichen Ausdauer die Literaturen aller Zeiten und Völker bis auf den letzten Dorfkalender und das unscheinbarste Flugblatt, das aufzutreiben war, durchgelesen und durchgeprüft, um die mannigfachen Formen des Völkergedankens in allen seinen Äusserungen festzustellen.
Den rastlosen Bemühungen dieser Männer hat es die Wissenschaft vom Menschen zu verdanken, dass man schon eine ziemlich allseitige Ein- und Übersicht über die vorgekommenen und möglicherweise noch auftauchenden Volktümer erlangt hat, so dass ein gelehrter Volkforscher gemächlich in der Stube vor seinem Schreibpulte aus der Pfeife schmauchend, stante pede entscheiden kann, ob irgend eine ihm vorliegende Volküberlieferung oder ein Brauch nach Inhalt und Gestalt echt volktümlich ist oder, um mich unseres Schlagers zu bedienen, ob man ihm unverfälschte böhmische Korallen anhängen will.
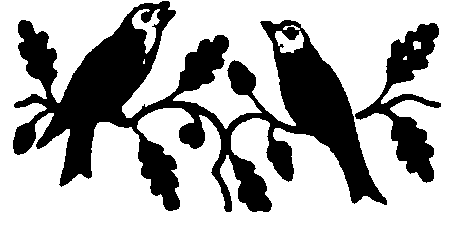
- 8 -
Du merkst also, folgsamer Leser - dein Barbier soll dich scheren, aber nicht schinden - wie es nur einzig und allein durch den Ring, den die gedachten, planmässig und rücksichtlos vorgehenden Schutzzöllner der Volkkunde über die civilisirte und wilde Menschheit gezogen, den Fabrikanten böhmischer Korallen aus der Götter- und Mythenwelt sauer und bitter gemacht wird, ihre Erzeugnisse an den Mann zu bringen. Bewegt sich der Fabrikant nur innerhalb des Bekannten und Hergebrachten, so ist er nicht concurrenzfahig und lauft Gefahr, dass man ihn gar nicht beachtet. Der kluge und geschäfttüchtige Speculant verlegt sich daher auf die Erzeugung des Aussergewöhnlichen, Herrlichen, Prächtigen unendlich Wertvollen. Schmock fragt: „Kann ich lauter Brillanten schreiben?” Nebbich, ist bei Brillanten aufgewachsen! Hat eine hohe Reitschul besucht; wie heisst!? Dagegen schütteh der gewiegte Folklore-Fabrikant lauter echte böhmische Korallen sich aus dem Ärmel. Die glitzern und flimmern wie gleissend Katzensilber und verlocken durch ihren hellschimmernden Glanz weit mehr als die mattfarbigen Stücke der Folklore-Sammler. Zu spitz sticht nicht, zu scharf schneidet nicht, zuviel Glanz ködert nicht und wer zuviel sagt, sagt vielleicht zu wenig.
Es ist leider nur zu wahr, dass in den naturwissenschaftlichen Disziplinen, die zugleich Geistwissenschaften sind, sehr oft eine hohe Wahrscheinlichkeit als Wahrheit glaubhaft gemacht zu baren Erkenntnissen ausgemünzt wird, die nach neuer Valuta in die Laienwelt geworfen, zuweilen in den Köpfen vieler heillose Verwirrung anrichten können. Von dieser Art sind die Völkerrassentheorien aus der Anfangzeit der physischen Anthropologie und die durch die älteste ethnologische Disziplin, die Sprachwissenschaft, zusammengeflickte Schachtellehre vom Ariertum und der urarischen Religion, die, wie uns Max Müller darüber belehrt, durch gewisse Sprachrebwurzelläuse geschaffen wurde, ähnlich wie durch den Stich der Gallwespe Cynips gallae infectoriae auf Quercus infectoria Galläpfel entstehen. Um dich besser zu orientiren, teuerer Leser - du sollst keinen Schnupfen kriegen - bemerke ich gleich, dass die Sprachlaus Phylloxera lingvastatrix mythologica Mülleri wohl zu unterscheiden ist von der gemeinschädlichen arischen Freibierlaus Vielochsera ariaca volgaris Sumsenbacheri, die von den Sachverständigen in jüngster Zeit als die Ursache der
- 9 -
antsemistischen Drehkrankheit erkannt wurde. Einem sicheren on dit zufolge beschäftigen sich Virchow in Berlin und Nothnagel in Wien sehr eingehend mit dem Studium der Mittel zur Bekämpfung und Ausrottung letztgenannter Vielochsera Sumsenbacheri.
Die Sprachvergleichung hat uns unerwartet tiefe Einblicke in den Bau, die Entwicklung und Verwandtschaft der Sprachen, ja in die Werkstätte, wo die Biegung und Fügung für den Ausdruck des menschlichen Gedankens geschmiedet, wo das Wort gedehnt und gestreckt wird, zu eröffnen vermocht, doch damit ist wohl auch der Hauptteil ihrer Aufgabe erschöpft, und was darüber hinausreicht, schlägt mehr oder weniger in das Fach der böhmischen Korallenfabrikation ein. Ich mag niemand beargwöhnen, noch in Verdacht bringen, denn dergleichen liegt dem Berufe eines Marktberichterstatters vollkommen ferne, aber sagen muss ich, dass mir manche Galopins der Sprachvergleichung zu eifrig und zu gescheidt sind. Zwar ist nichts auf der Welt so krumm und dumm, dass es nicht fand' ein dankbar Publicum. Ich meine solche Sprachbezwinger, die in ihrer Biederkeit und Harmlosigkeit bei allem Vielwissen und wirklichem Können nur dazu in die Welt gesetzt zu sein scheinen, minder findigen Leutchen zur Ergötzung und Erbauung in müssigen Stunden zu dienen. Manche besitzen förmlich eine Virtuosität in der Kunst, unbewusst und wider Willen sich selber zum wandelnden Mittelpunkt der Heiterkeit ihrer Umgebung zu machen. Eigentlich wäre es doch zu traurig und langweilig in dieser buckligen und runzligen Welt bestellt, gäbe es keine Komiker von Geburt, keine Talmigoldtalente und Pfefferkorngenies zur Auffrischung der eintönigen, alltäglichen Gedankendarre. Dass Komiker in die Sprachwissenschaft nicht recht hineinpassen, wird man mir nicht bestreiten, und doch weiss treppenwitziger Übermut auch von solchen Recken zu singen und zu sagen.
Ich, mein geschätzter Leser - sollst nie mit fremden Zähnen dein Essen kauen - schreibe meine Berichte nicht für jedermann, sondern ausschliesslich und nur für dich, und darum erlaube ich mir, aus meinem eigenen Leben dir ein Geschichtchen zu erzählen.
Im Winter des Jahres 1884 gelangte ich auf meiner Forschungreise auch nach Dubrava im bosnischen Savelande. Zufälligerweise begegnete ich im Pfarrhause dem damaligen Franziskanerprovinzial Frater (Fra) Ilija Cavor und dessen
- 10 -
Secretär. Das Nachtmahl war üppig, der Wein süffig, und die muntere Rede wurde bald flüssig. Das Gespräch drehte sich vornehmHch um die Ziele und Zwecke meiner Reise. Der hochwürdige Provinzial, ein vielseitig gebildeter und dabei sehr jovialer Mann, äusserte lachend und unverhohlen seine Freude über die grossen und kleinen Bären, die ich voraussichtlich den Deutschen aus Bosnien heimbringen würde. Ein Gelehrter, ein Verkehrter, meinte er launig. Unter dieser Voraussetzung lehnte ich natürlich den Gelehrtentitel ab. Darauf fühlte sich der Provinzial verpflichtet, seine Behauptung zu begründen. „Als ich noch,” erzählte er, „zu Djakovar {in Slavonien) Kleriker im theologischen Seminar war, trug uns Fran Kurelac kroatische Sprache und Literatur vor. Sie wissen wohl, dass Kurelac der kroatische Tacitus genannt wird wegen seiner eigenartigen, zerhackten Darstellungweise, die von obsoleten und ungewohnten Worten und Wendungen strotzt. Er ist weniger durch seine Sammlung kroatischer Volklieder aus Ungarn und seine lexikographischen Studien, als durch sein besonderes Auftreten bekannt geworden. Er trug sich halb bäuerlich, halb städtisch: Topanken an den Füssen, einen Schnappsack um die Schultern, auf dem Kopf einen Bauernhut und den Hals frei ohne Kravatte. Dabei sprach und lehrte er ümner nur die „ewige Wahrheit”. Uns Kleriker hatte er beauftragt, ihm seltene Worte aus der bosnischen Volksprache mitzutheilen. Wir kamen seinem Wunsche sehr gerne nach, weil er uns jedesmal in der ”Schulstunde mit der Erklärung der neuen Worte die Zeit verkürzte, statt uns mit der Schulgrammatik abzuquälen. Wir Kleriker wetteiferten miteinander in der Erfindung neuer, unerhörter Ausdrücke und hatten gewöhnlich einen Hauptspass, wenn uns Kurelac die Funde durch Sanskritwurzeln, altslavische, griechische und lateinische Worte auslegte. Jetzt tut mir die Sache doch leid, weil ich sehe, dass jene Worte aus den Aufzeichnungen Kurelac's in das grosse Wörterbuch der Südslavischen Akademie aufgenommen werden.”
Als ich im folgenden Frühjahr auf meinen Streifzügen nach Travnik im nördlichen Bosnien kam, erzählten mir wieder Franziskaner eine ähnliche Geschichte, deren
Held der dalmatisch-kroatische Reichratabgeordnete und
nationalpolitischkalenderdidaktischbelletristische Schriftsteller
JVIihovilo Pavlinoviö gewesen sei. Pavlinoviö bereiste in den siebziger Jahren Bosnien, um Wörter zu sammeln. Meine
- 11 -
wirtlichen Schmerbäuche behaupteten nun steif und fest, sie hätten damals dem hochbegeisterten Pavlinoviö allen erdenklichen Schnickschnack aufgebunden, aber ich mochte es ihnen nicht glauben; denn diese Episode glich jener von Kurelac auf ein Haar. Si duo idem narrant, non est idem, d. h. zwei Narren auf einem Karren fahren nicht mit einem Sparren, dachte ich mir und nahm mir vor, bei guter Gelegenheit meinen Mann aufzusuchen.
Gott bescheert der Spinnerin den Flachs, dem Trinker den Wein und mir schenkte er die Freude, noch im Herbste selben Jahres in Wien den alten Pavlinović kennen zu lernen. Wäre ich statt Marktberichterstatter ein vergleichender Literarhistoriker, ich würde Pavlinović den kroatischen Daniel Kaspar von Lohenstein taufen. So wie er in seinen Schriften lohensteinisch schwulstig und bombastisch auftrat, so gab er sich auch im persönlichen Umgange als Fanatiker der urchrowotischen Pose und Phrase. Er liebte die Cechen, weil sie Russenfreunde wären und verachtete die Polen, weil sie durch ihre Sonderbestrebungen den Russen gegenüber die Einigkeit aller Slaven hintertrieben. Er selber verstand zwar kein russisch, doch war er bereit, auf den ersten Ruf, alle Russen katholisch zu machen und sie gleichzeitig zur Annahme der kroatischen Sprache und der Lateinschrift zu bereden. Ich erklärte ihm unumwunden, dass ich mich glücklich schätze, die Fruchtbäume seines staatmännischen Nachdenkens so mühelos in meinen Garten verpflanzen zu dürfen und gab der Überzeugung Ausdruck, dass eine einfachere Lösung des schwierigen Problems der Vereinigung aller Slaven mir noch nie untergekommen sei.
So ward ich bei ihm der Hahn im Korbe. Ich lenkte das Gespräch, ohne dass er die Absicht merkte, auf seine Wortsammlung, über die ich so viel Rühmliches gehört zu haben vorgab. Dieses Thema brachte ihn, wie man in Wien sagt, aus dem Häusel. „Ja,” meinte er voll Erbitterung, „ich gab meine Sammlung von viertausend neuen Worten der Akademie hin und bekam dafür lumpige hundert Gulden. So eine Schmutzerei, wenn man bedenkt, wie viele Jahre ich daran gesammelt habe.” - Späterhin ersuchte er mich, ich möge meinem Diener und Reisebegleiter, dem bosnischen Guslaren Milovan Ilija Crljić Martinović gestatten, ihm am nächsten Tage einen Besuch zu machen. Ich war damit einverstanden.
- 12 -
In der besten Laune kam am anderen Tage mein Diener vom Besuche heim und sagte lachend zu mir: „Einen grösseren Narren als diesen Schwarzrock sah ich noch nie.” „Mensch, lästere nicht! Was hast du denn gesehen?” „Denk dir, Herr! Er setzte mir eine Flasche Wein vor, nöthigte mich zum Trinken und forderte mich auf, ich soll ihm ganz ungewohnte Wörter sagen, damit er sie aufschreibe. Ich wusste wirklich nicht, was er von mir wollte; da schenkte er mir fünfzig Kreuzer, um mich aufzumuntern. Na, und so hab ich mir denn Worte erdichtet (smisljo), wie solche noch nie gehört worden” „Milovan, du bist ein Galgenstrick. Wenn er dir auf deine Schelmerei kommt, so wird er auch von mir schlecht denken, der ich dich ihm angerühmt.” „Herr, schlechter kann er schon nicht. Wenn du nur wüsstest, was er dir zugemutet - ” „So lass doch hören, was wars denn?” „Weisst, er fragte mich, hat dein Herr öfter mit Frauen zu tun gehabt?” „Und was hast du darauf geantwortet ?” „Ich sagte: hochwürdiger Vater, ob einmal oder keinmal, weiss ich nicht. Bei meinem Glauben, eine Pfarrerköchin lebt auch nicht keuscher, wie mein Gebieter!” „Zerplatz, Milovan, du bringst mich noch um meinen guten Ruf!” „Herr, sei mir nicht gram darüber! Schwarz fand ich die Kutte vor und schwarz liess ich sie zurück.”
Ich nahm mir vor, meinen Diener Niemandem mehr zu verborgen, obgleich ich sicher war, dass er nichts Nachteiliges von mir gelernt, auch nicht hinsichtlich der Frauen. Auf Reisen und im Preisen muss man dreierlei W von sich weisen: faule Würste, feile Weiber und Fuselweine, dann kitzelt man sich aus jeder Wanderschlamastik heil heraus. Daran hielt ich immer unverbrüchlich fest. Ich habe darüber seinerzeit Dr. Radde, Dr. Junker, Dr. Finsch und einen russischen Forscher, Erast Konstantinovič Brodskij, fein ausgekundschaftet und die gleiche Diätetik auch von ihnen als Reiselebensregel anerkannt gefunden.
Die Mitteilungen meines Guslaren ergötzten mich im Übrigen höchlich, und am nächsten Tage besuchte ich Pavlinović, um mich des Näheren über die „Worte” zu unterrichten. Pavlinović lobte meinen Diener über die Massen. „Denken Sie sich nur,” sagte er, „sechzehn ganz neue Worte in einer einzigen Stunde!” „Wollen Sie, Hochwürden, die Güte haben, mir diese Worte zu zeigen ?” „Ach nein, so haben
- 13 -
wir nicht gewettet,” entgegnete er mit der Miene der Überlegenheit: „Wenn Sie Worte wissen wollen, beheben Sie sich selber darum zu bemühen. Übrigens werden Sie sie ohnehin seinerzeit im akademischen Lexikon finden.” Bald darauf erfolgte mit einem Krach der Abbruch unserer Beziehungen. Er hatte die Gewohnheit, im Parlamente nur kroatische Reden zu halten, weil er meinte, man werde doch einmal aus Begierde, seine Ansichten kennen zu lernen, die kroatische Sprache sich aneignen müssen. In Wahrheit flüchteten alle Abgeordneten, Stenographen und Journalisten, sobald er den Mund auftat. Nur der Präsident, ein greiser Pole, benutzte die günstige Gelegenheit, um ungestört ein wenig einzunicken. Pavhnoviö wusste, dass ich gewandt kroatisch stenographire und forderte mich auf, aus Patriotismus seine Reden jeweilig aufzunehmen und in deutscher Übersetzung den Zeitungen
zu vermitteln. Zu seinem Verdrusse machte er da die Erfahrung, dass mein Patriotismus bei weitem nicht den Gipfel seiner Erwartung erklommen. Zur Strafe weigerte er sich, mir den Betrag von dreizehn Gulden zu ersetzen, den ich kurz vorher bar für ihn ausgelegt hatte. Ich erhielt richtig nie wieder mein Geld.
Kurelac und Pavlinovic waren von der besten Absicht beseelt, die Lexikographie zu bereichern, und doch ist es nur ein Verdienst ihres überbegeisterten Eifers, dass jetzt im grossen Wörterbuche der südslavischen Akademie, einem im übrigen monumentalen Werke, böhmische Korallen des slavischen Wortschatzes eingeschmuggelt erscheinen. Richtiger wäre es vielleicht, das Verdienst auf das Kerbholz der besonderen Methode zu schneiden. Das ist nicht persönliche Schadenfreude, die dem gelassenen Marktberichterstatter schlimm anstünde, und besagt trotzdem nichts anderes als die frühere Wendung. „Der gerade Umweg ist der nächste Weg: schön behutsam dem grossen Köter ausweichen und bei der kleinen Hinterthür ins Haus hineinschleichen”, beriet Anica Bazlamaca einen Burschen aus dem nächsten Dorfe, dessen Besuch sie nachts entgegensehen wollte, um seinen Standpunkt und seine Tatkraft in gewissen Lebenslagen zu erfahren.
Nennen wir also die Sache: sprachwissenschaftlichböhmelnde Methode, und das Decorum bleibt gewahrt. Sie hat sich auf dem Götter- und Mythenmarkte eine imponirende Position errungen und schon wiederholt die Börse in Erstaunen versetzt.
- 14 -
So z. B. verdankt ihr unter anderen der gallische Gott der Vergeltung ENCIXA sein Dasein.

Nun muss ich als gewissenhafter Berichterstatter, der nur sichere Course notirt, dem ersten und zuverlässigsten Gewährmanne, meinem älteren französischen Collegen Herrn Henri Gaidoz, das Wort lassen; denn erstens zählt ENCINA zu den allerböhmischesten Korallen der Götterwelt und ist in seiner Art ein Meisterstück, und zweitens verdanken wir die nähere Kenntnis doch nur dem Pariser Genossen, der seit vielen Jahren alle Korallenfabrikanten heimsucht und zum Schrecken solcher geworden ist, die durch Verlautbarung ihrer Erzeugunggeheimnisse eine Gewerbestörung erfahren. Gaidoz ist nämlich die allen Reportern gemeinsame Tugend eigen: die Verschwiegenheit in Dingen, von denen ihm nichts bekannt wird; es ist jedoch ein Unrecht, dass ihm die Korallenfabrikanten alles Böse nachreden, trotzdem er zu ihrem Ruhme arbeitet. Statt Dank heimst er meist ein: Gestank. Im ersten Bande der „Keltischen Bundschau” ¹) war aus der Feder De Barthelemys ein Aufsatz über eine gallische oder gallo-römische Statuette erschienen, die von Gaidoz als eine der vielen Darstellungen des Taranis, des gallischen Donnergottes, aufgefasst wird. De Barthelemy war aber der Ansicht, die Figur stelle den gallischen Todgott vor, von dem bei Cäsar die Rede ist, und fand auch eine Ähnlichkeit mit dem Dis Pater oder Pluto der Römer heraus. Das Bild des Gottes ist in Holzschnitt auch in Gaidoz' Skizze über die Religion der Gallier ²) auf einem besonderen Blatte wiedergegeben. Der langbärtige und lockenhaarige Gott schaut ernst drein, ist mit einer enganschliessenden, bis an die Knie reichenden Jacke bekleidet, hält in der Bechten eine Schale und in der Linken einen grossen Hammer, dessen Stiel so lang als der Gott gross ist. Knapp beim linken Fusse ist in römischen Uncialen die rätselhafte Inschrift zu lesen:
- 15 -
ENCINA.
De Barthelemy hatte in seiner Studie von dieser wichtigen Inschrift nicht die geringste Notiz genommen, aber sie entging nicht dem schärferen Auge eines anderen bedeutenden Sprachforschers, der zugleich, nach Gaidoz' Versicherung, „un celtistede Premier ordre” ist. Der, sein Name wird nicht genannt, übersandte an Gaidoz folgende tiefgelahrte Auseinandersetzung über:
ENCINA.¹)
„Der interessante Artikel über den gallischen Dis Pater, mit dem die keltische Rundschau eingeleitet wird, stellt nicht lediglich diesen Gott in Holzschnitt dar, sondern enthält auch, eine kleine Inschrift. Obgleich man im übrigen nicht weiss, wo sie genau zu lesen steht, und trotz ihrer Kürze (sie besteht aus dem einzigen Worte ENCINA), so scheint mir diese Inschrift nichtdestoweniger eine spezielle Untersuchung zu verdienen.
Das einzige Mittel, das wir in den meisten Fällen anwenden können, um zum Verständnis gallischer Worte zu gelangen, besteht darin, nach den phonetischen Gesetzen ihrem Ursprung in den neukeltischen Sprachen nachzuforschen. Wir wollen das in Frage stehende Wort nach dieser Methode zu enträtseln suchen. Die Wurzelsilbe des Wortes ist enc-; wo sie im Irischen vorkommt, ist zu beachten, dass der nasale Laut hier vor eine Tenuis (wie vor s und f) fällt, doch dass zum Ersatz der vorhergehende Vocal in den betonten Silben, lang geworden ist. Enc wäre danach im Altirischen ec, nach der Analogie von dét = „dent” cét = „cent” In den britischen Sprachen behauptet sich aber im Gegenteil der Nasal unter ähnlichen Verhältnissen, nur hat sich das vorangehende e regelmässig in ein a umgelautet, was sowohl für die betonten als für die unbetonten Silben gilt, so z. B. dant, cant, argant (altir. airget, „argent”); das ist eine Wandlung, die im Französischen bis auf unsere Tage Geltung behalten und sich häufig auf ein altes in erstreckt hat. Das gallische enc- muss daher in den britischen Sprachen ein anc- ergeben.
„Nun bietet uns das Altirische ein wohlbekanntes Wort éc „Tod” dar, dem im selben Sinne in den britischen Sprachen das Wort an con entspricht (Glosses de Luxembourg,. vocabulaire d'Oxford, Catholicon, Buhez), das man späterhin
- 16 -
im Cornischen ancow und im Bretonischen ankoii, im Bretonischen von Vannes ankeu, im Gallischen angeu und in den Mabinogion angheu, agheu geschrieben findet. Diese Worte stehen untereinander in derselben Beziehung wie das irische des, dess „dexter” zu dem gallischen dehou, de heu u. s. w., das auf eine primitive Form zurückgeht, an die der gallische Name Dexiva oder Dexsivia anknüpft (die griechische Form  mit dem sonderbar angebrachten Accent bezieht sich vielleicht auf eine Form
mit dem sonderbar angebrachten Accent bezieht sich vielleicht auf eine Form  . Folglich, so wie ann ankou, nach der Ausführung von Troude, nur „im erhabenen Stile und in der Poesie zur Personifizierung des Todes” gebraucht wird, würde man sich zur Annahme geleitet fühlen, man müsse Enciva an Stelle von Encina lesen. Der Name des Todgottes würde auf diese Weise ganz und gar mit dem irischen ec (eag, eug) und mit dem bretonischen ankou (angeu) sich decken. Ich gestehe, dass ich einen Augenblick daran gedacht habe. Indessen ist es durchaus nicht notwendig, das Geringste an der Inschrift zu ändern, um einen befriedigenden Sinn des gallischen Wortes zu gewinnen.
. Folglich, so wie ann ankou, nach der Ausführung von Troude, nur „im erhabenen Stile und in der Poesie zur Personifizierung des Todes” gebraucht wird, würde man sich zur Annahme geleitet fühlen, man müsse Enciva an Stelle von Encina lesen. Der Name des Todgottes würde auf diese Weise ganz und gar mit dem irischen ec (eag, eug) und mit dem bretonischen ankou (angeu) sich decken. Ich gestehe, dass ich einen Augenblick daran gedacht habe. Indessen ist es durchaus nicht notwendig, das Geringste an der Inschrift zu ändern, um einen befriedigenden Sinn des gallischen Wortes zu gewinnen.
„Natürlicherweise ist uns des weiteren die Quantität des i in der Endung - ina des Wortes Encina unbekannt. Encina hat eine, soviel als dies nur zu wünschen ist, genaue Entsprechung im altirischen écen, im walisischen angen und, in noch viel älteren Formen, im cornischen anken (Dramen), im bretonischen anquen, ancquen (Gatholicon, Jesusmysterium, Buhez), lauter Worte, die mit ihren verschiedenen Schattirungen auf die ursprüngliche Vorstellung des Zwanges, der Notwendigkeit, der  (dieses Wort ist gleichfalls in Encina durchsichtig) zurückführen. Ich zweifle nicht, dass man Encina mit einem kurzen i lesen muss. Dieses i würde im Irischen erscheinen, und zwar in der alten Redewendung ar écin (Zeuss, Grammatica celtica, 2. Aufl. S. 349: ar éigin, „by force, with difficulty” in der Ergänzung von (O'Donovan) und desgleichen in égin „zuverlässig” bei O'Davoren; ja, nach Troude stünde das bretonische ankin für das gewöhnliche bretonische anken „Mühe, Plage.” Die Form ecin, gleichgiltig ob sie nun von Ursprung ein Dativ oder ein Accusativ ist, weist fürs Altirische auf ein Femininum hin, und das Bretonische stimmt in dieser Hinsicht damit überein; auch die Endung des gallischen Wortes scheint sich darauf zu beziehen. Das Cornische bietet uns kein bestimmtes
- 17 -
Geschlechtzeichen dar, und trotzdem hat Williams, vielleicht aus Überstürzung, das Wort als ein Masculinum bezeichnet. Sogar im Walisischen, wo die Wörterbücher eine masculine Form neben der femininen angeu liefern, weist das e der Endsilbe vielmehr auf ein Femininum hin.
(dieses Wort ist gleichfalls in Encina durchsichtig) zurückführen. Ich zweifle nicht, dass man Encina mit einem kurzen i lesen muss. Dieses i würde im Irischen erscheinen, und zwar in der alten Redewendung ar écin (Zeuss, Grammatica celtica, 2. Aufl. S. 349: ar éigin, „by force, with difficulty” in der Ergänzung von (O'Donovan) und desgleichen in égin „zuverlässig” bei O'Davoren; ja, nach Troude stünde das bretonische ankin für das gewöhnliche bretonische anken „Mühe, Plage.” Die Form ecin, gleichgiltig ob sie nun von Ursprung ein Dativ oder ein Accusativ ist, weist fürs Altirische auf ein Femininum hin, und das Bretonische stimmt in dieser Hinsicht damit überein; auch die Endung des gallischen Wortes scheint sich darauf zu beziehen. Das Cornische bietet uns kein bestimmtes
- 17 -
Geschlechtzeichen dar, und trotzdem hat Williams, vielleicht aus Überstürzung, das Wort als ein Masculinum bezeichnet. Sogar im Walisischen, wo die Wörterbücher eine masculine Form neben der femininen angeu liefern, weist das e der Endsilbe vielmehr auf ein Femininum hin.
„Nach alledem könnte also Encina die Notwendigkeit, das Schicksal, die saeva necessitas par excellence bedeuten.
„Weitere Schlussfolgerungen ziehen, hiesse den Boden der Gewissheit verlassen. Zweifelohne, ist man geneigt in E n c i n a den Namen des Gottes selber zu erblicken, so kann er doch folgerichtig kein Femininum sein. Trotzdem ist diese Schwierigkeit nicht unübersteiglich; denn Pictet hat in seinem Nouvel essai sur les inscriptions gauloises (S. 56) eine stattliche Anzahl gallischer Namen, die auf -a endigen, aufgesammelt. Aber dies wäre schon ein Betreten des Gebietes der Hypothese; vielleicht hat man es absichtlich vermieden, den eigentlichen Namen der Gottheit auszudrücken.”

- 19 -
Als ob wir den Franzmännern um ihren gallischen Gott Encina neidisch wären, bescheerte uns Deutschen ein versöhnendes Schicksal in jüngster Zeit eine echt urgermanische Gottheit weiblichen Geschlechtes:
Über ihren Ursprung und ihre indogermanisch verwurzelte Vetter- und Magenschaft teilt uns Herr Dr. R u d o l f M e h r i n g e r, a. o. Professor an der Universität Wien, in seinen „Studien zur germanischen Volkkunde” (Mitt. der Anthrop. Gesellschaft in Wien. XXII. B. 1892. S. 101-104) so mancherlei höchst merkwürdige und erstaunliche Dinge mit. Folkloristen war es, die Wahrheit zu sagen, nie ein Geheimnis, wer und was On ewaig sei und bedeute, aber lassen wir lieber Herrn Dr. Mehringer das Wort, dem Foestion, ein gebürtiger Ausseer, als Wegweiser auf den Irrpfaden der Göttin Onewaig vorangeleuchtet hat.
„J. C. Foestion hat von seinem Vater, einem gebürtigen Ausseer (und noch jetzt in Aussee wohnhaft) Folgendes erfahren: Man sage sowohl in Aussee wie auch in der Umgebung und in Hallstadt: „die Oniwaig”. In dem Hause „Beim Aufhalter” im Markte Aussee habe sie sich auch gezeigt. Das Haus ist vor dreissig Jahren abgerissen worden. Abends gegen 8 Uhr meldete sie sich; starkes Gepolter und schwere Tritte, die Stiege auf und ab, kündeten sie an. Auch hier wurden die Geistlichkeit und die Gerichtpersonen um Beistand angegangen.
„Nach anderen mir zugekommenen Nachrichten sagt man in Oberösterreich bei einem gespenstigen Klopfen: „es hot ongwaigt”. In Scheibbs sagt man: „es tuat mi onewaigen” und in Neuberg: „es hat mi ongwailt”. Mehrfach höre ich, dass in Steiermark für „onewaigen” auch „onewailn” und „onwailn” dialektisch gesagt wird.
„In anderen Teilen der Steiermark kennt man den „Ohnewaigl”. J. C. Foestion hat mich auf die Abhandlung von Hans von der Sann, betitelt: „Der Sagenschatz des Steierlandes” (S. A. jL. Mitt. d. D. u. Österr. Alpenvereines” 1887, Nr. 21 bis 23) aufmerksam gemacht. Auf S. 29 sagt der Verfasser, dass der „Ohneweigl” sehr gefürchtet ist. Wenn ein Gespenst sich melde, sage der Landmann: „'s tuat ohniweigln”; in der
- 20 -
Regel gelte der „Ohneweigl” als ein hässlicher, boshafter Plagegeist. Bald sei es der Böse selbst, bald eine arme Seele, die wegen einer ungesühnten Schuld keine Ruhe finde.
„Danach könnte auch der Name „Weigl” soviel heissen, als „Teufel”. Ein „Weigelsdorf” liegt in Niederösterreich bei Pottendorf. Ein Relief daselbst an der alten Kirche, das sehr primitiv und gewiss ehrwürdigen Alters ist, zeigt einen Drachen, ein Pferd und einen Vogel. Ob der Drache mit dem Namen Weigelsdorf etwas zu tun hat. steht dahin. Teufel ist als Name und als Bestandteil von Namen sehr häufig.
„Auch zur Etymologie des Wortes ist noch einiges nachzutragen (angefangen damit hat Herr Dr. Mehringer im XXI. B. derselben Zeitschrift S. 101 ff.). „Oniwaig” ist, wie ich ausgeführt habe, nichts anderes als germ. *ana-wīγō, „die Anfechterin”, sowie „Oniwaigl” einem alten *ana wīγiloz sw. m. „der Anfechter” entspricht.
„Der erste Bestandteil „oni” kann dem goth. ana, mhd. ane entsprechen. Vrgl. obi = mhd. abe, auffi := urgerm. ůppa (Kluge s. V.), ummi = mhd. umbe u. a. Dass oni wirklich nichts anderes ist, als ana, wird vollkommen schlagend damit bewiesen, dass man auch „onwailn” statt „oniwailn” sagt.
„Ein starkes verbum inf. * wīγɀanan wird durch das Factitivum * waīγjanan (ahd. weigjan, ags. vaegen, „affligere, vexare” gevaegon, „afficere, fatigare, vexare”, mhd. weigen, anweigen, „anfechten”. Mittelhochdeutsches Wörterbuch III. S. 556) wahrscheinlich gemacht.
„Das Denominativum von ana-wīγ liegt als ana-wīgjan dem „onwaign” in Formeln, wie: „es hot ongwaigt”, „es tuat mi onewaign” zu Grunde. Von einem n-Stamme scheint „onewaigna” ausgegangen zu sein. So ist nämlich Bd. XXI. S. 121 Anmerkung, Zeile 2 von unten, zu lesen.
„Das germanische Verbum * weiɀō, * waīɀ, * γawiγanaz hatte etwa die Bedeutung „besiegen” oder überhaupt „afficere”. Es entwickelte sich dann nach doppelter Richtung, so dass es einerseits „bezaubern”, anderseits „weihen” bedeutete. Wann diese Bedeutungänderung vor sich gegangen und welche Bedeutung die andere abgelöst, vermag ich nicht zu erkennen. Vrgl. auch an. vīg Kampf, vīgr (auch nom. prop.) gegen veihs heilig. Fick II³, S. 303, setzt zu an. wig das griech. αīkη. Zu dem Namen an. Vīgr steht im Ablaute das Waiga auf dem zweiten Bracteat des Berliner Museums, vrgl.
- 21 -
Henning, die deutschen Runendenkmäler, S. 125. Müllenhoff hat ihn mit ahd. Weiko (belegt 810, 813) identificirt.
„Das alte part. perf. pass. ist im Althochdeutschen erhalten in irwiganer „confectus”, Mons. gl. Vgl. auch die Belege von erwigen im Mittelhochdeutschen Wörterbuch III 650, wo W. Müller unnötigerweise ein eigenes starkes * wīhe
„conficio” annimmt.
„Ein starkes nom. ag. auf ra war * waiγra- ahd. weigar „tollkühn”, mhd. weiger „stolz, vornehm”, wovon das Denominativum „weigern”.
„Auffallend ist, dass es ein Nomen * waiγ mit der Bedeutung „Becher, Trank” gegeben hat. Hieher gehören ags. vaege, vêge n., „patera, poculum”, Grein, Sprachschatz 11.643, alts. wêgi und an. veig.t. Nach Egilsson bedeutet das letztere „cerevisia, quaevis potio eximia”. So wird es von der Milch der Ziege Heidlirün gebraucht. Ein anderes Veig f. ist der Name einer iforwegischen Insel und Snorra-Edda IL 489 soll veig „Weib” bezeichnen. Aus der angegebenen Stelle geht das aber nicht hervor. Es werden daselbst „Kenna heiti” angeführt, und da heisst ein Vers: „biork veig ok tholl”. Natürlich heisst veig ebensowenig „Weib” wie bigrk (f. Birke), sondern ist aus componirten Frauennamen erschlossen.
„Cleasby verzeichnet I. veig f. „a Kind of strong beverage, drink”, das dann metaphorisch auch pith, strength, gist bezeichne. Ein II. veig findet er in den Namen Gullveig, Sölveig, Almveig, thörveig u. a.
„Danach steht die Sache wohl so, dass veig ursprünglich „Kraft” bezeichnete (wie auch Bugge und Henning annehmen) und danach erst im Angelsächsischen und Altnordischen den Bedeutungwandel „Krafttrank”, „Becher” durchmachte.
„Von auswärtigen Verwandten unserer Sippe sei nur noch [aicow aixn] herbeigezogen, ersteres = *waiwijkjw Griech. [eixw] „weiche” gehört zu ahd. wichu, wehsal, goth. viko „Woche”, lat. vices, sowie zu ai- vic „trennen, scheiden”, also nicht hieher.
„Gullveig heisst nach dem Gesagten „Goldkraft, Goldzauber” und personificirt „Goldhexe”. Eine „Hexe” (oder vielleicht besser „Erscheinung”, „Gespenst”) wird sie ja auch genannt. Voluspá Strophe 25: Heidhi hana hétu „man nannte sie Hexe”.
- 22 -
„Allerdings ist die Etymologie von Heidlir noch nicht klargestellt, was zu tun aber sehr einfach scheint. Zusammenhang mit „Haide” ist von vorneherein unwahrscheinlich und bleibt nur goth. haidus unser „heit” zum Vergleiche übrig.
„Und das stimmt auch ganz trefflich. Im alh. heisst Ketü-s „die Lichterscheinung” und kann auch „Fahne”, „Komet” u. dgl bedeuten.
„Während also die germanischen Sprachen das Wort verblassen Hessen (mhd. heit „Art”, ahd. heit. „persona, Stand,” ags. häd, „Stand, Geschlecht”, goth. haidus „Art”) hatte das Altnordische die alte Bedeutung „Lichterscheinung” (und dann „Erscheinung” überhaupt, „Gespenst”) deutlicher bewahrt. Die alte Bedeutung liegt klar vor in ai-cétat „er nimmt wahr”, in dem gemeingermanischen „heiter”, d. h. „hell, glänzend”, eine übertragene in an. heidhr „Ehre”.
„Hofrat G. Bühl er machte mich bei der Gullveig und ahd. Cholduuaih auf den nicht seltenen Familiennamen „Koldeweih” aufmerksam. Mir scheint ein Zusammenhang in der Tat unleugbar. „Koldeweih” ist dem Anscheine nach ein altes * goldwīch, wie „Göttweih” einem alten Gotewich (1065), Gotwick, Gotwic, Gothweich entspricht. Vgl. Literar. Centralblatt 1856. Nr. 48. Ahd. Cholduuaih erklärt F. Detter, Arkiv for nordisk filologi Vlll. S. 305 als blos graphische Variante von Cholduuaig. Göttweih ist zweifellos „Gottestempel”, eine Erklärung, die man auf den Namen Goldwaih nicht ausdehnen kann.
„Der zweite Bestandteil von Cholduuaig steht also im Ablaut zu Koldeweih. Dieselbe Lautstufe wie dieses hat Onewaig, nämlich ī, aber die beiden stimmen sonst nicht genau; das erstere enthält * wīɀ, das letztere * wīγ. Man kann nur Stn Stammabstufung * waiɀ * wīγ denken.
„Dass die W ö r t e r Gullweig, Cholduuaih, Koldeweih (oder Koldewey) und Onewaig mit einander im Zusammenhange stehen, glaube ich also festhalten zu dürfen.
„Eine ganz andere Frage ist die nach den sagengeschichtlichen Verhältnissen, und darüber steht mir gar kein Urteil zu. Aber eine Frage ist vielleicht an die Gelehrten dieses Faches gestattet: Ist es nicht sehr auffallend, dass uns hn Norden eine „Erscheinung”, ein „Gespenst” begegnet mit dem Namen „Goldkraft”, „Goldzauber”, im Süden,
- 23 -
in Deutschland, wenigstens der Name, und dass in einem grossen germanischen Sagenstoff, der Nibelungensage; dieser Goldzauber, verwandelt in einen Fluch, der am Golde haftet, uns in poetischer Gestalt entgegen tritt?”

Donner und Doria! Jetzt schreibe ich eine gehäufte Stunde an dieser „Studie zur germanischen Volkkunde” ab, als wäre ich ein magistratischer Diurnist und wollte mich beim Adjuncten einschmeicheln. Na, ich denke mir, Herr Dr. Mehringer hat gar gewiss länger als einen Monat schwitzen müssen, bis er alle die schrecklich gelahrten Citate zusammengestellt hat. Das alles hätte er sich und mir ersparen können, hätte er anstatt den J. C. Poestion, gebürtig aus Aussee, ein wirkliches altes Weib zu Aussee über die Bedeutung von hneweig ausgeholt, oder lieber - ich zum mindesten tat es lieber - einer hübschen Bauerndirne, z. B. der Messnerischen, die sich nicht übel gemaust hat, das Goderl gekratzt, damit sie ihn neckisch abwehrend einen Ohneweig heisse. Ein Wort hätte das andere ergeben, und so würde er im Tändeln erfahren haben, dass die Seelen jener Unglücklichen, die eines, wie man sich ausdrückt, unnatürlichen Todes jäh versterben, d. h. ohne vorher zu beichten und das hl. Sacrament zu empfangen, was man kurz in der Volksprache: ohne Weig sterben nennt, verdammt sind, so lange „ohne Weig” unstet ihre ehemaligen Aufenthaltorte heimzusuchen, bis die Überlebenden durch Messen oder Sühnung ungesühnter Freveltaten des Verstorbenen oder gegebenenfalls durch ein dem Leichnam gewährtes ehrliches Grab, den Seelen „ohne Weig” zum ewigen Frieden verhelfen. Natürlich ist so ein Geist „ohne Weig” ein übel gelaunter Geselle, dieweilen er selbst nach seinem körperlichen Tode noch alleweil keine Ruhe finden kann, sondern gezwungen ist, die Albernheiten der Menschen mitanzusehen, ohne mehr an ihren Vergnügungen und Genüssen teilnehmen zu dürfen.¹) Im Laufe eines längeren Gespräches hätte er gemerkt, dass die Messnermierzl für
- 24 -
Weihwasser: Walgwossa, für leihen Sie mir: laign S' mör, für Mohn: Mög'n, für Sträuchen: straukn, für Rauchen: rauk'n, für einweichen: ainwajk'n, und ähnlich sich auszudrücken pflegt.
Wenn er so getan hätte, würde er freilich die germanische Mythologie mit keinem Dämon Onewaig bereichert, sich jedenfalls einer erheblichen Mühe enthoben und dir, o Leser, die Freude der näheren Bekanntschaft mit Onewaig vorenthalten haben. Was das „sagengeschichtliche Verhältnis” anbetrifft, so erlaube ich mir als Marktberichterstatter zu erinnern, dass der und die „Ohne Weig” internationale Spukgestalten sind, über die mein Börseblatt für Volkkunde „Am Ur-Quell” mancherlei aus den Coulissen zu erzählen weiss. Die Schlussfrage kann ich nicht beantworten, weil sie an die Gelehrten des Faches gerichtet ist, ich aber zu wenig gelehrter Schwachverständiger vom Fach bin, um in dieser klaren Sache unklar zu sehen.
Notiren wir im übrigen die Stimmung der Producenten, so müssen wir zugeben, dass sowohl Herr *** als auch Herr Dr. Mehringer dem neckischen Zufall auf den Leim gegangen sind. Encina und Ana-wiγioz-Oniwaig sind Irrtümer, doch keineswegs bewusste Täuschungen, die auf Irreführung anderer berechnet gewesen wären. Will man gerecht sein, so muss man sagen, sowohl Gott Encina wie auch Oniwaig, die Anfechterin, sind falsche böhmische Korallen. Uns kann es sich dabei nur noch um die Cursfixirung handeln, welche von beiden wertvoller sei. Um mich weder in Frankreich noch in Österreich mit den Leuten zu verfeinden, will ich, wie immer, ein salomonisches Urteil fällen (im Geburtzeugnis heisse ich nach der Matrikel nur Salomo), was Rechtens: Encina ist gerade so viel wert wie Oniwaig Anfechterin, und die Oniwaig soviel wie Encina, und wer den einen haben will, muss auch die andere mit in den Kauf nehmen. Ausbofeln lassen wir uns nicht. Ganz gewiss nicht, „wohl aber darf die Ethnologie und die allgemeine Methodenlehre die Frage an die Etymologie richten, ob sie fähig ist, die Discussion (über Namenkunde) mit eigenen Mitteln auf ein sicheres Ergebnis zu vereinigen. Mögen nun aber auch die Lautgesetze noch so ausnahmlos walten, zugestanden ist, dass die Gesetze des Übergangs der Bedeutungen noch sehr im Dunkeln liegen. Es macht durchaus nicht den Eindruck eines willkürfreien Schhessens, wenn sich
- 25 -
zeigt, wie man zur Sinnerklärung eines dunklen Wortes im ganzen Bereich der verwandten Sprachen, der früheren oder späteren Sprachentwicklung jede beliebige Bedeutung heranzieht, die gerade in den Kram zu passen scheint. Es scheint doch, als ob die Ergebnisse der etymologischen Reconstruction stark davon beeinflusst seien, was man zu finden und zu beweisen sucht.” So drückt sich sehr zurückhaltend und vorsichtig ein recht tüchtiger Ethnograph F. Guntram Schultheiss bei Erörterung der mannigfachen Etymologien aus, die über „Germanische und andere Völkernamen” aufgestellt wurden (Globus LXIII. H. 6 S. 96) und später, nach Darlegung zahlreicher etymologischer Aufstellungen von höchst fraglichem Werte, kommt er wieder darauf zurück: „Das heutige Irisch, Gähsch u. s. w. und die Wurzeln aus dem Bereich der anderen indogermanischen Sprachen, damit lassen sich freilich die Etymologien herstellen, wie die Wappen, ganz nach Wunsch und Neigung. Nötig ist nur der Glaube, dass alles richtig und echt ist. Es fehlt uns auch das richtige Zutrauen, wo das Sanskrit in Frage kommt. Es ist ja eine sehr schöne, grammatisch fein ausgebildete Sprache, aber die Molluskennatur der Wortbedeutungen beweist eine taumelnde Phantasie oder zahllose Ansätze zu Mundarten und Tochtersprachen.” (Globus LXIII. H. 8. S. 128.)

Wir haben es, genau und beim Lichte besehen, gar nicht notwendig, erst auf Indianerpfaden nach falschen böhmischen Korallen zu suchen und mit deren langwierigen Beschreibung die Geneigtheit unseres Lesers - Gott gebe ihm eine wackere Nachkommenschaft - uns halb zu verscherzen, da wir - dem Himmel und den regenreichen Jahren sei es gedankt - im Folklore eine Fülle echter böhmischer Korallen auf dem Markte vorrätig haben. Der litauische Folklore ist z. B. bei uns in deutschen Landen mit böhmischen Korallen schon derart gut versorgt, dass mancher Forscher lieber auf alle litauischen Volküberlieferungen freiwillig Verzicht leistet, ob er als ein nicht spezieller Kenner des Litauischen auch nur eine Handvoll solcher Korallen in Commissionverschleiss übernähme. Jemand, der sich litauisch angeschmiert und öffentlich blamirt hatte, entschied sich dafür, niemals wieder an diesem Artikel Anteil zu nehmen; denn er habe an
- 26 -
einer Niederlage genug und brauche keine Filialen. Die Herren Korallenfabrikanten sollten doch endlich die Ermahnung Edni. Abouts beherzigen: Le public n'accorde sa confiance qu'aux niensonges vrai.seuiblables. zu deutsch: Das Publicum ist nicht im Accord der Finanzinstitute, die höchste Fruktifizirung versprechen. Darum findet sich, um nur einen Beleg anzuführen. in Andrian-Werburgs sonst von Materialien strotzendem Werke „Der Höhenkultus asiatischer und europäischer Völker”, fast jedes Volk der beiden Weltteile, nur
nicht das litauische vertreten, gerade als ob es im Inneren des fernen Franz-Josef-Landes seine Wohnsitze hätte. Diese Ausnahmestellung verdanken die Litauer ihrem Leibforscher und Mythenschwammler „Dr.” Edmund Veckenstedt.
Jan Karłowicz, ein polnischer volkkundiger, Berichterstatter und Herausgeber eines polnischen Börseblattes für Folklore, bemerkt sachlich ganz zutreffend, „Dr.” Veckenstedt sei kein Neuling auf dem Gebiete der Mythenfabrikation. Für einen routinirten Fabrikleiter und Exporteur ist es innnerhin schmeichelhaft „kein Neuling” zu heissen. 0, gewiss hat der schon eine goldene Civilehrenmedaille für unglaublichste Götter, Mythen und Legenden sowohl der Litauer als der Wenden verdient. Jammerschade, dass keine Medaillen für solche mythische Leistungen verliehen werden. Zum mindesten hat „Dr.” Veckenstedt gegründeten Anspruch auf die Ehrenpräsidentschaft der Arizona-Kicker-Akademie.
Se. Ehrwürden, Herr Rabbiner Akiba, Gutzkowischen Andenkens, erinnert uns hier mit Recht an sein Leitmotiv: „schon alles dagewesen”. Seume, der nicht einmal Rabbiner war, gelangte zur selben Überzeugung und drückte sie aus in dem Spruche: „Menschen sind, was Menschen immer waren”. Damit hat er unbewusst einen Gedanken ausgesprochen, der zu den Axiomen der Ethnographie gehört. Das Grosse und das Kleine, das Erhabene und das Niedrige, alles, alles wiederholt sich in der Menschengeschichte. Was neu ist, wird alt, und was alt neu. Für den Ethnographen gibt es darum auch keine Wunder und keine Überraschungen, was übrigens ebensogut der serbische Bauernverstand in seiner Art sich zurechtzulegen gewusst hat. Das Sprichwort sagt: svako cudo za tri dana, d. h. jedes Wunder [gilt nur] für drei Tage [für ein Wunder], dann ist es eine gewöhnliche Erscheinung. Auch Veckenstedts wunderbarer Göttererfinderglanz vermindert sich um ein Bedeutendes, wenn man weiss,
- 27 -
dass er viel zu spät auf der Bildfläche aufgetaucht ist, um ein Recht auf ein Privilegium beanspruchen zu dürfen. Man muss daher Wilhelm Müller (Epigramme) beipflichten, wenn er sagt:

Die Volkkunde ist ganz im Gegensatze zur römischen Epigraphik am Anfang unseres Jahrhunderts, dank den unausgesetzten Nachforschungen ausgezeichneter Vorkämpfer oder Tiefseetaucher, wenigstens ihrem Gerüste nach eine festgefugte Wissenschaft mit untrüglich sicherer Methode geworden, noch ehe böhmische Korallenfabrikanten für ihre Producte die Lärmtrommel rührten und ins Kuhhorn stiessen. Der Erzeuger böhmischer Korallen kann höchstens nach Art der Bauern-
fänger, Ringwerfer, Gimpelleimer hie und da Lehrjungen der Volkkunde übertölpeln, doch erwischt ihn zufällig ein folkloristischer Sicherheitwächter aus der Bürgergarde, so ergeht
- 30 -
es ihm, wie dem „Dr.” Veckenstedt, den Karłowicz aus der Vorhalle des Tempels der Wissenschaft hinausgestäupt und hinausgepeitscht hat.
Es gibt noch so eigentümliche Leute, die den „Dr.” Veckenstedt für einen Fälscher, Narren und äusserst boshaften, verlogenen, drückebergerischen Kerl erklären. Nichts ist ungerechtfertigter und verletzender als diese Vorwürfe, die ich sofort entkräften werde. „Dr.” Veckenstedt ist ein von Dichteritis geplagter Mann, der auf ungezügelter, wilder Phantasie, wie Don Quixote lobesam einst auf der treuen Rosinante, polternd einhertrottet. Er selber ist kein Narr, vielmehr vollgespickt mit verzweifeltestem Wissen und reich an Weisheit wie eine bosnische Winterstube an Ungeziefer jeglicher Art; er betrachtet daher blos die übrigen Menschen als bodenlos verstockte Narren, die er kuranzen müsse, und boshaft, verlogen und drückebergerisch ist er auch nicht, sondern er glaubt nur, alle übrige Welt wäre so niederträchtig, verworfen und abgefeimt schlecht, dass er infolge dessen bemüssigt sei, ihr einen nassen Fetzen nach dem andern ins Gesicht zu schleudern, um sie zu läutern und zu veredeln. Er ist also, wenn man sein Streben ohne Joel Bitschofs Brille, d. h. ohne jede Voreingenommenheit und Leidenschaftlichkeit, unbefangen würdigt, eine originelle Art von Weltverbesserer, also ein verkannter Wohltäter der sündhaften gelehrten Menschheit. Die Überlieferungen der Litauer schienen ihm zu schal, zu mangelhaft und zu dürftig zu sein, also, besserte er nach, oder wie er sich mit reizender Bescheidenheit ausdrückt, er stilisirte sie blos durch. Für solche Opfer und solche Selbstentsagung ward sein Teil Schimpf und Undank. Da hatte er doch allen Grund, mit einer Reihe der anerkanntesten Folkloristen Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Russlands u. s. w. höchst unzufrieden zu sein, und darum hechelt er sie nach der Bank durch und lässt sie bei jeder Gelegenheit seinen wuchtigen Ingrimm fühlen.
Ich selber berühme mich, ein ganzes Jahr lang „Dr.” Veckenstedts Intimus gewesen zu sein. Das war für mich, den Marktberichterstatter, ein glücklicher Griff, wie wenn jemand die blosse Hand in die fliessende Donau hineinsteckt und einen fetten Karpfen von 2 Kg. Gewicht herauszieht. Im Herbste 1888 schrieb mir „Dr.” Veckenstedt - und er schrieb mir wöchentlich mindestens drei Briefe von je 16 bis 24 Seiten Umfang - er zählte im Vertrauen auf meinen Beistand in
- 31 -
der Entjudung der Ethnographie. Ich las den kuriosen Brief meinem Vater vor, der, gleich entrüstet, mir anriet, jeden Verkehr mit „Dr.” Veckenstedt abzubrechen. Ich stimmte meinen Vater durch Überredung versöhnlicher, denn es interessirte mich, zu erfahren, mit welchen Mitteln „Dr.” Veckenstedt die koschere Wissenschaft trefe zu machen gedenke. Das Vergnügen, einen nach Lust sich blamiren zu lassen, durfte mir nicht entgehen. Es tut mir recht leid, dass ich meine drolligen Briefe an Veckenstedt nicht kopirt habe. Kurz, der Effekt war, dass er mich für das Juwel seiner Liebe erklärte und mich vollkommen in seinen Operationplan einweihte. Er teilte mir ganze Proscriptionlisten von Männern mit, denen mit allerlei Mittelchen - im „Kampfe” sind alle erlaubt - Ehre und Seele abgeschnitten und vernichtet werden müsse, so unter anderen den Herren Steinthal, Lazarus, Weinhold, W. v. Schulenburg, U. Jahn, L. Freytag, H. Carstens, Gaidoz, Bezzenberger, Wolter, Karłowicz u. s. w. u. s. w.: nur noch mein Name fehlte im Verzeichnis.
Nach und nach verringerte sich meine Freude an dem Spasse und ich verlor jeden Geschmack daran, als Veckenstedt anfing, sich in seiner Weise mir dankbar zu bezeugen, nämlich in seinem Fabrikmoniteur mich aufs rücksichtloseste zu loben und zu preisen. Mildernd wirkte auf mich der Umstand ein, dass sein Blatt sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit erschien. Indessen drängte er immer ungestümer zur Propaganda der Tat, in der Erwartung, dass ich durch eine Aufsehen erregende Abschlachtung eines ehrlichen Namens endlich die von ihm ersehnte Tüchtigkeitprobe bestehen werde. Manchmal bereute ich es schon, dass ich den Bat meines Vaters nicht befolgt; denn ich sah keinen Ausweg, um anständig den rebellischen Götterfabrikanten von mir abzubeuteln. Ich begann grob zu werden, doch je gröber ich seine Zuschriften erledigte, desto kriechender und demütiger bog er klein bei. Ganz unverhofft sprang mir in meiner Bedrängnis jener Herr bei, dem auch die löbl. Polizei so manchen glücklichen Fang unter Einbrechern, Banditen, Antisemiten, Defraudanten u. s. w. verdankt, nämlich der Herr Zufall.
Lieber Leser - Bibisel sollen deinen Feinden auf der Nase wachsen - sei mir nicht böse, dass ich dich mit so gleichgiltigen Dingen unterhalte. Bedenk doch, dass „Dr.” Veckenstedt einer der bedeutendsten Korallenfabrikanten Deutschlands ist, und dass daher auch der unscheinbarste
- 32 -
Beitrag zu seiner Biographie für die Nachwelt einst nicht ohne Belang sein wird. Zur Erholung will ich dir eine Kindergeschichte erzählen. Als achtjähriger Knabe verlegte ich mich auf die Herstellung von Papierdrachen, nachdem mich das aufregende Räuberspielen, Anmäuerln, (tucati se) Bleilecken (tobati se), der Rossegelfang in den Sümpfen vor dem Städtchen und sogar das Absuchen des Kirchturmes nach Fledermäusen nicht mehr befriedigte. Und da es in den Ferien war, wo das Gros meiner Mitschüler auswärts weilte, die Zurückgebliebenen aber völlig meinen Anordnungen sich fügten, fehlte auch jede Raufgelegenheit. Um nun meiner Gefolgschaft durch eine grosse Leistung zu imponiren, verfertigte ich einen ungewöhnlichen Drachen, der war so lang, wie Veckenstedt, und so breit, wie ein Mondkalb geraten. Das Gestell bestand aus dünnen Weidengerten, der Überzug aus Zeichenpapier und das Gesicht schmierte ich dem Drachen mit Schuhwichse auf. Des Gleichgewichtes wegen war der Drache mit zwei Schweifen versehen und an jedem hing ein Flederwisch. Den Faden erwarb ich einfach dadurch, dass ich im Magazin von den Mule-, Watte-, Crompton-, und Strickgarnpaketen die Spagate losschnürte, aneinanderband und aufknäuelte. Ich mit dem wulstigen Knäuel schritt voran, hinterher trugen zwei Knappen das Ungetüm, das Oberteil Perica Konjeviö, der 15 Jahre später der serbischen literarischen Gesellschaft in Neusatz 30.000 fl. zu Volkbildungzwecken vererbte, das Hinterteil förderte Esau, der Vielfrass, gegenwärtig Schnorrer von Profession, den einen Flederwisch hielt Pepi K., der nun im Irrenhause sitzt, weil er sich einbildet, er sei ein Urchrowote, und den anderen der Edle von Bencetiö, der auch schon verheiratet ist und Bauernstiefel, Kinder und Süsswein erzeugt. Also zogen wir unverzagt nach dem Schlossberg zu den Ruinen der Burg des Türken Sestokrilovic hinauf, der einst 13 Sprachen besser als bosnisch, doch nicht die Kunst verstanden, seinen Besitz bei Zeiten in gute Staatschuldverschreibungen zu konvertiren.
An dem schwülen Sommernachmittage regte sich kaum ein Lüftchen und mein Drache wollte sich nicht recht in die höheren Regionen erheben. Um ihn oben zu erhalten, musste ich fleissig laufen und viel Faden abwickeln. Der Spagat fing aber an, tief in das zarte Fleisch meiner Händchen einzuschneiden; auslassen mochte ich nicht und weinen durfte ich auch nicht, sonst war es um meine Reputation geschehen.
- 33 -
Ich beklagte im Stillen bitterlich meine Grossmannsucht, denn die Not war schwer.
Doch schon nahte die Erlösung in Gestalt eines feindlichen Gassenjungen. Der hob voll Tücke einen Stein auf und schleuderte ihn dem Drachen auf den wichsigen Rachen. Das behagte dem Ungeheuer nicht. Zweimal überschlug es sich in der Luft und stürzte darauf kopfüber auf die Ziegeldachbude des Advocaten Neunfinger - er hiess Kovaceviö und hatte neun Finger - herab und riss einige Ziegel los. Einäugig Ännchen (öorava Nana), die redegewandte Schaffnerin des alten Junggesellen erschien ohne Zaudern auf dem Schauplatze der Handlung in Begleitung ihres zahmen Mastschweines, das ihr wie ein Hündchen überall nachfolgte, und schickte sich an, uns einen längeren Vortrag zu halten. Ich hörte nur die Einleitung: prokleta dičurlijo! Verfluchtes Kinderpack! dann liess ich Drachentrümmer und Spagat im Stich und floh wie beflügelt in die Löwengasse hinab, wohin sich meine Getreuen gleich beim Beginn der Katastrophe gerettet.
Ähnlich erlöste mich ein literarischer Gassenjunge in Wien von dem Drachen Veckenstedt. Um mich zu treffen, schleuderte er dem Veckenstedt den Vorwurf ins Gesicht: „Wie können Sie sich nur mit dem Juden einlassen!” Veckenstedt schrieb mir davon in heller Trostlosigkeit und Verzweiflung, da er mich bis dahin im Besitze eines christlichen Erkennungzeichens wähnte. Seine Enttäuschung war grenzenlos, er schäumte vor Wut, schwur mir ewigen Hass und setzte auch mich auf seine Proscriptionliste. So war ich denn auf die beste Manier seiner Freundschaft und seiner Belobigungen los und ledig geworden, er aber forderte den weltberühmten folkloristischen Marktberichterstatter Herrn Dr. Giuseppe Pitre in Palermo gebieterisch auf, ihm eine Abbitte und Ehrenerklärung abzugeben. Dr. Pitre gerbte ihm dafür das Fell im Archivio per lo studio delle tradizioni popolari Band IX, S. 151 f. Der Schluss dieser unbezahlbar lustigen Abfuhr lautet:
„lo ho ben altro da fare che dar retta alle sue mahnconie e prestarmi ai pettegolezzi di chi, non avendo nulla da perdero, cerca di provocare scandali, sfogando i suoi rancori ed impertinenzando il prossimo.
Pregato or sono alcuni mesi dal signor Veckenstedt, entrai con lui in relazione; provocato ora da lui (se pure egli intende il valore delle sue provocazioni ! . . . .) la rompo: e deploro, un po' tardi e vero, ma tuttavia in tempo per non
- 34 -
perdere la pazienza, di esserci incautamente entrato, senza conoscere il signor Veckenstedt come e quanto inculca un certo proverbio siciliano.
I lettori dell'Archivio sanno oramai che in questo mondaccio vi sono dei burloni e degli isterici, i quali, a secondo del loro umore o dei loro accessi nevropatici, si abbandonano ora a frenetici amplessi di amore folklorico, ora a promesse di protezioni e di grazie, ora a minacce ridicole da Sacripanti: ragazzate tutte, che si potranno bene evitare tenendosi lontani da esseri cosi molesti e pericolosi. Dr. Giuseppe Pitré.”
Nachdem wir so die nähere persönliche Bekanntschaft „Dr.” Veckenstedts gemacht, wollen wir die Einrichtung und den Betrieb seiner Götter- und Mythenfabrik in Augenschein nehmen.

„Dr”. Veckenstedt veröffentlichte im Jahre 1883 zwei starke Bände selbsterzeugter Volküberlieferungen unter dem Titel: „Die Mythen, Sagen und Legenden der Žamaiten. Gesammelt und herausgegeben von Dr. E. Veckenstedt.” Gleich nach dem Erscheinen dieses Werkes veröffentlichte ich in der „Neuen Freien Presse” darüber eine Rezension, in der ich voll ungestümer Entrüstung heissblütiger Jugend Veckenstedts Arbeit als eine schmähliche Irreführung bezeichnete. In gleicher Weise, doch weit eingehender, sprachen in Fachzeitschriften Gaidoz, Bezzenberger, Bielenstein, Wolter, Brückner und andere sich aus. Die Sache wäre wohl eingeschlafen, hätte es Dr. Veckenstedt nicht für gut befunden, seine böhmischen Korallen aus der litauischen Götterwelt neuerdings mit gewaltigem Geschrei auf den Markt zu tragen. Rücksichtlos, wie eben Marktschreier sind, griff er jedermann an, der ihn nicht als einen Wundermann anstaunte. Nun fügte es sich, dass er den um die polnische Volkkunde hochverdienten Gelehrten, den Herausgeber der ethnographischen Vierteljahrschrift Wisla, Herrn Johannes Karłowicz, grimmig anstiess. Herr Karłowicz, nicht faul, setzt sich hin und verfasst eine 24 lange Seiten umfassende Studie über: La mythologie lithuanienne
- 35 -
et M. Veckenstedt, die als Beilage zur fünften Nummer von H. Gaidoz' Melusine (Recueil de mythologie, littérature populaire, traditions et usages, tome V, 1890, Paris, 2 rue des Chantiers, E. Rolland) erschienen ist. Diese Arbeit trug Herrn Karłowicz die Beinamen „der Drachentöter” und „Vivisector” ein. Nicht mit Unrecht; denn Karłowicz geht mit der unerbittlichen Strenge eines ergrauten Staatanwaltes vor, der das erdrückende Beweismaterial für die Schuld des Angeklagten so geschickt anordnet, dass der Schuldige unter der Wucht der Anklage gebrochen zusammenknickt und der verblüffte Anwalt - ein gewiss seltener Fall - die Verteidigung zurücklegt, weil schon der Ankläger alle Milderunggründe erschöpfend behandelt.
Der Zeitmangel und deine Ungeduld, o Leser, verbieten uns, auch nur die Hauptpunkte der Anklageschrift ganz hervorzuheben. Wir müssen uns als Berichterstatter auf einige wichtige Punkte beschränken, bezüglich der näheren, wissenschaftlich gewichtigen Ausführungen aber die Anschaffung jener Nummer der Melusine (Preis 1 Fr.) anempfehlen.
„Mehr als hundert Gestalten der žamaitischen Mythologie und Sagenwelt, die bisher der Forschung ganz unbekannt waren, oder von denen man wenig mehr als den Namen wusste, sind darin der Wissenschaft erschlossen.” Mit dieser Riesiges verheissenden Redewendung bereitet Dr. Veckenstedt (a. a. 0. 1. S. ¹) die Spannung auf die kommenden Dinge vor.
Dazu sagt Karžowicz (S. 128 seiner Kritik): „Wir müssen uns diese Gestalten in der Nähe besehen, zuerst um ihren Wert und ihre Qualität abzuwägen, und dann um ihre Quantität richtig zu stellen. Es ist klar, dass wir ausser Stande sind, über alle Einzelheiten zu handeln; denn die alleinige Aufzählung aller Irrtümer und aller Betrügereien des Herrn Veckenstedt erforderte zum mindesten ebensoviel Raum, als seine „Mythen” einnehmen. Wir werden blos einige Lichtstrahlen daraus beibringen, indem wir dem Leser die Versicherung geben, dass Herr Veckenstedt überall seiner wissenschaftlichen Methode getreu bleibt, sofern in einem solchen Vorgehen eine Methode gefunden werden kann. Diese Lichtstrahlen werden dem Leser eine Idee vermitteln über die Natur dieser hundert Götter und Göttinnen, mit welchen Herr Veckenstedt den Olymp der Samogitier bevölkert hat.
- 36 -
„Um die fernere Erörterung zu verstehen, muss ich notgedrungen einige bibliographische Notizen geben und will mich so knapp als möglich fassen. Einer der ältesten Schriftsteller, die den Glauben der Litauer besprochen haben, war ein Pole namens Jan Lasicki; seine Schrift De diis Samogitarum, verfasst im Jahre 1580, gedruckt im Jahre 1615, veröffentlichte wieder mit Anmerkungen W. Mannhardt zu Riga im Jahre 1868 im XIV. Bande des Magazin der lettischliterarischen Gesellschaft. Die beste Untersuchung über Lasickis Machwerk verdanken wir dem Warschauer Universitätprofessor Mierzyński im Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Bd. XLI (1870) S. 1-102. Die, wie mir scheint, sehr fest begründete Ansicht Mierzynskis über den Wert der Lasickischen Schrift gipfelt in folgenden Zeilen (S. 78 - 79): Die Abhandlung De diis Samogitarum verdient nicht den Namen einer ernsten Quelle; ihr Inhalt entspricht nicht dem Titel: denn dieses Büchlein verrät die Tendenz, die katholische Kirche zu verhöhnen, nicht aber den samogitischen Glauben zu beschreiben. Wir haben es hier mit einer Schar literarischer Fälscher zu tun, denen es gelungen ist, die Leute während dreier Jahrhunderte zu betrügen. Mierzyński beweist des weiten und breiten und mit viel Scharfsinn, dass Lasicki als Protestant absichtlich die Zahl der litauischen Gottheiten durch Hinzufügung von Schäfern, Besenbindern u. s. w. als angeblicher samogitischer Verehrungobjekte vermehrt habe, um die katholischen Heiligen und Patrone ins Lächerliche zu ziehen, deren Beschäftigung es sei, über dem lieben Vieh zu wachen, Krankheiten zu heilen, in Verlust geratene Gegenstände wieder ausfindig zu machen u. s. w.”
Dieser Lasicki ist eine der Hauptquellen Veckenstedtischen Götterkrams. Lassen wir einmal den Fabrikanten Veckenstedt selber zu Wort kommen. Im ersten Band S. 119 ff. erzählt er z. B. folgende Göttergeschichte:
„Sunas Karaliaus Žamaiczun (Der Sohn des Königs der Žamaiten).
„Als der König der Žamaiten in den Himmel zurückgekehrt war, entstand, da er niemand als seinen Nachfolger bezeichnet hatte, ein Streit um den Thron. Derselbe wurde auf folgende Weise erledigt: An einem Sonntage geschah es, als die Dorfmädchen auf einer Wiese spielten, dass ein geflügelter Wolf herbeikam, welcher ein Mädchen erfasste und mit
- 37 -
demselben davonflog. Er trug das Mädchen auf den höchsten Baum und barg es dort auf dem Wipfel. Der geflügelte Wolf brachte dem Mädchen täglich die schönsten Vögel, mit welchen dasselbe spielte. Als die Bauern das sahen, beschlossen sie den Baum zu fällen. Sie schritten zur Ausführung ihres Vorhabens. Aber bevor der Baum gefallen war, sahen die Bauern, wie sich der Wolf in den verschwundenen König verwandelte und als solcher zum Himmel emporstieg. Da konnte man mit feurigen Buchstaben am Himmel die Worte lesen: „Diese ist die Mutter eures künftigen Königs!” Da ward den Bauern klar, was vorgegangen war; sie holten das Mädchen vom Baume herunter. Dasselbe gebar nach einiger Zeit einen Sohn. Bei der Geburt war der Himmel roth wie Feuer, die Engel sangen geistliche Lieder und begossen das Haus, in welchem der künftige König geboren ward, mit Öl.”
Oder, eine noch schönere Korallenreihe als weiteres Beispiel (I, S. 87):
„Der König führte die aus dem Berg erwachten Krieger zuerst gegen die Žamaiten, welche gegen ihn zu Felde gezogen waren. Als diese besiegt waren und sich unterworfen hatten, beschloss er, diejenigen Feinde der Žamaiten zu bekriegen, welche vom Engel Michael gegen sie aufgereizt waren. Dungis entsandte deshalb Algis zum Himmel und liess die versammelten Engel um Erlaubnis für diesen Heereszug bitten. Einige von den Engeln, Michael und Szwestiks nämlich, wollten die Erlaubnis versagen, Perkunas, Auksztxs und Žamaite aber wünschten, dass die Erlaubnis gegeben werde. Da keiner von den Engeln von seiner Ansicht abgehen wollte, so bestimmte Gott, dass die Engel erst in der Entscheidung einig sein sollten, bevor man dieselbe Dungis mitteile. Die Engel gerieten in einen heftigen Streit, der schliesslich in einen Kampf ausartete. Bald nahmen die Engel und Engelinnen an dem Kampfe teil. Auf der Seite von Auksztis, Perkunas und Žamaite stand Perkuna, die Mutter des Perkunas, Žemina, die Mutter der Berstukai, Beslea, Laima, Ugniedokas und Ugniegawas, Bangputis, Potrimpus, Perdoytus, Lituwanis, Uzweikinas, Algis und andere Engel und Engelinnen; zu Michael und Szwestiks hielten Gabriel, RaphaeL Giltine, Pikolis, Pest, Cholera, Tikhs, Audris, Autrimpus, Breckszta, Auszra, Swaigzdes, Mienu und andere Engel und Engelinnen. Lange wurde mit furchtbarer Heftigkeit gestritten, endlich aber erlangten Auksztis, Perkunas und Žamaite mit ihren Mitstreitern die
- 38 -
Oberhand, und Gott sandte die Engel Derpintus und Lygiscus aus, den Streit der Kämpfenden zu schlichten und dieselben zu versöhnen. Darauf überbrachte Algis an Dungis die Erlaubnis, dass dieser gegen die Feinde der Žamaiten zu Felde ziehen dürfe.”
Nun mag wieder Karłowicz das Wort ergreifen, der in der litauischen Volkkunde und Literatur als Fachmann gut bewandert ist. Er sagt:
„In den obigen Zitaten wird unser folkloristisches Gefühl Schritt für Schritt gröblichst verletzt. „Der König von Samogitien” (Žamaite) kehrt in den Himmel zurück. Es entsteht ein Streit um die Thronfolge. Kommt just ein geflügelter Wolf daher, bemächtigt sich des Mädchens, versteckt es auf einem Baumwipfel und bringt ihm Vögel als Spielzeug hin. Der Wolf verwandelt sich in den König und fliegt in den Himmel hinauf. Am Himmel erblickt man eine feurige Inschrift (in welcher Sprache? in der litauischen?): „Das ist die Mutter eures zukünftigen Königs!” u. s. w. Das zweite Exempel ist nicht minder seltsam. Vor unseren Augen entrollt sich ein Tagbefehl in der Art, dass ein kommandirender General die Stabmajore und die Offiziere ernennt; er ruft uns ins Gedächtnis die Gewissenhaftigkeit der Aufzählungen im Mahabharata, des Schiffkatalogs der Iliade oder einer Nummer des Reichanzeigers aus der Zeit des deutsch-französischen Krieges. Wir sind erstaunt, hier einen Feldmarschall, will sagen den obersten Gott der Litauer, Perkunas, in der bescheidenen Stellung eines der drei Konsulen zu sehen, und mit unverhohlenem Vergnügen machen wir die Bekanntschaft seiner gnädigen Frau Muttter, der Dame Perkuna, über die wir bis anno 1883 nicht das Leiseste zu hören bekommen hatten. Im Übrigen erneuern wir alte Bekanntschaften: es treten die Individuen auf, die uns schon der würdige Lasicki anempfohlen: Algis (dieser Algis steckt wirklich seine Nase in alles hinein); Perdoytus, ein Gott der Winde (des Mastdarmes, wohl verstanden; man entschuldige dieses Detail, doch es ist nicht unsere Schuld); da kommen die Damen unserer Bekanntschaft: Madame Beslea, Madame Laima, und dann in einer besonderen Anhäufung die Mondgöttin (Mienu), die Cholera (im Litauischen ist sie weiblich, wahrscheinlich ist sie eine Nichte des gedachten Perdoytus); die neuen Gestalten des Ugniedokas und Ugniegawas, die Vetteln Brekszta und Auszra, ein gewisser Szwaigzdes, ein Gott, dessen
- 39 -
Name im Reisepass verschrieben steht und eine Rotte anderer Gottheiten; darunter, sapristi, auch St. Michael der Christ, in Gesellschaft anderer Engel vom schöneren Geschlecht. Es scheint, dass während der Abwesenheit des Donnerers Perkunas, den wir soeben im himmlischen Landsturm begegnet, irgend ein deus ignotus sich im litauischen Olymp bequem häuslich eingerichtet hat; er nennt sich ganz einfach Gott, und nachdem er den Kriegern beiderseits einen langwierigen und heftigen Kampf vergönnt, schickt er endlich seine Feldadjutanten Derpintus und Ligiskus (die hat uns zum erstenmal Lasicki vorgestellt), damit sie der Katzbalgerei ein Ende machen, obwohl inzwischen die eine Bande über die andere obgesiegt hatte. Der rührige Algis weiss sich aber noch einmal eine kleine offizielle Mission zu verschaffen und leistet sich einen Ausflug zu Dungis (einem himmlischen Wesen mit der Schutzmarke seines Fabrikanten Veckenstedt) wahrscheinlich auf Regimentunkosten.”
Karłowicz zählt eine Menge Werke über Litauisches auf, die Veckenstedt nicht kennt (welche kennt er denn ja, da er weder litauisch noch slavisch versteht?) und geht dann zur Besprechung der einzelnen Götter über: „Algis erscheint am häufigsten unter allen Gottheiten im Veckenstedtischen Buche. Er ist eine Art himmlischen Faktotums. (Die zahlreichen Stellen, an welchen Algis auftritt, macht Karłowicz namhaft.) Die Genesis des Algis ist uns wohl bekannt. Lasicki nannte ihn in seinem Abriss unter Hinzufügung der spärlichen Worte: angelus est summorum deorum. Keine einzige anderweitige Quelle kennt einen Algis mehr; das litauische Volk selber hat von ihm keine blasse Ahnung. Das litauische Wort algà, das lautlich an Algis anklingt, bedeutet nichts anderes als Entlohnung.¹) Warum erscheint nun bei Veckenstedt Algis bei jeder Gelegenheit als ein angelus ex machina? Kann man annehmen, dass die Leute, die dem Veckenstedt die Überlieferungen zuschanzten (er selber sammelte gar keine, da er der Landsprache unkundig war), untereinander förmlich ein Komplott geschmiedet, um in eine Anzahl in verschiedenen Gegenden aufgelesener Überlieferungen eine
- 40 -
mythische Persönlichkeit einzuführen, von welcher das Volk nicht die geringste Kenntnis besitzt? Ich will es gern einräumen, dass man Veckenstedt von vorn und von hinten prellte, aber es ist schwer glaublich, dass sich mehrere Personen verschworen hätten, den Lehrer für Deutsch zu mystifiziren. Wie lässt sich also die ständige Erscheinung des Algis in Veckenstedts Legenden erklären? Es gibt keine andere Auskunft als die Annahme, Veckenstedt habe überall den Namen Algis eingesetzt, wo es ihm scheinen mochte, dass dieser „angelus deoruni” am Platze oder notwendig sei. Wir überraschen also hier Herrn Veckenstedt bei einer handgreiflichen Betrügerei. Er entnahm ein vorgeblich mythisches Wesen dem Büchlein Lasickis und schmückte damit willkürlich einige Dutzend sogenannter žamaitischer Legenden aus. Aber dabei beruhigte er sich nicht; er fabrizirte noch ein weibliches Wesen des Namens Algis ¹) dazu und setzte eine gewisse Dame Algiene in Umlauf, nachdem er sie vorher dem Windgotte Bangputis ehelich angetraut und den Bund mit einer zahlreichen Nachkommenschaft gesegnet. Doch auch hier liess sich Veckenstedt noch einen Extraplutzer zu Schulden kommen; indem er Algis als ein Masculinum annahm, versah er das Wort mit der Endung -éné, die nur zur Bezeichnung von Ehefrauen dient, Algiene bedeutet also: die Frau des Algis! Stillschweigend muss man daher wohl voraussetzen, die gute Frau sei erst durch eine zweite Ehe eine Madame Bangputis geworden.
„Eines der stärkeren Beispiele Veckenstedtischer Ignoranz und Verwegenheit ist die Einführung eines gewissen Goniglis (II, 158) in den litauischen Olymp; er zähmt Werwölfe, lässt das Gras wachsen, beschützt das Wild u. s. w. (I, 174 - 175); kurzum, das ist eine „Gottheit” von ausgesprochenem Charakter und von einer offen unbezweifelbaren Existenz. In der Tat ist sie aber weiter nichts als eine Mystifikation, zu deren traurigem Opfer Veckenstedt wurde. Stryjkowski, der polnische Chronist aus dem 16. Jahrhundert
- 41 -
hat ihrer zuerst gedacht, indem er sie goniglis dewos nannte (er wollte sagen ganyklós dévas = der Gott der Viehweiden; ganyklós ist der Genetiv von ganiklá = Viehweide); Veckenstedt hielt die Viehweide für eine Gottheit und versorgte sie mit einigen Histörchen.
„Kommen wir noch einmal auf eine gewisse „Gottheit” Veckenstedts zurück, die wir schon vom himmlischen Gemetzel her kennen, auf den armen Perdoytus. Das wäre in Wirklichkeit ein „Gott der Winde”, doch in einer etwas verschiedenen abweichenden Bedeutung, die man leicht errät, wenn man das litauische Zeitwort péržiu mit dem griechischen πέϱδω zusammenstellt und sich der polnischen Definition Naruszewiczs erinnert: „deus crepitus Perdun ...” Veckenstedt weiss uns einige Geschichten von dieser übelduftenden Gottheit zu erzählen (I, 140, 153, 167-169). Es scheint uns, dass in seinem ganzen Geplausche nur eine einzige wahre physiologische Bemerkung vorkommt, nämlich die: „die Winde streben stets danach, sich aus dem Sack zu befreien”, das Übrige ist lauter Erzeugnis aus Veckenstedts und Komp. Mythenfabrik” (oder Fabrik böhmischer Korallen aus der Götterwelt).
Nach Karłowiczs genauen Forschungen hat Veckenstedt keineswegs mehr als 100, sondern blos 82 mythische Gestalten beschrieben; davon waren 40 aus des Spassmachers Lasicki Werkchen bekannt, die übrigen 42 aber wirklich „unbekannt”. Veckenstedt hat auch eine Reihe von Schülern gezüchtet, die ihn jahraus, jahrein mit den allerkostbarsten Korallen aus der litauischen Götterwelt versorgen. So ist es unter anderem einem seiner Mitarbeiter geglückt, das Urepos der litauischen Götterwelt zu entdecken. Das sind gar viele Tausende von Versen. Was tut Veckenstedt in einem Anfall ausserordentlicher Edelmütigkeit zu Gunsten der Wissenschaft? Er trägt seinen Schatz der Berliner Akademie der Wissenschaften zur Veröffentlichung an! Nun
sitzen dort in der Akademie lauter eingefleischte Skeptiker beisammen, lauter cunctatores maximi, die schon zu alt und schwerfällig sind, um die Grösse von Veckenstedts Opfer zu begreifen. Und so ist das Unglaubliche geschehen, die Akademie lehnte, höflich zwar, jedoch entschieden, den Antrag Veckenstedts ab. Hätte sie es lieber nicht getan, so hätte ich noch weiter reichlichen Stoff für mehrere anziehende
- 42 -
Ausführungen zu diesem Berichte und die französischen und russischen Gelehrten hätten auch was zu schreiben gehabt.
Peter Schlemihl bemerkt am Schlusse seiner wundersamen Geschichte: „Ich werde Sorge tragen, dass vor meinem Tode meine Manuskripte bei der Berliner Universität niedergelegt werden.” Es wäre zu wünschen, dass Veckenstedt trotz der entmutigenden Ablehnung, die er von der Akademie erfahren, das Beispiel Schlemihls befolgen würde. Auch Liguori hat seine Werke bei Universitätbibliotheken zu bergen gewusst, und dieser weisen Vorsicht haben es seine Manen zu danken, dass in erhöhterem Masse als es sonst der Fall gewesen wäre, die Aufmerksamkeit später Gelehrtengeschlechter den „Werken” sich zuwandte. So wird jedem die verdiente Anerkennung, wenn auch spät, aber doch zu teil.
Damit dich, freundlicher Leser, traurige Stimmung nicht zu sehr wegen dieses Verlustes übermanne, mache ich dich aufmerksam, dass der Londoner Advocat E. Sidney Hartland, einer der renommirtesten Besucher der Folklore-Börse, deren Rechtanwalt er ist, im „Folk-Lore. A quarterly Beview of myth, tradition, Institution and custom”, (London 189¹) S. 100 - 107, die Leistungen Veckenstedtischer Industrie mit plastischer Anschaulichkeit einem verehrlichen, internationalen Publikum vorführt. Jedes patriotische Herz muss im Dreivierteltakt froh aufpochen, wenn das Auge sieht, wie prächtig unsere heimatländischen Produkte aus Veckenstedts böhmisch-litauischer Korallenfabrik selbst im nebligen London gewürdigt werden. Kein Wunder, dass Veckenstedt dadurch in seiner Betriebsamkeit angeeifert und bestärkt, sogar eine Actiengesellschaft für den Betrieb seiner böhmischen Korallen ins Leben rief. Sicherem Vernehmen nach ist Veckenstedt bisher nicht nur Präsident - wozu er sich selber ernannt hat - sondern auch der einzige Verwaltungrat, Schriftführer und alleiniger Aktienbesitzer. Von Zeit zu Zeit ernennt er Folkloristen in Spanien, Portugal und Amerika zu correspondirenden und Ehrenmitgliedern. Professor Weinhold erinnert auf der 2. Umschlagseite eines jeden Heftes der Zeitschrift des Vereins für Volkkunde in Berlin, dass dieser Verein nichts gemein habe mit der Aktiengesellschaft für Volkkunde des Dr. E. Veckenstedt in Halle a. S. Nun, wer auch nur flüchtig einen Blick in Weinholds Zeitschrift wirft, kann unmöglich auf den Gedanken verfallen, dass irgend welche Gemeinschaft mit Veckenstedt da vorhanden sei. „Mit
- 43 -
solchen Gesellen wie Veckenstedt haben die ehrlichen Kämpen unserer Wissenschaft nichts gemein. Jede weitere Anzapfung dieses Pseudo- und Aftergelehrten, der sich erwiesenermassen teure Fachschriften nur gratis zuschicken lässt, um sie nach flüchtiger, gehaltloser Anzeige an den Büchertrödler zu verkaufen, verschmähe ich, obwohl das Belastungmaterial geradezu erdrückend wäre”, so äusserte sich Dr. Ludwig Fränkel in seinem „Beitrag zur Biographie Edmund Veckenstedts”, (Beilage zum 5. Hft. des III. B. der Monatschrift für Volkkunde „Am Urquell” 189²). Steht auch schon auf der Proscriptionliste Veckenstedts.

Hochwohlgeborener Leser, Mensch und Staatbürger! Du würdest sehr irren in der Annahme, dass alle, oder auch nur die meisten Götter- und Mythenerzeuger nach dem zuvor besprochenen Exempel zu bemessen seien. Die momentane Stagnation im Mythenverkehre darf dich auch nicht mutlos machen, so jammervoll ist die Lage nicht. Götterfabriken sind schon sogar von Männern gegründet worden die in den weitesten Kreisen der Feuilleton lesenden und Bücher ausborgenden Menschheit bekannt sind. Ja, selbst ein Prophet, ein öffentlich protokollirter Prophet, zählt zu dieser Zunft. Der Mann reist in Vulkanausbrüchen und Erdbeben, und macht damit keine ganz schlechten Geschäfte. Du errätst, dass nur
gemeint sein kann und rümpfst die Nase, unter die man dir so oft deine Ungläubigkeit gerieben. Ich denke nicht so gering vom Prophetentum wie der alte Brahmane Rückert, der in der 58 Sure des III. Abschnittes des XVI. Buches seiner Weisheit sich etwas anzügüch auszudrücken beliebt:
Falb ist ein wahrhaftiger Prophet, und ich hoffe, dich bald davon fest zu überzeugen. Traurig ist es nur, dass in unserer materialistischen Zeit, eine mit bedeutenden Kosten in Betrieb gesetzte Götterfabrik eines Propheten eingehen musste.
- 44 -
Was stutzest du? Offenbar ist es dir, ebenso wie Millionen anderen Ohnegöttersorgern, völlig unbekannt geblieben, dass Falb auch diese Art böhmischer Korallen erzeugte und auf Lager hatte! Ein Bösewicht, der deine Neugierde auf die Folter spannt. Ich bin keiner und werde dir auch keine Qualen verursachen.
Vor allem muss ich dir zur Kenntnis bringen, dass Falb ein Mann von guter Erziehung und tadellosem gesellschaftlichen Anstand ist, dem man die Absicht zu täuschen und zu hintergehen, nicht zutrauen darf. Er spricht wie Inspirirte schon sprechen, ohne Methode, ohne Zusammenhang, in dunklen, geistsprühenden, erregten, wollüstigen Träumen.
Es ist ein verschwenderisch schön ausgestattetes Buch von 491 Seiten in Grossoktav: „Das Land der Inca in seiner Bedeutung für die Urgeschichte der Sprache und Schrift”, das Falb im Jahre 1883 bei J. J. Weber in Leipzig verlegte. Und das ist erst nur als eine „Vorstudie” zu dem 2000 Folioseiten umfassenden Manuskript Falbs (S. VI), das, leider Gevatter, ungedruckt bleiben muss, weil die Götter der Vorstudie keinen Absatz fanden. Kein Absatz, kein Absatz, aber gar kein Absatz bis auf die 100 verschenkten Rezensionexemplare, das ist gallbitter. Und in das Geschäft hat J. J. Weber über 10.000 RM. hineingesteckt! Weinen könnte man!
Im Jahre 1877 machte sich Falb auf eine südamerikanische Erdbebenreise auf. Die Götter waren nicht ins Reiseprogramm mit eingeschlossen und darum hatte Falb „auch keine Vorstudien über südamerikanische Sprachen gemacht” (S. V). Da er aber in seiner „Jugend vom 11. bis zum 20. Lebensjahre sich den klassischen Idiomen, vorzugweise den semitischen Dialekten gewidmet hatte, so konnte er hier von alten Reminiscenzen zehren” (S. VI). Daran hat er sehr klug getan. Auch die gutgenährten, feisten Menschen haben vor uns mageren das eine voraus, dass sie zu Zeiten, wenn sie sich den Magen verderben und er keine Nahrung verträgt, von dem früher sorgsam angehäuften Leibspeck und Leberfett zehren können, während unsereiner in solchem Falle Trübsal blasen und die Drehungen des Wetterhahnes fleissig zählen darf.
Falb versah seine Fabrikate mit einer symbolischen, bedeutsamen Schutzmarke, die in ein viertel natürlicher
- 45 -
Haar- und Schaltenstrichgrösse durchpausirt schlicht und einleuchtend
sich so darstellt:
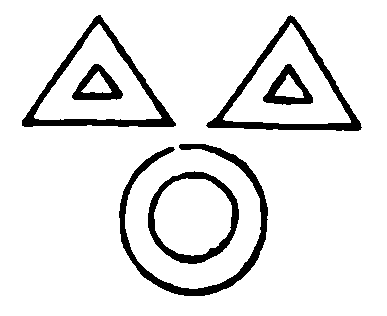
Die zwei Dreiecke sind das Sinnbild „der beiden Zizen. aus welchen das nährende Nass hervorquillt”, der Kreis der „Urmarke” bezeichnet jedoch „den Erguss des Gefässes” d. h. die Öffnung tief „unter dem Bilde des weiblichen Busens”, der „Fülle der Zizen”, aus der ein minder köstlich Nass hervorschiesst. Die Hauptsache ist ja, dass überhaupt etwas herauskommt. Die Details dieser geheimnisvollen Naturerscheinung hat Falb endlich einmal, wie kein anderer Mythenfabrikant, erforscht und in seinem Werke in Wort und Bild dargestellt.
Das Besondere der Falbischen Fabriktechnik besteht darin (S. 35): „aus der Schlingpflanzen-Umarmung den alten Stamm herauszulösen, den Hammer aus der Klammer zu befreien.” Schauen wir uns nun unter seiner Führung die Prozedur der Entstammumarmungen und Enthammerklammerungen an. Schlagen wir aufs Geratewohl das Buch auf - denn wo mans packt, da ist es interessant - und lassen wir uns schweigend in die Mysterien einweihen.
S. 59: „Wie die Milch der schwellenden Mutterbrust und süsser Kvasir der Kelterpresse, so entströmt der Gewitterregen der schwangeren Wolke. Aber diese Naturerscheinung ist nur das schwache Bild eines viel älteren und gewaltigeren Phänomens, das - tief ins Gedächtnis der Menschheit gegraben - erst durch das „Lecken der Kuh am Eis-Block” wieder zum Bewusstsein unserer Generation gelangen wird - jenes Schwellens der schwarzen Mutter Erde, wobei sich in langer Kette Zize an Zize reiht, aus deren Innern sich dann die „Gold-Milch” das gori der Indianer des peruanischen Hochlandes, die leuchtende Lava, Horus, die goldene Webe - ergiesst.”
S. 63: „Schwellung und Grösse, über und tuber, cumulus und tumulus, alle geheimen Kräfte der Natur, die von Innen nach Aussen streben, finden im Aufblühen der Jungfrau zur Mutter ein passendes Sinnbild. Doch in gesteigerter Potenz sind darunter jene unheimlichen Tiefenkräfte verstanden, die durch Erdbeben und vulkanische Verwüstung zum Ausdruck kommen, es sind jene mysteriösen
- 46 -
„Mütter” in den Tiefen, von denen Goethe im „Faust” vielleicht mehr divinatorisch als mit klarem Bewusstsein des Symbols, wie im heiligen Schauer berichtet, und welche keiner seiner Kommentatoren richtig gedeutet.”
S. 75 flf.: „Die Zweiheit klammert sich an ... paarweise auftretende Körperteile, wie vorzugsweise der Augen und weiblichen Brüste_.”
„Paar um Paar” - „Reihe an Reihe” - „Zahn an Zahn” („Zizen-zahn”-Formel) - das sind die fundamentalen Begriffelemente, die den Wurzelstock für die ursprünglichen Ideen der Menschheit und deren schriftlichen und sprachlichen Ausdruck bilden. Hier muss die vergleichende Sprachforschung einsetzen, wenn sie wieder einen grossen Schritt vorwärts machen soll. Dieses „Zahn an Zahn” kann aber keinen anderen Ur-sprung haben als die Zize!”
S. 79.: „Die beiden Gefässe, in welche nach der Kvasir-Sage, die köstliche Flüssigkeit gegossen wurde, und der Kessel, bedeuten die zwei Brüste und die zwischen ihnen liegende Konkavität; wobei eine tiefer gehende Deutung nicht ausgeschlossen ist.”
Ferner: „Die Fülle der Zizen, welche als vielbrüstige Diana ihre magische Anziehungkraft auf den ganzen cultivirten Westen ausübte - an deren Stelle die christliche Mirjam trat - mit Offenbarung des ältesten, stets geheim gehaltenen Namens, der eine Fülle von wissenschaftlichen Aufschlüssen birgt, muss geradezu als der Schlüssel zur Urgeschichte der menschlichen Sprache und Schrift bezeichnet
werden.”
Wahr ists und kein Gedicht nicht. Wer den in Verlust geratenen Schlüssel zu den Aufschlüssen redlich findet und Herrn Falb überbringt, kriegt ein Paar Manchettenknöpfe aus Aluminium zum Präsent.
Die sehr einleuchtende Darlegung auf S. 113, wonach im „Mutterschoos” (uterus, mulier = mola!) der „Blitzende” steckt”, lies dir selber nach, guter Leser.
S. 129. „Wir citiren hier nur vorläufig als Parallele unsere Etymologie von Wotan, das wir mit dem bekannten hebräischen Adon(ai) als wurzelhaft identisch betrachten, und dessen Verständnis durch das Chaldäische und Arabische erschlossen wird, wobei sofort der „Feuerofen”, d. i. der vulkanische Berg, zu Tage tritt. Der „wütende Wotan” ist
- 47 -
sonach, nichts anderes als der tobende Feuerberg, der Urgott der Hebräer”.
S. 183. „Wir finden den Hahn auf dem Kreuze der Kirchtürme, weil diese eben ursprünglich den Vulkan und seinen Ausbruch bedeuten sollten.”
S. 207. [Durch das Wort Lava] „wird die uralte Bedeutung des „Königs-Hasen” - wie das Kaninchen in Süd-Deutschland genannt wird - in das hellste Licht gesetzt. Die Krone welche dasselbe in der Symbolik des alten Mexiko auf dem Kopfe trägt, ist die Zickzacklinie, ist das heilige Tau, das grosse Urgesetz, die Periode, d. i. die regelmässige Wiederkehr, ausgedrückt durch eine Zahn- oder Säulenreihe = [Δ Δ]![]() , die zwei Hörner der priesterlichen Tiara, die alte Mitra. Es ist aber damit die Periode vulkanischer Erdrevolutionen verstanden, symbolisirt durch die Menstruation ... Es ist dies die alte Erinnerung der Menschheit an die grosse Krankheit ¹)
der Mutter Erde" ...
, die zwei Hörner der priesterlichen Tiara, die alte Mitra. Es ist aber damit die Periode vulkanischer Erdrevolutionen verstanden, symbolisirt durch die Menstruation ... Es ist dies die alte Erinnerung der Menschheit an die grosse Krankheit ¹)
der Mutter Erde" ...
S. 251 : „Die „Götter” der Alten sind ursprünglich nichts anderes, als die ersten Feuermacher: civis = zeus, d. i. der Donnerer, der Tor-Hammer, das Kreuz: „teu-tl” ![]() das aztekische Zeichen für Gott. Das lateinische „civis” bedeutete ursprünglich wohl nichts anderes als ein Mitglied jener glücklichen Genossenschaft, welche das Feuer erzeugte, oder an dem Feuer, sofern dessen Erzeugung von den Priestern geheim gehalten wurde, wenigstens Anteil hatte.”
das aztekische Zeichen für Gott. Das lateinische „civis” bedeutete ursprünglich wohl nichts anderes als ein Mitglied jener glücklichen Genossenschaft, welche das Feuer erzeugte, oder an dem Feuer, sofern dessen Erzeugung von den Priestern geheim gehalten wurde, wenigstens Anteil hatte.”
Civis bedeutet also sowohl einen Gott, d. h. einen Köchinstellvertretenden Feuermacher, als auch einen Feueranteilscheinebesitzenden römischen Rentier. In die Geheimnisse der Sprachentstehung ist Falb besonders tief eingedrungen; das beweist nicht allein „civis”, sondern auch das wunderschöne grosse Kapitel über den „Ausgang der Sprache”. So heisst es z. B. auf S. 305: „Erst mit dem Eintreten der Articulation kann von einer Sprache die Rede sein. Die Articulation aber lässt sich bei der menschlichen Sprache überhaupt auf die drei Laute:
hua ra dsa
zurückführen, die wir daher als die Urlaute der menschlichen Sprache betrachten.”
- 48 -
„Weiter zurück gelangen wir in die vorsprachliche Periode. Es zeigt sich deutlich, dass hua und ra zuvor vereint waren, und zwar nicht blos im Spiritus asper, den man im Griechischen über das Rho setzte, und dessen Form im Sanskrit geradezu das defective Rho ersetzte, sondern auch im semitischen Buchstaben Ain, der ein tief in der Kehle geräuspertes r ist.”
„Aber auch der dsa-Laut war mit dem r vorsprachlich vereint, wie dies aus dem czechischen und sizilianischen ř hervorgeht.”
„So gelangen wir zu den zwei ältesten Lauten: hr (rh) und rds, welche offenbar nichts anderes sind, als die Functionen des Räusperns und Spuckens.”
„Sprechen heisst spucken.”
Da hat er wirklich recht. Ich habe das selber schon öfters unangenehm vermerkt, dass manche Menschen beim Reden mehr speiben als sprechen, namentlich sind mir jene unausstehlich, die mir gleichzeitig den Rockknopf abdrehen. Dann habe ich noch die Ehre, mir einen neuen Knopf zu kaufen und ihn mir selber anzunähen oder ich muss mir von der Nachbarin die Gnade des Knopfannähens erflehen.
S. 309: „![]() signalisirt die geschlechtlichen Attribute der Frau. Die Meereswoge: zwei Giebel und die dazwischen liegende Vertiefung
signalisirt die geschlechtlichen Attribute der Frau. Die Meereswoge: zwei Giebel und die dazwischen liegende Vertiefung ![]() erklärt uns das linguistische Rätsel der Meer-Frau, die Gleichung: „Mädchen” = „Meer”, welches auch in vulva = valva liegt, gleichzeitig auch mit der dreieckigen Form der Thore in Ägypten Da nun Λ zwei Schenkel bezeichnet, so ist es klar, dass
erklärt uns das linguistische Rätsel der Meer-Frau, die Gleichung: „Mädchen” = „Meer”, welches auch in vulva = valva liegt, gleichzeitig auch mit der dreieckigen Form der Thore in Ägypten Da nun Λ zwei Schenkel bezeichnet, so ist es klar, dass ![]() , „4 Schenkel”, „4 Füsse” (das Shakespearische „Tier mit doppeltem Rücken”) besagt” ...
, „4 Schenkel”, „4 Füsse” (das Shakespearische „Tier mit doppeltem Rücken”) besagt” ...
Das lässt sich hören, jedoch bin ich mit Falbs Erklärung der Seele durchaus nicht einverstanden. Auf S. 325 sagt er: „Das deutsche „Seele” ist wurzelidentisch mit „Säule” = ![]() und das letzterem entsprechende griechische „Stele” mit dem lateinischen „stella” „Stern”, dem aus der Tiefe aufsteigenden fer-vor”. Da gefällt mir viel besser die Ansicht des Dramendichters Dionys von Syrakus, der durch das Damoklesschwert und den Dolch im Gewande des Moeris berühmter als durch seine Verse geworden, wenn er meint: Korai gar eisi stelantes, d. h. die Mädchen sind die Säulenden, wie bei Meinecke zu lesen steht. Ein fürwitziger Höfling fragte devotest, was denn „die Säulenden” bedeuten soll, und der
- 49 -
Tyrann eröffnete ihm, wie folgt, den Sinn: „Die Mädchen stehen und warten, wie Säulen bis ein Mann kommt.” Das leuchtet gleich ein.
und das letzterem entsprechende griechische „Stele” mit dem lateinischen „stella” „Stern”, dem aus der Tiefe aufsteigenden fer-vor”. Da gefällt mir viel besser die Ansicht des Dramendichters Dionys von Syrakus, der durch das Damoklesschwert und den Dolch im Gewande des Moeris berühmter als durch seine Verse geworden, wenn er meint: Korai gar eisi stelantes, d. h. die Mädchen sind die Säulenden, wie bei Meinecke zu lesen steht. Ein fürwitziger Höfling fragte devotest, was denn „die Säulenden” bedeuten soll, und der
- 49 -
Tyrann eröffnete ihm, wie folgt, den Sinn: „Die Mädchen stehen und warten, wie Säulen bis ein Mann kommt.” Das leuchtet gleich ein.
Wenn du nun, hochzuverehrender Leser, meinst, ich speise dich nur mit einzelnen Cibeben aus Palbs böhmischem Weihnachtbrod ab und behalte mir das nahrhafte Weissbrod zurück, so wirfst du auf mich einen abscheulichen Verdacht. Falbs ganzes Buch, das heisst der ganze Kuchen, besteht aus lauter grossen Cibeben, oder, was red' ich für unsinniges Zeug, ich bin doch Marktberichterstatter, das Buch besteht aus lauter böhmischen Korallen grösster Façon, die man nicht so mir nichts dir nichts auseinanderreissen und den Kindern zum Spielen geben kann. Kinder führen gleich alles zum Munde, und wie leicht bleibt einem - beinahe hätte ich gesagt dir - Baby ein so riesiger Trummen im Halse stecken!
Jetzt will ich dir auch mitteilen, warum ich an Falbs echter prophetischer Begabung nimmer zweifle. In der Einleitung (S. XIII f.) bemerkt Falb: „Der gewissenhafte Fachmann wird sich von der Haltbarkeit des hier angeführten Gerüstes, aber auch durch seine eigenen Ergänzungen überzeugt sehen Dadurch eben unterscheidet sich die gewissenhafte Forschung von der Afterkritik, der es nur um die Verkleinerung und Verdächtigung des Concurrenten zu tun ist, wozu es bei der Unvollkommenheit jedes menschlichen Werkes an Anhaltpunkten nie mangelt.”
Richtig hat die „Afterkritik”, ganz so wie er es vorausgesagt, in Verkleinerung und Verdächtigung diesmal so gründlich sich hervorgetan, dass Falb seinen Fabrikbetrieb gänzlich einstellen musste. Ich selber vermag mich, leider, nicht von aller Mitschuld freizusprechen; denn kaum war das Buch erschienen, so fiel ich mit einer Berserkerwut darüber her und verarbeitete Falb in den Mitteilungen der Wiener Anthropologischen Gesellschaft (1883). Zu meiner Entlastung kann ich nur meine Jugend und meinen Unverstand anführen; jetzt aber, wo ich gereifter bin, behaupte ich zwar auch nicht, dass ich die Darlegungen Falbs verstehe, aber ich weiss ihn besser zu schätzen und zu würdigen, und sein Werk nimmt einen Ehrenplatz in meiner Bibliothek ein.
Am wenigsten gebührt der Name eines „gewissenhaften Fachmannes” dem Grazer Universitätprofessor Dr. Gustav Meyer, der- sich wie ein wilder Tiger auf sein Magenopfer,
- 50 -
auf Falbs Buch stürzte. Er nannte es in seiner „Afterkritik” ¹) „eine Schande für die deutsche Wissenschaft” und noch anderes mehr, was ich schon vergessen habe, anstatt dass er das aufgeführte Gerüst durch eigene Ergänzungen wie mit eisernen Zwickeln befestigt hätte. Auch den Namen eines „Concurrenten” Falbs darf man ihm füglich nicht beilegen; denn soweit ich seine wissenschaftlichen Arbeiten kenne (und ich kenne wohl so ziemlich alle), so gebe ich offen und unzweideutig meiner Überzeugung Ausdruck, dass Prof. Meyer ganz und gar nicht die geistige Veranlagung besitzt, auch nur ein einziges so tiefsinniges Kapitel, wie eines im Falbischen Werke steht, auszuklügeln. Trotzdem hat er sich nicht etwa begnügt, unseren Korallenfabrikanten zu verkleinern und zu verdächtigen, nein, er zermalmte und zertrümmerte ihn gleich! Auf der einen Seite er, auf der andern sein College Prof. Dr. Rudolf Hoernes, der Falbs prophetische Erdbebenangaben als eitlen Humbug bezeichnete. Diese Herren scheinen nicht zu wissen, was schon der Philosoph Seneca, oder wars ein anderer, als Grundsatz jeder ernsten „gewissenhaften Forschung” aufgestellt (und was ich mir zur Lebensmaxime erwählt habe):
CREDO QUIA ABS-UR-DUM!
zu deutsch: wer den Propheten will versteh'n, muss in Prophetenlande geh'n.

Alter schützt vor böhmischer Korallenfabrikation nicht. Ein ehrwürdiger Alter, ein Priester des Herrn und Universitätprofessor, der in den Jahren seiner Jugend und Vollkraft die Wissenschaft der Volkkunde vielfach gefördert, begann nach Eintritt ins siebzigste Lebensjahr Korallen zu fabrizieren. Ewig denkwürdig ist seine „viertausendjährige Melodie von der Gredl in der Butten”, und noch schätzbarer sind seine Götter, die er meistenteils aus den weiblichen Genitalien und dem Priapus ableitet. Seinen Korallen aus der Götterwelt haftet ein eigener Geruch an, und eben darum mag ich weder den Fabrikanten (im Kreise der Wissenden führt
- 51 -
er den Ehrennamen: „der umgestürzte Bücherkasten”) noch dessen Werke nennen. Sie freuen mich eben nicht, und auch meine Sehnsucht nach dem grossen Kirchenbann ist äusserst massig. Unser Alter hat zum Überfluss die Vorliebe, Glaubensachen der christlichen Kirche mit seinen böhmischen Korallen in Zusammenhang zu setzen. Würde ich mich nur unterfangen, auserlesene Proben daraus mitzuteilen, so hiesse es in allen Tonarten: „Jud, dich wer' mer karnifeln! Jud, du musst Feigen fressen!” Shoking! „Kommt er nicht heraus, kommt sie nicht heraus, kommt der Hund heraus und beisst anem!” pflegen nach einer Kirchenmelodie schwäbische Fechtbrüder in Südungarn beim „Steuereintreiben” vor den Gehöften zu singen. Und gewöhnlich kommt der Hund heraus Taugt mir ..... dem schlichten Marktberichterstatter, so etwas? Darauf gibt Raschi den Pschat: ¹) daj psim pokoj! zu deutsch: Lass die Sumsenbacher in Ruh! denn, wie es in den Sprüchen heisst (Kap. 14, Vers 13): Auch wenn wir witzeln, tut das Herz zuweilen weh!
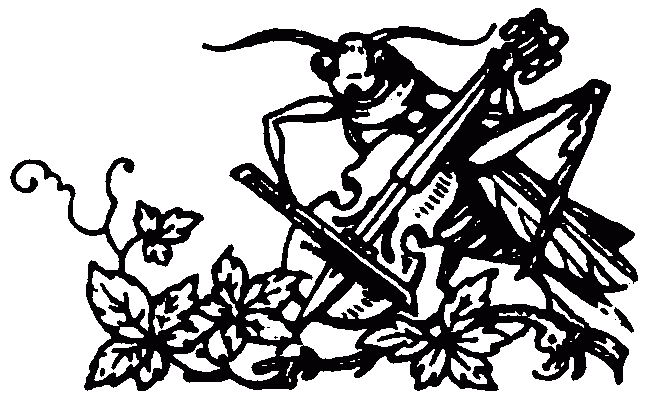
Götter und Mythen können, wie wir gesehen, als Mikroben aus verwesenden, indogermanischen Wortwurzeln, aus Donnergekrach und Blitzzuckungen, aus beiden Zizen und vulkanischen Ausbrüchen oder auch minder gefährlichen Ergüssen, ferner aus Feuer und Flammen, und unter günstigen Bedingungen auch aus Lämmerwolken entstehen, wie eben der jeweilige böhmische Korallenfabrikant gelaunt ist. Indessen würde die Ansicht nur von Oberflächlichkeit zeugen, dass damit die Erfindunggabe aller Korallenfabrikanten erschöpft sei. Mit Nichten und Basen! Ich hatte einen Professor, der mit viel Scharfsinn und Wissen den Nachweis lieferte, dass alle Götter Griechenlands und Roms nur nach Thrakien zuständig sein können, ausgenommen Zeus, den Juvans pater der chtonischen ' Ursprungs und gebürtiger Sizilier sei.
- 52 -
Ein anderer entdeckte alle Götter in Prellers griechischer und römischer Mythologie, und ich schwänzte - beileibe nicht die Götter - sondern die Vorlesungen; denn aus Prellers Werk konnte ich gemächlich in meiner Stube daheim mir selber etwas vormachen. Bis einer zum Marktberichterstatter abwirtschaftet, muss er eben vieler Mythologen Schüsseln ausgesuppt haben.
Kurzum, mir imponiert niemand mehr, ausser mein Landsmann Herr Nadko Nodilo, k. Universitätprofessor in Agram. Sollte es einmal - was wäre denn in unserem industriellen Zeitalter fin de siècle unmöglich und unwahrscheinlich ? - zu einer allgemeinen Kunstausstellung böhmischer Korallen aus der Götter- und Mythenwelt kommen, und man würde mich in die Jury wählen - ich bin ja hors de concours - so würde ich unbedenklich den ersten Preis, die siebentürmige Schellenkrone, dem glücklicheren Rivalen Veckenstedts und Falbs, eben Herrn Nodilo, zuerkennen. Nicht allein darum, weil er seine Mythen und Götter aus dem unerfindlichen Vorrat der eigenen verschütteten Gewürzbüchse in Raten und in Heften zizerlweise liefert, sondern aus sechs inneren und äusseren Gründen, wie folgt:
Erstens ist Prof. Nodilo wirkliches Mitglied der südslavischen Akademie für Künste und Wissenschaften; zweitens ist die von ihm verfasste „Religion der Serben und Kroaten auf hauptsächlicher Grundlage der Lieder, Sagen und der Volksprache” (Religija Srba i Hrvata na glavnoj osnovi pjesama, priča i govora narodnog, Agram 1885 - 1888) in den Mitteilungen der genannten Akademie (auch im Sonderabdruck) erschienen; drittens ist er ein Mann von einem umfangreichen mythologischen Wissen, wie es bei einem Kroaten selten oder gar nicht anzutreffen ist; viertens fabriziert er seine Götter in naiver Unschuld mit dem Bewusstsein, seinem Heldenvolke und den zur Andacht gepressten Gymnasiasten einen ungeheuer wichtigen Dienst zu erweisen, fern von jeder Absicht seine Mussleser und zeugnisbedürftigen Zuhörer zu täuschen; und fünftens ist er ein Mann, der auf gesellschaftlichen Anstand und gute Sitte mehr hält, als man sonst bei einem Kroaten gewohnt ist; schliesslich und sechstens ist Prof. Nodilo halb und halb mein Landsmann, nicht ganz, wie ich oben irrtümlich behauptete, und ich möchte es nicht, dass er einmal gegen meine Aufnahme unter die kroatischen Unsterblichen - obwohl ich nur ein Slavonier bin - aus
- 53 -
Gründen persönlicher Natur Einsprache einlege. Ich erkläre also hiemit feierlichst, dass ich ganz und gar nichts gegen die Akademie einzuwenden habe und ihr nicht das geringste Lob für das Zustandekommen der böhmischen Korallen ihres wirklichen Mitgliedes Nadko Nodilo zuzusprechen in der Lage bin. Ebensowenig gebührt z. B. der Wiener Akademie der Wissenschaften irgend eine Anerkennung für den Abdruck der wundervollen Entdeckungen Karl Freiherrn von Reichenbachs auf dem nun brachliegenden Gebiete der Odwissenschaft. Jede Akademie erfüllt nur ihre statutarische Pflicht und Schuldigkeit, indem sie die Beiträge ihrer Mitglieder abdruckt und pünktlich für den Bogen 60 oder 80 Gulden dem Autor bezahlt. Leben und leben lassen! Würden Akademien nicht von Zeit zu Zeit obdachlosen Korallenfabrikanten Unterschlupf gewähren, so wäre vielleicht schon längst der Götter- und Mythenmarkt krachen gegangen.
Diese Verwahrung erachte ich für ein Gebot der Selbsterhaltung, damit man mich nicht einen „Landesverräter” schelte und mich neuerlich mit der freundlichen Einladung beehre: „Komm du nur nach Agram, wir werden dir die Knochen zerbrechen!” Ich bin nicht so neugierig, und wäre ich es, so könnte ich mir dies Vergnügen auch hier in Wien in einem der Fürst Lichtensteinischen Antischämistenkonventikeln zur Aufkrallung des Volkes, ohne Reisespesen und Zeitverlust sehr leicht verschaffen. Ich bin wirklich nicht so neugierig, aber deine Wissbegierde, herzliebster Leser, über die Agramer Fremdenvertreibungkommission kann ich stillen.
In der Einleitung zum 2. Bande meiner „Sagen und Märchen der Südslaven" (1884) S. XLIII- XLVI nahm ich einen schicklichen Anlass wahr, eine höchst seltsame Perle aus der böhmischen Korallenfabrikniederlage des urchrowotischen Volkmelodienzurichters Fr. Ś. Kuhač, vormals in Firma Koch, mit einer besonderen, würdigen Fassung zu versehen. Koch übertrumpft selbst unseren „Dr.” Veckenstedt, indem er eine gänzlich nichtsnutzige Koralle selber erfand, sie jedoch nicht für sein, sondern für Wolf Karadžićs Eigentum unter ausdrücklichem Verweis auf die Fundstelle ausgab. Kochs Korallenschnüre sind - nebenbei sei es erwähnt - gleichfalls in den Mitteilungen der Akademie veröffentlicht. Meinen Karadžićs, der so oft gegen serbische Korallenfabrikanten gezetert, kenne ich doch zu gut, und verblüfft, wie ich ward, schlage ich bei ihm nach und finde keine Spur von der ihm
- 54 -
aufgemutzten Koralle. Da versuchte ich dann, viel artiger im Ausdruck als es irgend ein kroatischer Literat im gleichen Falle getan haben würde, dem Herrn Koch unter Vorlage seiner Perle die einfachsten Begriffe von Ehrlichkeit und Wahrheitliebe beizubringen, die er bis dahin für böhmische Dörfer im Reich der Chimäre halten mochte. Ein Jahr später sandte er mir höflichst eine Nummer der Agramer politischen Schnudeltante ein, wo er in 2½ ausgerissen langen Spalten giftig und kotzengrob den Beweis antrat, dass die Aufklärung für ihn viel zu spät komme und er für Belehrungen überhaupt unzugänglich sei. Im Übrigen würde es ihm eine herzliche Genugtuung bereiten, wenn ich nach Agram käme; denn er mache sich anheischig, mir alle Glieder zu zerbrechen, wodurch die Ehre des chrowotischen Volkes, das ich beleidigt, wieder hergestellt wäre.
„Chrowotenvolk bin ich!” meint Koch von seiner angenehmen Person. Das erinnert an die alte Geschichte vom Abgeordneten des Dorfbezirkes und den Bauern, seinen Wählern. Fragten sie ihn, den Ablegaten: „Burgamasta, warum redt Ihr gor nischt im Plariament?” - „Jo, lests ös Leutl gar koan Zeidung not?!” - „Jo freili, jed'n Sunnta lest uns der Schulmasta aus da Zeidung vur.” - „No, steht not allweil in da Zeidung bei dö Reden: Strampfen mit den Füssen, andauernder Lärm, wilde Geberden?” - „Freili, freili.” - „Na alsdann siechts Kinner, dös bin immer i!”
Vier Jahre nacher machte mir der kroatische Akademiker, Archäolog und unübertreffliche Erfinder mannigfacher Grosstaten urchrowotischer Dynastien, Kanonikus Professor Šime Ljubić hier in Wien herbe Vorwürfe wegen meiner literarischen Tätigkeit. „Du bist” (nach altheimischem Brauche duzten wir uns in vertraulichem Gespräche) sagte er, „ein Störefried, ein Vaterlandverräter, ein Spötter, dem keine Autorität heilig ist. Du übst eine zersetzende, sarkastische Kritik, wie das so eine Eigentümlichkeit der Juden schon ist, und hast nichts, was du an Stelle der Errungenschaften anderer setzen könntest”
Darauf bemerkte ich gemütlich: „Geh, raunz nicht, alte Zuwiderwurzen. Dir hat jemand Raupen in den Nacken gesetzt. Das verstehst du gar nicht.”
„Was, du höllischer Nihilist, ich verstehe das nicht! Wie soll mans denn verstehen?”
Begütigend erklärte ich: „Schau Bachsimperl, die Geschichte ist nicht so arg. Wenn z. B. einer die Krätze hat und es
- 55 -
kommt ein Arzt und heilt ihn davon, muss er denn unbedingt etwa Läuse an Stelle der Krätze setzen ? Kann man sich denn ohne Krätze nicht behelfen?”
Jetzt wird mein Akademicus erst recht fuchsteufelwild und sagt, indem er die Hand drohend erhebt, als wollte er mich ohrfeigen: „Sollst dich nur unterstehen, nach Agram zukommen, wir werden dir den Kopf einschlagen!”
Prof. Virchow hat schon mehrmals bei Besprechung Ljubićischer Arbeiten betont, dass mein grosser Patriot unzuverlässig sei und nicht vollen Glauben verdiene, worüber man in der Zeitschrift für Ethnologie nachlesen mag. Ich bin, bei aller Hochachtung für Virchow, diesmal gegenteilger Ansicht. Wenn Ljubić jemandem das Kopfeinschlagen verspricht, so darf man ihm aufs Wort glauben, dass er zuverlässig ist. Ich aber bin, wie gesagt, nicht neugierig und muss nicht alles selber erfahren.
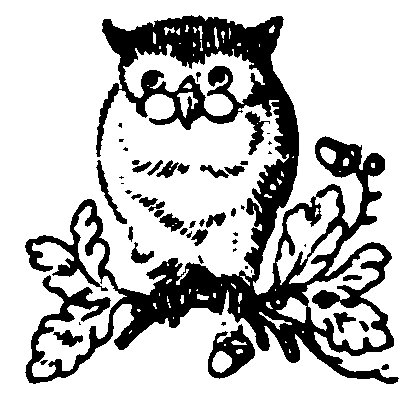
Revenons àà nos moutons. Bei der auf die Spitze getriebenen exaltirt nationalen Empfindlichkeit und Eitelkeit meiner Landsleute müsste ich mich jeder eigenen Bemerkung zu Nodilos Ausführungen enthalten. Darum überlasse ich es lieber dir, o mein braver Leser, selber zu urteilen, ob Nodilo nach den Zitaten, die ich gleich anführen werde, von Rechtes wegen den gedachten ersten Preis verdient oder nicht. Nodilos „Religion” umfasst sechs starke Hefte in Grossoktav, wovon ich die ersten fünf vor mir habe. Ich bin als Marktberichterstatter, wie du wohl gemerkt hast, kein heuriger Hase, und doch stehe ich Nodilos Arbeit noch ratloser als der Falbischen gegenüber da; denn ich finde darin weder die bewährte Methode, noch das System der Korallenfabrikanten, es wäre denn das Charakteristische, dass jede Methode und jedes System den Göttern und Mythen Nodilos abgeht. Bei ihm ist nämlich nichts und niemand vor Vergöttlichung und Vermythung gefeit. Die kunterbuntesten Dinge aus der indischen, germanischen, griechischen und römischen Mythologie sind hier mit zufälligen Lesereminiscenzen aus südslavischen Volküberlieferungen - die nord- und westslavischen scheint er nicht zu kennen -
- 56 -
durcheinandergewürfelt und der Haltbarkeit wegen mit grammatischem und historiachem Cement verpickt und verschmiert. Dazu ist das Ganze mit schwunghaften dichterischen Ausbrüchen und Gefühlaufwallungen retrograder Prophetie durchsickert. Mag sich Herr Prof. Nodilo selber aussprechen:
Heft I, S. 6 sagt er: „Die Serben und Kroaten der Vorzeit athmeten in einer Atmosphäre, die, ich möchte sagen, von der Göttlichkeit durchsättigt war. Traun, sie haben ihren Göttern ihre herrlichsten Lieder fabriziert. Zur Zeit der heidnischen Jahrfeste, der Stamm- und Sippenfeierlichkeiten, nach der Opferdarbringung, pflegten sich die serbischen und kroatischen Mannen zum Jubel zu erheben, und es jauchzten die Sänger auf den Bergen, an den Flussufern, in den Wäldern oder unter dem heimischen Dache in der zahlreichen hausgemeinschaftlichen Familie; sie sangen besonders darum, um ihrer gläubigen Gemüterschütterung Luft zu machen,” und so fort im gleichen schwulstigen Schwunge.
Da uns keinerlei Nachrichten aus alter Zeit über diese Dinge Kunde geben, so muss Prof. Nodilo wohl die Gabe des Propheten Daniel besitzen, der des Königs Träume zuerst erriet und dann zu deuten verstand.
Der zweite Band der von Wolf Karadžićs gesammelten serbischen Guslarenlieder gilt Herrn Nodilo als das heilige Buch der Mythologen. Durch Talvys, S. Kappers und Gröbers Übersetzungen kennen auch die Deutschen den Inhalt dieser Epen. Nodilo hat aber seine eigene Meinung darüber (I, S. 16): „Für den Erforscher ehemaliger Mythen der Serben und Kroaten wird diese Liedersammlung, natürlich dem Alter nach, als die erste und zuverlässigste Quelle dienen. Aus ihr quillt das lebendige Wasser, zuweilen aus einer geradezu unglaublichen Tiefe, empor. Personen- und Ortnamen, wie z. B. Balačko, Hala, Suhara, Pojezda, Prijezda, Jug, Trutina, Udina, treiben uns, sei es durch ihre Bedeutung, sei es durch den blossen Klang des Wortes zurück zum indoeuropäischen Ursprung oder wenigstens in die hinter den Karpaten liegende Heimat. Was ist in diesen Liedern gewöhnlicher als z. B. das Motiv, dass die Schwester den Bruder „mit den männlichen Gürtel umgürtet?” Dieser Gürtel erinnert uns sofort an den fast gleichen Gürtel der indischen dvidja.”
Nur gemach. Das serbische Sprichwort sagt: u bećara nejma izmećara (= der Ohneweib ist ohne Leibbediener). Ganz richtig. Wer verheiratet ist, den muss sein Weib bedienen,
- 57 -
es muss ihn ankleiden, muss ihm die Pferde warten und muss alle Dienste im Hause und im Felde verrichten. Hat aber ein lediger Mensch eine ledige Schwester im Hause, so muss sie ihm wie eine Gattin aufwarten und ihm eben auch beim Ankleiden helfen. Der Bruder war nach altem Sippenrecht als Stellvertreter des verstorbenen Vaters Herr und Eigentümer seiner ledigen Schwestern und konnte sie verkaufen oder verschenken. Er, der Gebieter, sie die Knechte! Stand der junge Ritter in voller Rüstung schwerfällig da, so musste ihm unbedingt jemand helfen, das letzte Ausrüstungstück, den breiten (Waffen-) Gürtel, umzuschnallen. War eine Schwester zur Stelle, so war dies ihre Arbeit. Wie kommt die Hopfenstange ins Krautfeld? Was haben die indischen dvidja hier zu schaffen, was altslavische Götter?
I, S. 24: „Alles ist lebendig auf unseren göttlichen Räumlichkeiten; alles lebendig auf der Welt und unten in der Finsternis; fast alle Götter, und häufig auch die bösen Geister haben eine Frau, Schwester und Mutter, zuweilen auch einen Vater und Bruder. Um alle diese Personen schlingt sich schon eine genug ausgeweitete Mythe. Am Himmel spiegelt sich ab das monotone Leben der Serben und Kroaten, sowie auf dem griechischen Olymp das leichtsinnige, abenteuerliche Leben der Griechen des heroischen Zeitalters widerglänzt. Erbaut ist die hohe Weissenburg (visoki Biograd) und das strahlende Paradiesheim (svijetla Rajevina), die weissen und glücklichen Sitze der Götter, wo selbstgeschaffene Hallen und goldene Tafeln sind; und ihnen entgegengesetzt steht, dort irgendwo in ungewisser Ferne, das dunkle Udina, der niedrige Hades, von blassem Silber und grauem Kupfer, wo traumverloren der Schwarze Gott (Crni Bog) mit seinem schwarzen Gefolge sitzt.”
Dieser Abschnitt gehört in die Kategorie jener tiefsinnigen Aufstellungen, auf die der Ausspruch des weiland Candidati Hieronymi Jobsii passt: „Die eine Hälfte, die verstehet man, die andere man nicht verstehen kann.” Der erste Teil spielt auf die Sonnen- und Mondheiraten an, an denen rein gar nichts Mythisches ist, wie man dies im ersten Kapitel meines Buches „Volkglaube und religiöser Brauch der Südslaven” ausführlich begründet findet. Der kroatische, dem griechischen nachgebildete Olymp und die Unterwelt mit Seiner Majestät dem Schwarzgott sind Erzeugnisse aus Nodilos Götterherstellungstube. Er darf sich darauf ein Patent geben lassen.
- 58 -
Bis zur 27. Seite reicht die Einleitung. Dann aber beginnt der erste Teil mit den eigentlichen Gottheiten, den Herrschaften Sutvid und Vid. Das erste Wort kommt in der serbischen und kroatischen Sprache gar nicht vor. Es ist eine auf etymologischem Wege erzeugte Neubildung in Anlehnung an Svantvid. Das zweite Heft beschäftigt sich mit den „Göttinnen” Pojezda, Prijezda und Zora, das dritte mit Gott Sunce (Sonne), das vierte mit den zwölffachen Gesichtern des Gottes Sunce und dem Bau des Neujahrs, das fünfte mit den Gottheiten Momir und Grozda und dem Sunce im Jahrlauf, das sechste Heft soll nach der Ankündigung das kleinere Göttervölklein behandeln. Von allen diesen grossen und kleinen Göttern und Göttinnen weiss das Volk nichts und hat nie etwas von ihnen zu sagen gewusst. Sie sind uns erst durch Prof. Nodilos seltene Kombinationgabe geschaffen worden. Es sind echte böhmische Korallen aus der kroatischen Götter- und Mythenwelt.
Es ist nützlich zu betrachten, wie Prof. Nodilo seine Götter erzeugt. So erklärt er z.B. (S. 30f.): „Wenn auch die Slaven ganz und gar den Glauben der Eranier angenommen haben, so verwarfen sie ihn doch zum grösseren Teil, da ihr Herz sie zu den lichten Göttern hinzog, zu der uralten dichterischen Verkündung der ersten arischen Väter. Von der eranischen Berührung blieben ihnen blos einige Glaubensworte und das genug ausgeprägte Bestreben in jeder Epoche ihrer Geschichte nach der streng zweifältigen Einteilung der Götter, nach der Religion zweier Prinzipien. Nachdem sie das ältere arische Wort für die Gottheit und den grossen Gott vergessen hatten, so behielten die Slaven und unter ihnen die Serben und Kroaten doch diesen Gott unverändert. Das aber war ihnen der heilige, der starke Vid. Sein Name kommt von vid, wissen, verstehen, anstatt von div, leuchten, sich aufhellen, was zu erwarten wäre. Ich möchte sagen, dass eine solche Benennung und Auffassung des höheren Gottes gegenüber dem indoeuropäischen um einen Grad verfeinert und vergeistigt sei. Vid sitzt gleichsam zwischen Ahuramazda und Zeus; es ist aber leicht möglich, dass auch dies von der eranischen geistigen Eingebung herstammt. Nun jedenfalls der Begriff des Sichtlichen nähert sich dem Begriffe des Lichtes, folglich sind Vid und Zeus zwei Zwillinge.”
- 59 -
Wer erklärt uns schnell das Wunder von den „zwei” Zwillingen?
Bei der Erzeugung von Regengöttern (S. 67 ff.), die auch kein Bofel sind, hat der fleissige Mann noch Zeit, schnell in einer Anmerkung (S. 68, Anm. ¹) eine himmlische Hebamme in die Welt zu setzen. Er sagt nämlich: „Der Brauch in der Bocca di Cattaro, dass bei einer schweren Geburt die kreissende Frau mit einem vollen Sieb Wasser unter Hersagung des Spruches: ,Das Wasser aus dem Sieb, aus dir aber das Kind!' begossen wird, gedenkt noch der himmlischen Schwerenotmutter. Ganz so sind sowohl Hera als Juno Göttinnen der Ehe und der Niederkunft.” Ganz so, das ist doch klar wie Schuhwichse.
In diesem Stile ist auch das zweite Heft gehalten. Das dritte Heft ist schon etwas lustiger. Über den Gott „Sonne” lässt sich hübscher reden. Schlagen wir aufs Geratewohl auf. Z. B. auf S. 7 heisst es: „Trotz aller Realität der Sünde war der wache Sonnengott, der die Sünde rächt und tilgt, ein gewisses halbethisches göttliches Wesen. Doch Gott kehrt ganz in den Bereich der Natur zurück, wenn er als sporitelj (?) und Geber der Jahrfrucht betrachtet wird. Der oberste ist der Austeiler, natürlich, der grosse Erzeuger aller sichtbaren Götter, der oberste Vid, von dessen Sichtlichkeit, nach slavischer Auffassung, auch die Sonne selber entsteht. Aber, wenn es bis zu Vid ein zeugendes, uranfängliches Sichtliches ist, so ist es dagegen bis zu Sunce (Sonne) die heisse segenspendende Wärme u. s. w.”
Unter den verschiedenen kleineren Göttinnen Prof. Nodilos gefiel mir sehr gut die hl. Barbara (Varvara), die Märtyrerin, die als Vara einen angesichts der beschränkten Raum Verhältnisse ganz annehmbaren Platz im kroatischen Olymp angewiesen bekommt. Vara, bemerkt recht hübsch Prof. Nodilo, „stammt, scheint mir, von der slavischen Wurzel ver, woher auch unsere Worte vreti (sieden), vir (Wasserstrudel), variti (sieden, einkochen), var (das Eingekochte) herrühren, und scheint die Bedeutung „lauwarmes Wasser” zu haben. Diese Bedeutung würde zu dem Wesen der uns vertrauten Göttin der lauen Himmelgewässer passen. Es passt aber auch dazu vollkommen die fruchtbare Schweineherde, welche der himmlischen Gnadenfrau sowie auch der Vara geweiht ist.” Auf der nächsten Seite u. s. w. werden wir mit der Göttin
- 60 -
Koleda (das Wort ist aus dem lat. kalendae oder dem griech. ϰαλύνδαι)bekannt gemacht.
Ich besorge, du wirst, lieber Leser, dem Berichterstatter seine Breitspurigkeit verübeln. Nichts für ungut. Ein einziges Zitat mögest du mir noch gütigst erlauben. In den Volkliedern haben sich noch viele echtslavische Namen behauptet, während in der Gegenwart die Leute ihren Kindern gewöhnlich Heiligennamen aus dem Kalender geben. In bulgarischen Volkliedern kommen noch unter anderen die Namen Momir (mein Friede, meine Ruhe) und der Blumen- oder Pflanzenname für ein Frauenzimmer Grozdana (die Traube) vor. Momir und Grozdana finden sich zuweilen wie bei uns Hans und Gredl beisammen. Nodilo aber sagt (Heft V, S. 3): „Momir und Grozdana, das Bürschlein und das junge Mägdlein, sind Gott und Göttin. Ihre Göttlichkeit bezeugt und erhebt über jeden Zweifel die skandinavische Edda. Bei unserem Momir, wie beim griechischen Oedipus, ist die Haupteigenschaft, eine geradezu charakteristische Eigenschaft, der Scharfsinn und die allzugrosse Weisheit. So ein alleswissender Künstler ist der germanische Mimir .... Der serbische Momir ist also der skandinavische Mimir nach allen inneren Eigenschaften seines Wesens.” Das ist doch für die Germanisten sehr wichtig zu wissen; denn sie erlangen da unerwartet eine kräftige Waffe mehr gegen diejenigen Forscher, die die germanische Echtheit der Edda als ältester Aufzeichnung des Volkglaubens bestreiten. Prof. Nodilo hat seine Untersuchungen noch lange nicht abgeschlossen, und die Agramer Akademie ist reich genug dotirt, um alle Spesen tragen zu können. Wer weiss, wer weiss, was für neue böhmische Korallen uns Nodilo aus der Götterwelt noch bescheren wird. Nur Geduld, und nicht gleich den Mut verlieren.
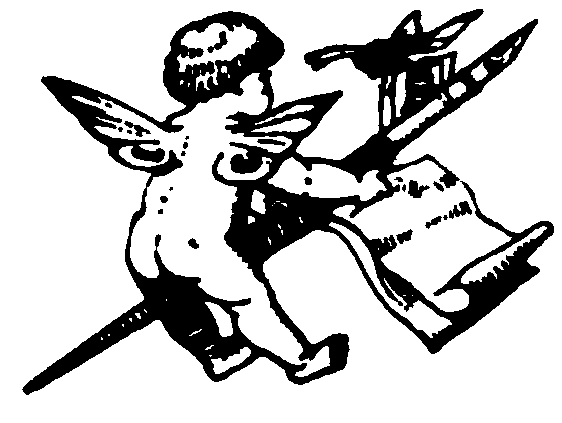
Neben Nodilo erscheint der Grazer Universitätprofessor Herr Dr. Gregor Krek nur als Stümper in der Göttererzeugung, aber zu verachten ist er durchaus nicht. Auch er stellt seinen Mann auf diesem Gebiete. Da ich über seine Erzeugnisse in der zweiten Hälfte dieses Büchleins berichten
- 61 -
muss, so will ich der Kürze halber nur auf den Fundort hinweisen und mich gleich dem produktiveren Korallenfabrikanten zuwenden, Herrn Milojević, dem Massenerzeuger serbischer Götter und Göttinnen.
Dieser Fabrikant hat mit seinen Erzeugnissen entschieden Pech gehabt. Seine zwei Bände über das Leben und die Gebräuche des gesammten serbischen Volkes (Život i običaji ukupnog naroda srpskoga. Belgrad 1869 und 187¹) sind gut um 50 Jahre zu spät erschienen. In den dreissiger und vierziger Jahren würden sie vielleicht Sensation in der ganzen Welt, gleich den ossianischen Liedern Macphersons erweckt haben und wären in 20 Sprachen übersetzt worden. Dieses Gewimmel von Göttern und Göttinnen! Und dabei alles so treuherzig und geschickt unter Berufung auf Zeugen erzählt! Nur ein namhafter russischer Gelehrter war so gutmütig, mit Freuden M. S. Milojevićs böhmische Korallen aus der serbischen Götterwelt in Kauf und Kommission zu nehmen, die meisten südslavischen Gelehrten dagegen übergössen den Armen mit der ätzendsten Lauge ihres Spottes, so dass er, in die Enge getrieben, die Fabrik eingehen lassen musste. Und er hat doch wirklich gut 200 Götter und Göttinnen und eine Menge unchristlichster Sitten und Gebräuche erdacht und ersonnen. Wenn Veckenstedt einen längeren Götterkatalog spendet und uns mit einem Gemetzel erfreut, so kann
M. S. Milojević in einem Zug mit Dutzenden von Katalogen prunken. Er ist auch vielseitiger als sein Widerpart und ist ein Versemacher. Überhaupt hat er sich in jeder Hinsicht mehr als Veckenstedt angestrengt, aber es auch nicht verschmäht, gleich Nodilo die germanische Mythologie in den Kreis seiner Betrachtung zu ziehen. Er hat sich auch mit Nutzen Namen aus der indischen Götterwelt gemerkt. Besehen wir uns mal eine solche Koralle, will sagen ein Lied von Milojevićs Fabrikat (Bd. I, S. 126 f.):
Ko pogazi pobratimstvo ?
Prpr njemu,
Davor njemu!
Svoga brata pobratima,
pobratima ko rogjenog,
ko prevari svoga druga,
svoga druga pobratima,
satro ga silni Ljelju
svojim ocem strašnim Bogom,
a triglavom svetom Trojicom.
- 62 -
Dom mu satri Prprruša,
strašna seja Davor Boga,
poslanica Višnja Boga;
stvoritelja Držatelja
i strašnoga Rušitelja.
Wer trat mit Füssen die Wahlbruderschaft?
Über ihn Prpr,
über ihn Davor!
Wer seinen Bruder, den Wahlbruder,
den Wahlbruder wie den leiblichen Bruder,
wer seinen Kameraden betrog,
seinen Kameraden den Wahlbruder,
den zermalme der mächtige Ljelj,
mit seinem Vater dem fürchterlichen Gotte
und mit der dreihäuptigen heiligen Dreiheit.
Sein Heim zermalme Prprruša,
die fürchterliche Schwester des Davor-Gottes,
die Gesandtin des Gottes Višanj,
des Schöpfers Držatelj
und des fürchterlichen Rušitelj.
Milojević befolgt in der Götterfabrikation wesentlich dieselbe Methode, die uns schon bei Veckenstedt Ehrfurcht eingeflösst und Bewunderung abgerungen hat. Grosse Erfinder und geniale Entdecker begegnen einander so häufig in ihren Gedanken, Einfällen und Ausführungen, Darum wäre es nicht nur verfehlt, sondern sogar sündhaft, wo nicht ehrenrührig, eine gegenseitige Entlehnung oder Beschnipfung anzunehmen, zumal da Veckenstedt als der jüngere Fabrikant namentlich in diesem Falle mit vollem Rechte darauf sich berufen kann, dass ihm die serbische Sprache noch spanischer oder böhmischer als die litauische klinge. Er darf stolz auch auf den Umstand hinweisen, dass er nicht einmal alle Götter Lasickis „durchstilisirt” und modernisirt habe. Die Gleichheit da und dort erklärt sich naturgemäss aus der beiderseitig gleichen geistigen Veranlagung und Stimmung der Göttermacher.
Es steht schon in der heiligen Schrift: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei!” Der Mensch allein kommt nicht einmal ins Himmelreich, behauptet das kroatische Sprichwort. Elend daran ist wohl die einsame Jungfer, die ungeliebt und unbeachtet dahinaltert, doch sie kann sich immerhin durch Stricken, Sticken, Nähen, Waschen, Kochen und Katzenstreicheln die Zeit vertreiben; aber übel, sehr übel daran ist der Hagestolz, der Junggeselle. Im Sommer mag er Fliegen
- 63 -
fangen, jedoch im Winter? Was fängt er da? Wie wahr und schön, Millionen Erdenbewohnern aus der tiefsten Tiefe des Herzens heraus und ins Herz und in die Seele hinein sang Gottsleben, der jüngste und würdigste Vertreter des Prehauserischen Hanswurstes in der Wiener Musikausstellung im Sommer 1892 seine glückliche Braut Colombine an:
Jedes Mandl braucht a Weibl
Und a Waibl braucht an Moªnn;
Weil das ane ohne das andre
Halt nix g'scheidts tentiren koªnn!
So unter den Menschenkindern, wie erst unter den Göttern! Wie behilft sich nur ein göttlicher Hagestolz ? Soll er etwa im Olymp ein Pariser Garçonleben führen? Ja, ja, der Junggeselle!
Mit anem Wort: Der Jung'sell is
Kan Zwief'l und kan Knof'l,
Doch unter Göttern is er g'wiss
An abgelegter Pof'l!
Jede Volksängerin müsste von den Pablatschen herab mit dieser Strupfen Sensation erwecken. Zum Glück wissen die Götterfabrikanten, dass die meisten Ehen im Himmel geschlossen werden, natürlich in erster Reihe unter den Göttern. Bekanntlich haben die Götter, bevor sie die Erde erschufen, sich stattliche Barte wachsen lassen. Die Liebe fängt auch bei den Göttern bei der eigenen Person an. Darum lehren die Götterfabrikanten: „Kein Gott ohne Gattin, keine Göttin ohne Gatten!”
Gleich Veckenstedt erkannte auch Milojević, dass diese Grundsätze in der Götterwelt verwirklicht werden müssen, und erzeugte daraufhin zu jedem göttlichen Junggesellen durch blosse Umgestaltung des betreffenden Namens eine göttliche Himmelgefährtin, und jede göttliche Mamsell Jungfer bekam einen entsprechenden strammen, himmlischen, fürchterlichen Ehegesponsen nebst wackerer Schwägerschaft und reichem Kindersegen. Diese klaffende Lücke in der Götterwelt musste doch baldigst ausgefüllt werden. Als gewissenhafter Fabrikant hat Milojević alle Vorarbeiten serbischer Lasickis - und es gab ihrer mehrere - gewissenhaft mit verwertet. Eine Neubildung ist Gott Prpr (S. 61. 2. Liedzeile), der Schwager Davor-Gotts (S. 62. 2. Zeile), Gatte der fürchterlichen Ablegatin Gott Višanjs, der Frau Prprruša. Bei Bittumgängen um Regen pflegte in Dalmatien noch vor 50 Jahren die Dorfjugend, mit grünen Reisern geschmückt, singend von Haus zu Haus zu ziehen (zwischen St. Georgi und St. Petri).
- 64 -
Die meist ganz in Grün gekleidete Vorsängerin und Vortänzerin hiess prporuša; in Griechenland wird das entsprechende Mädchen πυϱπηϱούνα genannt (vgl. Grimm D. M. L 56¹). Zuerst erhob Milojević das harmlose Dorfmädchen in den Rang einer Göttin und liess sie fürchterlich werden, und dann änderte er ihren Namen in prpr-ruᘚ, um die ersten zwei Silben für ihren Herrn Gemahl verfügbar zu haben. Prpr ist freilich eine im serbischen ungeheuerliche Wortform, wo man die Form prpac, die übrigens in der Volksprache vorkommt, ¹) erwartet, aber Götter haben schon ganz kuriose Namen. Interessant ist der Krieggott Davor, der sein Dasein, wofern ich nicht irre, dem italienischen Touristen Abbate Fortis zu verdanken hat.
Die ständige Formel, mit der noch im vorigen Jahrhundert serbische Guslaren ihre Lieder einzuleiten pflegten, - auch diese Dinge unterliegen dem Wechsel der Zeiten - lautete:
Davor druže, da pjesmu pjevamo!
Wohlan, o Freund, so lass ein Lied uns singen!
Hie und da verwendet auch gegenwärtig noch ein Guslar das Wort Davor, oder weil er es als veraltet empfindet, sagt er da evo (da siehe); Davor geht auch nur auf da evo že (wohl hier ja) zurück. Fortis hielt Davor für eine Anrufung der Gottheit, und weil die Guslarenlieder meistens von Krieg und Gemetzel berichten, eines Krieggottes. Auch Nodilo hält Davor für eine Gottheit, und diese Meinung ist so verbreitet, dass die Slovenen sogar einen männlichen Vornamen „Davorin” im Sinne von Mamertius sich daraus zurechtlegten.
Triglav (Terglou), der 2865 m hohe Gebirgstock der julischen Alpen, ist auch schon von einem älteren Korallenfabrikanten in den Götterstand erhoben worden. Die Fürsorge der Epigonen, den Göttervorrat ihrer Vorgänger unangetastet zu lassen, ist wahrhaft rührend.
Gott Višanj ist ein durch Milojevićs schützende Gunst in den serbischen Olymp aufgenommener indischer Visnu. Držatelj (Erhalter), Rušitelj (Zerstörer) sind dagegen unverfälschtes Erfindereigentum Milojevićs.

- 65 -
Eine Zwischenstellung zwischen Nodilo und Milojević nimmt der im Jahre 1889 verstorbene slovenische Pfarrer, Patriot und Göttererzeuger Davorin Trstenjak ein. Er lebte notdürftig; denn fast so viel als seine Pfründe abwarf, so viel kostete ihm jährlich seine Liebhaberei. Seine Götter und Göttinnen deckten nicht einmal die Herstellungkosten. Sein treuer slovenischer Patriotismus schützte ihn vor grobem Schimpf und Glimpf Einen merklichen Einfluss hat er nie besessen. Seine Götter und Mythen hatten auf dem Markte nie einen Kurswert.
Unter den neueren bulgarischen Schriftstellern wurde die Götterfabrikation von dem Politiker G. S. Rakovskij (1818 bis 1868) mit Erfolg eingeleitet. Seine Sonnenmythen fanden bei Prof. Krek und dem Franzosen Dozon den lebhaftesten Anklang. In seiner Schrift „Der Wegweiser” (Pokazalec) von 1859 stellte er ein „Programm” für bulgarische Altertümer auf, wie ein bulgarischer Veda aussehen müsse. Ein bulgarischer Lehrer in Kruševo, namens Ekonomov, nahm sich dies zu Herzen und unterzog sich bald darauf der Mühe, die gegebenen Andeutungen und Fingerzeige zu verwerten. Er fabrizirte einen „Slavi sehen Veda” (Veda Slovena. Blgarski narodni pesni ot predistorično i predchristiansko doba. Otkril v Trakija i Makedonija i izdal J. Verkovič. Kniga L Belgrad 1874. XVIII. 545 S. Lexikonformat). Diese „Volklieder aus der prähistorischen und vorchristlichen Zeit Thrakiens und Makedoniens” sind auch mit einer gegenüberstehenden französischen Übersetzung versehen und bilden einen Bruchteil der 250.000 Verse umfassenden Sammlung. „Es waren dies Lieder von so hohem Altertum, wie sie kaum sonst ein europäisches Volk besitzt; es gab hier direkte Erinnerungen an die indische Urheimat, Erinnerungen an die Einwanderung der Bulgaren in ihre jetzigen Wohnsitze u. s. w. Mit einem Worte, es war dies eine grosse Entdeckung, die berufen war, die ganze slavische Geschichte und Mythologie umzugestalten, ganz unerwartete Aufschlüsse über das slavische Altertum zu bringen, und die Bulgaren erschienen als die „Träger dieser ältesten Tradition” (Spasovič). Die Bulgaren erwiesen sich aber gegenüber dem Herausgeber Verkovič sehr wenig erkenntlich; sie verwarfen in Bausch und Bogen seine kolossalen Göttergeschichten und versauerten ihm derart das Leben, dass er im heiligen Russland eine
- 66 -
Zuflucht suchte, doch auch dort niemanden angeln konnte, der das Geld für die Veröffentlichung des übrigen, grösseren Teils der Sammlung urbulgarisch-serbischer Korallen aus der Götter- und Mythenwelt herborgen wollte. Durch den unter Patronanz der fürstlich bulgarischen Regierung erscheinenden „Sbornik za narodni umotvorenija” (Sammelwerk für Volküberlieferungen), von dem bisher acht dicke Quartbände erschienen sind, ist zum mindesten für Bulgarien auf absehbare Zeiten hinaus die Möglichkeit der Schaffung eines neuen Göttermarktes geschwunden.
Verkovič, ein unserem „Dr.” Veckenstedt congenialer Korallenfabrikant, dem er eigentlich nur dadurch überlegen ist dass er zugleich auch eine Versefabrik mit Geschick und Umsicht leitet, hatte wie Veckenstedt den glücklichen Einfall, seine Korallenschätze einer Akademie, und zwar der kaiserlichen in St. Petersburg, anzubieten. Mir selber ist die in Gelehrtenkreisen hochgeschätzte Auszeichnung zu Teil geworden, dass mich eine Akademie zu ihrem Ehren- und eine andere zu ihrem wirklichen Mitgliede ernannt hat, wodurch mir natürlich jeder Akademie gegenüber sozusagen ein Knebel in die Feder gesteckt wurde (um mit Wippchen frei von der Leber wegzuschreiben), aber mir ist auch unter einem auf diese Weise meine Marktberichterstatterpflicht zu schwer gemacht worden. Auch die kaiserliche Akademie zu St. Petersburg scheint aus eben solchen gelehrten Zöpfen, wie die Berliner geflochten zu sein; denn sonst bleibt die Ablehnung der angetragenen Schätze Verkovičs ein unlösbares Rätsel. Um das angerichtete Unheil noch zu vermehren, musste es der Zufall fügen, dass selbst die Handschrift Verkovičs in Verstoss geriet. In seiner Verzweiflung beschuldigte Verkovič den Prof. V. Jagić des Diebstahls, weil ihm die Akademie das Referat übergeben. Prof. Jagić hielt es für unerlässlich, in der „Neuen Freien Presse” im Sommer 1892 sich von dem Verdachte zu reinigen. Ich bin aber der Ansicht, dass dem Prof. Jagić die Manuskripte Verkovičs gestohlen werden konnten . . . Daran ist bei der Beurteilung des Falles festzuhalten.
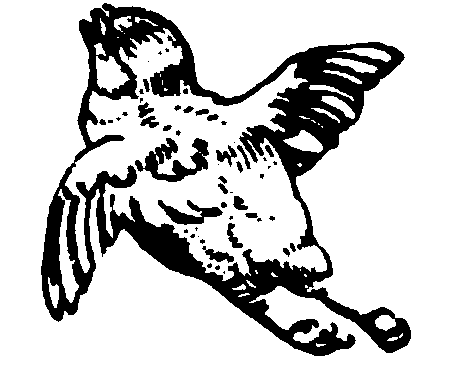
- 67 -
Du siehst nun, mein getreuer Leser, wie wenig lohnend unter Umständen die Korallenfabrikation sich erweist. Auch in dieser Industrie entscheidet vor allem das Glück. Man muss nicht allein Glück in der Herstellung von Göttern und Mythen haben, auch der Vertrieb muss sich unter glücklichen Sternen abwickeln. Mancher hat Glück im Suchen, mancher im Finden. Manches Mädchen macht nicht einen Mann glücklich, manches auch hundert. Mancher Korallenfabrikant ruinirt sich und seinen Verleger, mancher hilft sich und einem armen Buchhändler auf die Beine. Nicht blos das Rad des Schicksals, sondern auch die Geschicke der Korallenfabrikanten drehen sich im rollenden Laufe der Jahre.
Brumm nur nicht, wenn ich einmal statt über den Wechselkurs, über den Wechsel der Dinge Betrachtungen anstelle. Man wechselt Hemden, Geld, Röcke, Taschentücher und Unterhaltungstoffe. Also will ich dir zur Abwechslung ein Stück slavonischer Kulturgeschichte erzählen. Sie ist wahr; ich habe sie von meinem Vater s. A., der mir zu meiner Belehrung und Bildung vieles aus seiner Jugendzeit zu erzählen pflegte.
Ums Jahr 1830 bestand noch in Darda, einem Dörfchen bei Essegg, der Haupt- und Moraststadt Slavoniens, eine jüdische Gemeinde von etwa hundert Familien. In den königlichen Freistädten, in freien Ortgemeinden und in der Militärgrenze durften Juden nicht wohnen. Da aber die Juden keine Nomaden waren, obwohl der ebenso gelehrte als alberne Prof. Wahrmund das Gegenteil davon behauptet, und sie das Bedürfnis fühlten, irgendwo sesshaft zu sein, so bezahlten sie den gnädigen Grundherrschaften jährliche Tribute für die Duldung. So waren auch dem Gebieter von und zu Darda die Gemeinde als Active, juristische Person und jedes männliche Individuum insbesondere tributär. Natürlich verzichtete dabei der Staat auch nicht auf sein eigenes Judensteuereinhebungrecht. Ackerbau und Handwerke waren ihnen zu betreiben verboten, Staatbeamter konnte nur ein Adeliger werden, was tun? Blieben nur zwei Auswege für den Juden, entweder dem rabbinischen Studium sich zu widmen mit der Anwartschaft im besten Falle Rabbiner mit lebenslänglichem Dales (Armut) oder Hausirer zu werden. Bis auf den Rabbiner Leb, den mein Urgrossvater, der Rabbiner von Baja in Südungarn, ausgestellt hatte, die zwei Dajanim (Richter und
- 68 -
Beiräte des Rabbiners) waren sämmtliche Balbatim (Familienoberhäupte) Hausirer und eifrige Verehrer der Muse Kotzebues. Vom Rabbiner weiss man noch das Gleichnis (die witzige Rede): „Drei Ass sind kein Dardl (im Karten- spiel) und Darda ist keine Kile (Gemeinde).” Fragte ihn einer „warum so?” so sagte er: „Die ganze Woch' tragen meine Leuf den Binkel auf dem Buckel und am Schabbes Kotzebuckeln sie” (lesen sie Kotzebue). Somit waren die Gemeindemitglieder für ihn selten zu sprechen.
Einer der Kotzebuckligsten in der Gemeinde war ein gewisser Ley, der nach älterer Schreibweise seinen Namen mit Leu unterfertigte. Auch er war einer von der Jeschiwa (Rabbinerschule) meines Vorfahren, erhielt nirgend einen Posten, doch ein Weib und viele Kinder nach und nach dazu, für die er sorgen musste. Seine besten Kundschaften hatte er als Hausirer in Essegg. Nach dem Gesetz, dessen strenge Einhaltung der Pfarrer überwachte, durfte aber kein Jude länger als 24 Stunden nacheinander in den kotigen Strassen von Essegg umherwaten. Unser Leu ward dreimal in einem kurzen Zeiträume als Gesetzverächter attrapirt! Auf Antrag des Pfarrers stellte das hochlöbliche Gericht den Frevler vor die Alternative, entweder fünfzig Stockstreiche auf dem blossen Leibe zu empfangen und hundert Gulden Schein Bussgeld zu bezahlen oder in den Schoos der katholischen Kirche reuemütig einzukehren. Und so geschah es auf einmal dass aus einem Leu ein Lay, die Gemeinde von Darda um einen Kotzenbuckler ärmer und die königliche Haupt- und Freistadt Slavoniens um einen katholischen Bürger reicher ward.
Ferner ereignete es sich, dass dem Lay noch ein Sohn geboren wurde, den er bei der Taufe Felix nannte, und dieser Felix taufte sich selber später Srećko Lay und als er gross geworden, bekannte er sich für einen Urchrowoten. Vater Lay hatte noch aus seiner Leuentwicklungperiode ein Haus voll hungriger Sprösslinge und erfreute sich einer anhänglichen Mischpoche (Sippschaft), die sich sagte, wenn auch der Alte ein Meschumed (Renegat) geworden, so dürfe man trotzdem seinen Geldbeutel nicht mit Verachtung bestrafen; daher kam es, dass er seinen Felix nicht so ausbilden lassen konnte, wie es die schönen Anlagen des Söhnchens verdienten. Er liess ihn zur Not deutsch schreiben und lesen lehren und gab ihn dann zu einem Schnittwarenhändler in die Abrichtung.
- 69 -
Als ausgelernter Kommis konditionirte Felix in Agram, Pest und Wien und zog endlich als Kommis voyageur und Kulturträger wieder nach dem Süden. Wohin er sich wandte, überall stiess er auf eine zügellose urchrowotische und urserbische Begeisterung, doch zu seinem Erstaunen fand er keine greifbaren Objekte für den Taumel vor. Da verfiel er auf den prächtigen Gedanken, ein solches Objekt zu schaffen und die Patentpatrioten mit einer Luxussteuer zu belegen. Wie gedacht so angespähnt (oder getan). Mit seiner Bildung und seinem Wissen war es nicht weit her, aber er besass eine lochindenbauchbohrende Suada und gründliche Erfahrung im Fetzengeschäft. Wer nichts aus sich macht, wird ausgelacht und ein Schelm, wer mehr gibt als er hat.
In der Manufakturwarenbranche besitzt Felix Lay unstreitig einen feinen, gewählten Geschmack, worauf es doch bei jedem Kaufmann ankommt; denn nur teuerer verkaufen als man eingekauft, das trifft schliesslich auch eine alte Zigeunerin. Ein rechter Kaufmann dagegen zaubert durch sein Geschick und seine Mache die Kundschaften herbei, er macht den Platz zum Platz und schafft Bedürfnisse, wo nie welche bestanden. Lay verlegte sich nun auf die Fabrikation urslavischer, mythischer Teppich-, Stoff- und Stickmuster. Er spielte nicht va banque, vielmehr leitete er sein Unternehmen mit Bedächtigkeit ein. In Syrmien, wo seit jeher ein reger Handelverkehr zwischen Orient und Occident stattfindet, raffte er mit Leichtigkeit eine Anzahl auffällig hübscher Stick- und Teppichmusterstücke zusammen und kehrte damit nach Wien zurück. Hier vergesellschaftete er sich mit Herrn Goldmann, einem damals recht schwach bemittelten, eifrigen jungen Buchhändler (Antiquar), der eben das verkrachte Geschäft Halms übernommen hatte. Die Firma heisst derzeit Halm und Goldmann. Die weiteren Angaben verdanke ich dem letzteren. Die Bilder zeichnete ein tüchtiger, junger akademischer Zeichner, den deutschen Text dazu verfasste ein Musealbeamter, die kroatische und französische Übersetzung besorgten auch fremde Leute, die Kosten trug Srećko Lay allein. Zur Probe, um das Terrain zu sondiren, wurden zwei Hefte ausgegeben und zwar in prachtvollster Ausstattung mit Farbendruck. Srećkos Vorrat reichte knapp für die zwei Hefte aus.
Der geschäftliche und literarische Erfolg übertraf die verwegensten Erwartungen Lays und Goldmanns.
- 70 -
Die südslavische Presse, besonders die kroatische, schlug Purzelbäume vor Entzücken. Lay war plötzlich der Leu des Tages. Wäre damals etwa der Traum Pavlinovićs vom einigen Slavenreich unter kroatischer Führung unversehens verwirklicht worden, das Volk hätte Lay zum Minister der schönen Künste durch ein Plebiscit erhoben. Lay verstand es auch nebenbei, die Daumschraube dem erglühten Patriotismus anzulegen und Subventionen zur Weiterführung des nationalen Denkmales zu erlangen. Er befolgte den alten Weisheitspruch: Schafe muss man krempeln, so lange sie Haare lassen. Um Stoff für die weiteren Lieferungen zu gewinnen, begab er sich mit seinem Zeichner in ein kaiserlich-königliches Museum und liess einzelne schöne und gefällige Muster von orientalischen Teppichen abnehmen. So entstand sein Werk: «Südslavische Ornamente». Goldmann verdiente daran bare 16.000 Gulden. Den Gewinn Lays beziffert er jedoch auf 18 - 20.000 Gulden. Heute ist Goldmann ein wohlaccreditirter, gutgestellter Buchhändler (ob er mir wohl etwas für diese Reclame bezahlen wird?), Lay aber ein von Ballettänzerinnen abgetakeltes Wrack. Man muss also nicht blos im Suchen und Finden, sondern auch im Bewahren und Behaupten des Besitzes
Glück haben.
Anerkennung und Dank gebührt Lay dafür, dass die österreichische und französische Teppichindustrie durch sein Werk kräftige Anregungen empfangen, aber den Südslaven hat er für teures Geld böhmische Korallen angehängt. Eigentlich hat er sie gar nicht gefoppt; denn wenn jemand durchaus wünscht, dass du ihn übers Ohr hauest, und du erweisest ihm den Gefallen, darf er sich nicht über dich beklagen. Im übrigen aber hätten alle Muster, die Lay im k. k. Museum abreissen liess, ebenso gut auch unter den Slaven auf der Balkanhalbinsel vorkommen können, ja noch manche andere, z. B. italienische und altdeutsche, griechische und rumänische. Wer auf der Balkanhalbinsel ursüdslavische Stickmuster sucht, wird leicht unter hundert Mustern neunundneunzig und ein halbes fremdes finden. Stickmuster wandern von Volk zu Volk noch rascher als Sagen und Märchen. Einen prächtigen Beleg hiefür bietet ein bosnisches Guslarenlied meiner Sammlung dar.
Die Geschichte spielt vor etlichen 250 Jahren. Fähnrich Komjen im Küstenlande erfährt, dass dreissig der schmucksten Türkenmädchen aus den edelsten
- 71 -
Grenzraubritterburgen an einem bestimmten Tage auf dem grünen Plan vor Udbina zum Reigentanz sich versammeln werden. Darunter auch seine Herzliebste, Ajkuna, das einzige Schwesterlein des Rottenhauptmanns Mustaphaga Hasenschartes mit dem Schmerbauch. (Den dicken Bauch hatte natürlich Mustaphaga.) Komjen muss zu seiner Flamme, dem Edelfräulein Ajka, das so kühn, verwegen, mutig, listig und trotzig ist, als ob sich siebenundsiebzig Džins in ihrem Leibchen häuslich eingerichtet. Für Schäferstündchen würde ich mir zwar ganz wie Lay eine zahme Balleteuse mehr loben, und Komjens Wahlgenosse, Hauptmann Ivan, mochte schon dazumal einen dem unserigen nahe verwandten Geschmack gehabt haben; denn als ihn Komjen aufforderte, mit ins Grenzgebiet auf die Mädchenschau zu ziehen, lehnte er aus dreimal siebenundsiebzig triftigen Gründep ab. Er mochte für ein kurzes Vergnügen sich keiner langen Gefahr aussetzen und erklärte zuletzt mit aller Entschiedenheit eines Helden, der fern von Hieben und Schüssen. seine Haut am sichersten geborgen weiss, dass er nicht um alle Türkenmädchen der Welt die Kosten der Neugierde seines Freundes mitbestreiten könne. Doch Komjen setzt ihm unbeirrt zu:
Oba ćemo na krajinu snići
i vidjeti curâ u krajini.
Ajd Ivane ako Boga znadeš!
Ja ću ići pa ća du ne doći;
ja ne mogu srcu odoljeti,
da ne vidim Rnjičine Ajke!
Kadar ne ćeš ići pobratime
daj mi svoje gjuzel odijelo,
daj mi svoje a naj tebi moje;
jer sam curam davo odijelo,
probacivo njima kros pendžere;
Daj mi brate maća ledenika,
daj mi svoga a naj tebi moga;
na njem ima veza svakojaka,
Jesu š njega gjergjep uzimale.
Daj mi svoju dugu granaliju,
daj mi svoju a naj tebi moju,
jer sam i nju curam probacivo,
Jesu s puške gjergjep počinjale.
Daj mi brate ćurak i dolamu,
daj mi svoju a naj tebi moju.
Daj mi brate kalpak i čelenke,
daj mi svoga a naj tebi moga;
poznaće me turci po odjelu.
- 72 -
Selbander wollen wir ins Grenzgebiet
und in dem Grenzgebiet die Mädchen schauen.
Folg mir, Johannes, so an Gott du glaubst!
Ich geh, und sollt ich nimmer wiederkehren;
ich kann nicht meinem Herzen widerstehen,
um Hasenschartes Ajka nicht zu sehen!
Und magst du nicht, mein Wahlgenosse, gehen,
so gib zumindest mir dein Festgewand,
du gib mir deins und nimm dafür das meine;
ich pflog mein Kleid den Mädchen hinzugeben
und durch die Fenster ihnen zuzuwerfen.
Gib, Bruder, mir den Venezianersäbel,
gib mir den deinen, nimm dafiir den meinen;
auf meinem ist gar mancherlei Geranke,
davon entnahmen sie zum Sticken Muster.
Gib noch dazu dein langes Schmuckgewehr,
gib deines mir und nimm dafür das meine,
ich pflog auch das den Mädchen zuzuwerfen.
Sie nahmen vom Gewehr zum Sticken Muster.
Gib, Bruder, auch den Pelzrock und die Jacke,
gib deinen her und nimm dafür den meinen.
Gib, Bruder, mir den Helm und auch den Helmbusch,
gib deinen mir und nimm dafür den meinen;
die Türken würden mich am Kleid erkennen.
Der Fall ist gar so treu dem Leben abgelauscht, dass eine
Erdichtung des Guslaren ausgeschlossen erscheint. Die Mädchen nahmen allezeit, um ihrem Nachahmungtrieb, ihrer Eitelkeit und Putzsucht genug zu tun, Stickmuster, wo sie deren nur habhaft
werden konnten. Die Waffen und die Kleidung der christlichen Grenzritter jener Zeit waren so gut wie ausschliesslich italienische und deutsche Erzeugnisse, wofür man ausreichend Beglaubigung hat. Wenn dagegen Vid Vuletić Vukasović in seiner Schrift über serbische Volkstickereien und Häklereien (Srpski narodni vezovi, Belgrad 189¹) just aus Udbina nur höchst unvollkommene und minderwertige Muster beibringt, so hat man zu bedenken, dass das Bauernmädchen, von dem er die Muster erhalten hat, ein unwissendes Tschaperl ¹) ist, das nichts rechtes gelernt hat und dessen Unfähigkeit keinen Schluss auf die Mehrheit der serbischen Bäuerinnen gestattet. Südslavinnen sticken im allgemeinen ebenso zierlich und gefällig, wie in deutschen Landen Mädchen in gleichen Verhältnissen.

- 73 -
Verehrtester Leser! Ich befürchte, den Stickrahmen deiner Geduld zu zerbrechen, dessen ich noch notwendig für den Bericht über Krek benötige, unterstünde ich mich, dir auch über die böhmischen Korallenfabrikanten auf dem Gebiete der Sitten und Bräuche der Völker und besonders über die Leistungen der Reiseabenteuerfabrikanten Meldung zu tun. Geduld überwindet Sauerkraut, Geduld bricht Rosen, Geduld ist eine Pandora im höheren Sinne, meint Goethe, ¹) Geduld ist die Pforte der Freuden, sagt Jacob, ²) und F. Gh. Weiszer widmete ihr gar ein Epigramm:
Geduld ist eine Kunst, und eine von den schweren;
Die Weiber können sie nicht lernen, aber lehren.
Garve hat zum Überfluss im I. Teil seiner Versuche (Breslau 180²) sich in einer grösseren Abhandlung über die Geduld versucht. Ich habe mit Geduld das alles und etwas mehr über die Geduld gelesen, und spreche aus innerster Überzeugung, wenn ich dir gestehe, dass nach meiner Auffassung Geduld nichts als Papier ist. Was z. B. für grässliche und schaudererweckende Abenteuer mutig und todverächtig zu Papier bestanden werden, schillert schon ins Aschgraue. Gewalzte Stahlschienen hielten solche Belastung nicht aus! Abenteuer sind meine Achillesferse; denn wenn man mich an dieser verwundbaren Stelle kitzelt, gruselt es mich. Es hat mich schon öfter gewundert, dass manchem, so z. B. dem Herrn Philipp Felix Kanitz, quartbändeweise die spannendsten und merkwürdigsten Abenteuer im Serben- und Bulgarenlande zugestossen, mir jedoch auf meinen Reisen im Süden nicht ein einziges; vielleicht weil ich ein Freitagkind bin und mir daher die Gabe des zweiten Gesichtes versagt ist. Um so eifriger bin ich auf abenteuerliche Reisebeschreibungen erpicht, aber ich muss auch der Wahrheit gemäss bekennen, dass ich, obwohl mir Kanitzs Bücher vielen Genuss gewähren, doch immer noch lieber zu Gullivers Reisen greife, die Jonathan Swift, der berühmtere englische Vorläufer unserer Kanitze, der wissenschaftlichen Welt zum Nutz und Frommen veröffentlicht hat.

- 74 -
Über die Winkelkonkurrenz sind nicht viel Worte zu verlieren. Diese Kleingewerbetreibenden im Götter- und Mythenfache schädigen zwar durch ihre Aufdringlichkeit und Maulmacherei die Fabrikanten und Grossisten und zwicken ihnen viele Provinzkundschaften ab, doch vermögen sie trotzdem auf keinen grünen Zweig zu kommen. Ich meine damit jene Kategorie Kleingewerbetreibender, die mehr Händler oder Budikker der Korallenfabrikation, mehr gelegentliche Inshandwerkpfuscher ohne Befähigungnachweis, denn wirkliche Erzeuger sind.
Der mit Hochdruck arbeitende Korallenfabrikant ist dem böhmischen Korallenbudikker in der Regel durch seine kommerzielle Routine und Übersicht, durch kaufmännischen Mut und rücksichtlosen Spekulationgeist überlegen und daher unbedingt für den Weltmarkt leistungfähiger. Er wird durch eine gewisse An- und Zusammenfassung des Geschäftbetriebes, in Reichhaltigkeit der Auswahl, in prompter Bedienung, in Beschaffung neuer, in die Augen stechender Nuancen böhmischer Korallen, den wechselnden Anforderungen des unbeständigen Geschmackes eines p. t. Publikums durchaus mehr bieten, als der Korallenverschleisser, den der Beginn seiner Karrière mit journalistischen Kehrbesen und literarischen Wickelkindern für die fieberhafte Hausse und Baisse auf der Götter- und Mythenbörse nicht geschult und nicht gestählt hat.
Von den Kleingewerbetreibenden im slavischen Süden wären zu nennen z. B. die Serben Bogoljub Petranović, Beg Kapetanović, Spiridion Gopčević, der Ehrabzwicker Vrhovac, Grčić, Zovko, die Kroaten: M. Kišpatić, Vjekoslav Klaić, Śime Ljubić, Koch-Kuhač, Tade Smičiklas, Urliö-Ivanović u. A. Sie sind unter Umständen Zuträger und Helfer, aber nur für späterhin auftretende Götterengrosfabrikanten, die ja, wie wir es erfahren haben, Vorarbeiten zu verwerten wissen. Im übrigen ist die Ware jener meist schlecht und schleuderhaft, und allein oberdachlings Überfallene Kundschaften lassen sie sich aufdrängen.
Von den obgenannten dürftest du, deutscher Leser, nur den Herrn Spiridion Gopčević kennen und ihn auch von der Siegerischen Beurteilung im „Ausland” (Nr. 23 von 1890) her im Gedächtnis haben. Im Kampfe mit seinem zähen Widersacher und antischämistischen Gesinnunggenossen, dem
- 75 -
„Schriftleiter” des Wiener antischämistischen Mordbeils, Herrn Hron, führte Gopčević die Tatsache ins Treffen, dass er „über mehr als 300 lobende Zeitungausschnitte aus Europa und Asien” verfüge. Wenn das Sieger, Gopčevićs Rezensent im „Auslande” gewusst hätte! Sieger hat als Geograph die Leistung Gopčevićs förmlich in Seifenblasen aufsteigen lassen, aber, seltsam genug, den Mythenfabrikanten Gopčević keiner Silbe gewürdigt. Das ist mehr als eine Ungerechtigkeit, das ist schon eine Sünde; denn Gopčević ist, obwohl nur Dilettant, doch auch in Göttern und Mythen gleich tüchtig. So hat er unter anderen die Mythe in die Welt gesetzt, Makedonien sei von lauter Serben bevölkert, wofür ihm die serbische Regierung, wie er behauptete, wofern auch dies nicht eine Mythe ist, 20.000 Fr. Subvention gewährt haben soll. Seine wissenschaftliche Methode ist einfach und probat. Er sagte sich ohne langes Überlegen: das Sippenfest (krsno ime) ist ein ausschliesslich serbisches Fest. Mit diesem Leitmotiv auf der Walze unternahm er seinen Entdeckungzug. Während seiner Forschungreise, die er, ein Freund und Förderer moderner Kulturerrungenschaften, nur mit der Eisenbahn gemacht, stieg er an vielen Haltstellen aus und sah sich vom Perron aus die bulgarische Welt an; mehr brauchte er nicht, da er alles übrige bei Ami Boué und Hahn gedruckt vorfand. Traf es sich, dass er einen Bauer oder eine Bäuerin auf dem Perron erblickte, so verwickelte er selbe Persönlichkeit in folgendes, beiläufig stereotype Gespräch:
Gopčević: Bist du ein Bulgare (bezw. eine Bulgarin)?
Der Bauer: Ja, Herr, ich bin ein Bulgare, was denn?
Gopčević: Von wannen bist du?
Der Bauer: Die ganze Welt weiss, dass ich von da und da bin, woher denn sonst?
Gopčević: Feierst du das Sippenfest?
Der Bauer: Na, wie würd ich denn unser Sippenfest nicht feiern?
Gopčević: Also bist du ja ein Serbe. Nicht wahr?
Der Bauer: Aber Herr, ich bin doch ein Bulgare, wie kann ich denn ein Serbe sein?!
Gopčević: Lass dich nicht auslachen. Du bist und bleibst
ein Serbe. Man hat dir nur in der Schule eingeredet, dass du ein Bulgare bist.
Sprachs, liess den Bauer in seiner Verblüffung stehen, und
fahndete nach weiteren Opfern.
- 76 -
Zehn bis zwölf Jahre lang betrieb Gopčević als rechtschaffener Kleingewerbetreibender sein Korallenfach und machte mit seinen wunderlichen Erzeugnissen die Spalten zahlloser politischer und belletristischer Blätter in Österreich und Deutschland unsicher. Er sammelte dabei ein Barvermögen von 27.000 Gulden. Nach seinem letzten Bulgarenwerke und dem Sieg über Hron, der ins unbekannte Ausland floh, um einer Kerkerstrafe sich zu entziehen, entschloss er sich, die Korallenfabrikation en gros zu betreiben. Er borgte seiner ledigen Schwägerin die Mitgift im Betrage von 8000 Gulden ab, kaufte die in den letzten Zügen liegende „Gemeindezeitung” für bare 12.000 Gulden, und gab sie als eine antischämistische Brandfackel unter dem Titel „Wiener Tagespost” täglich zweimal heraus. Binnen drei Monaten war ihm der Nervus rerum ausgegangen. Zuletzt musste er sogar seine Möbel verschleudern. Seit zwei Jahren ist „Gopčević” verschollen. Aus einem Adressbuche ist zu entnehmen, dass er unter einem italienisch klingenden Namen noch vegetirt.

Überblicken wir die gegenwärtige Gestaltung der Marktlage, so stehen bei uns die Erzeugnisse der Götter- und Mythenfabrikanten al pari, wenn es gut geht, aber es geht nicht mehr. Der Markt ist mit Göttern und Mythen überschwemmt und die Kauflust des übersättigten Publikums ist unterm Gefrierpunkte. Zur Orientirung notire ich noch die Schlusskurse der auswärtigen Folklore-Börsen:
London (Orig. Ber.): Tendenz lau, Götter flau, Mythen matt.
Paris (Orig. Ber.): Korallen brach,
Berlin (Orig. Ber.): In Göttern Krach.
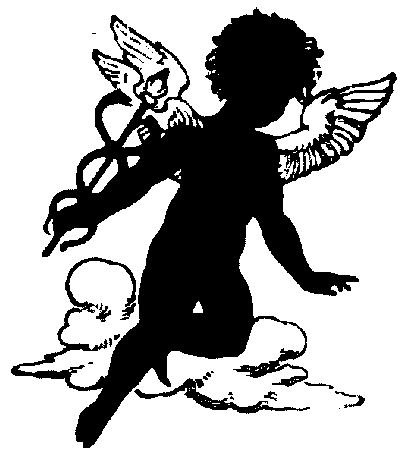

Böhmische Korallen aus der Götterwelt
II
Kollege -d- , Specialberichterstatter der Wiener Weltpauke, weilt täglich im Merkurtempel am Schottenringe, um über den schwankenden Stand und die ständige Schwankung des Gold- und Effektenverkehrs Ein- und Ausdrücke zu empfangen. Von Beruf ist er ein verfehlter Finanzminister. Ich wollte, ich hätte das Geld, das er und andere Börsebesucher gut brauchen könnten. Die Börse ist eben reich an armen und arm an reichen Leuten.
Vor nicht langer Zeit verschwor sich ein Krätzl Sumsenbacher zu einem grossartigen Fischzug, der die Börse aufs Maul legen musste, wenn sich Merkur als Spitzbubenbeschützer bewährte. Die Fangnetze waren ausgeworfen, die Imtrübenfischer standen auf der Lauer, keinem Fremden schwante etwas von Sturz und Ungewitter. Doch Kollege -d- schnüffelte den Braten auf. Eine, zwei, drei Millionen waren für ihn mit anderer Leute Haut zu „verdienen”, er durfte nur reinen Mund halten und mittun. Heute noch Berichterstatter - mein leibhaftiger Dalesnik ¹) - morgen schon ein Millionär, übermorgen Baron, Überobermorgen Abgott für den dummen Kerl von Wien.
Wem der Kopf mit Ehrlichkeit verschalt ist, gegen den kämpfen selbst Sumsenbacher vergeblich. Kollege -d- setzt sich hin, und schreibst du nicht, hast du nicht! Das nächste Morgenblatt enthielt den spiessigen Marktbericht mit dem enthüllten Sumsenbacherplan. Als -d- um die Mittagstunde auf der Börse erschien, drängten sich die Sumsenbacher an ihn heran, und drängelten ihn aus der Halle hinaus.
- 78 -
Irgend etwas musste ja geschehen, und als es geschehen, wusste man, wer sich mit dem Schaden allein nicht begnügen wollte. Das Wiener antischämistische Mordbeil überschlug sich vor Jubel über „die dem Juden widerfahrene Züchtigung”. Es stand da noch manches Erquickliche über den „zersetzenden Einfluss des Judentums” zu lesen, und mit Wonnegeheul begrüsste das Mordbeil die Kundgebung der „besseren Elemente” der Börse.
Kollege -d- grämt sich darüber gewiss bis zum Unterfutter. Durch seinen Bericht sahen sich etliche Sumsenbacher in ihrer mühevoll aufgepäppelten Hoffnung, über Nacht leicht sich zu bereichern, um einen Tag zu früh verraten. Blos einigen tausenden kleiner Kapitalisten war das Vermögen gerettet. Darum also heisst jener „ein jüdischer Naderer Schwindler, Angeber, Spitzel” u. s. w. Bis dahin liess man ihn für einen Berichterstatter gelten, jetzt aber hat er das Vertrauen der massgebendsten Sumsenbacher für immer sie verscherzt. Kollege -d- besucht indessen nach wie vor die Börse; denn von Sumsenbachern angefallen und hinausgedrängt werden, bedeutet durchaus nicht: von der Börse ausgeschlossen sein.
Patentpatrioten und Konschnorrten beehren auch mich mit nicht viel schmeichelhafteren Titulaturen, der ich über die Schach- und Winkelzüge der böhmischen Korallenfabrikanten auf der Folklorebörse zu berichten pflege. Es ist nicht meine Pflicht, deren leeres Stroh zu dreschen, das besorgen sich die Herren selber, dir aber, lieber Leser, will ich reinen Wein einschenken. Nach meiner Witzigung sind gewisse Götter- und Mythenfabrikanten ebenso gefährliche als gemeinschädliche Parasiten der Gesellschaft, in der sie auftauchen Sie erzeugen leidenschaftlichen Hass gegen altüberkommene, selbst gegen segenreiche Einrichtungen, richten Verwirrung in noch beschränkteren Köpfen an, säen Zwietracht und Hader, Misstrauen und Dünkelhaftigkeit aus, kurzum, sie verhetzen, zersetzen und zerfetzen die Gesellschaft, auf deren Kosten sie sich ätzen. Woran ist hauptsächlich das Wirken der gedachten Korallenfabrikanten untrüglich zu erkennen? An der epidemischen Dummheit, die in den breitesten Schichten der Bevölkerung zu grassiren anfangt, an dem plötzlich steigenden Bierverbrauch, an der wässerigen Redesucht, die viele sonst unschädliche Leute lebensgefährlich ergreift, sowie letzlich an der
- 79 -
eiffellhurmhohen Begeisterung für Rosswürste, ¹) die von dunklen, wohltätigen Gewalten gratis verabfolgt werden.
Spricht ein Berichterstatter davon, so fallen sie ihn an wie eine kläffende Meute. Das ist wirklich nicht schön von ihnen. Was will ein Berichterstatter? Ist er nicht bestrebt, das seit Alters her Bestehende in Schutz zu nehmen ? Ich selber meine auch, dass wir schon übergenug unter dem altehrwürdigen Aberglauben zu ächzen und zu seufzen haben und keine Neuanschaffungen dringend benötigen.
Mein geschätzter Leser! Aus Übermut wird keiner Marktberichterstatter. Das steckt im unruhigen Blut. Ich hätte Ehren und Würden und gute Versorgung erreicht, wäre ich mit meiner Feder in den Liebedienst der Patentpatrioten und Götterfabrikanten getreten. Manches Leid hatten Sumsenbacher über mich ausgegeisselt, um mich zu kirren, ich blieb aber trotz alledem Marktberichterstatter. Der Gott meiner Urväter liess mich nie verzagen; er gab mir frohen Mut und leichten Sinn, ein fröhlich Gemüt und Bedürfnislosigkeit, so dass ich wie von einer festen Warte aus, zu meinem und deinem Vergnügen die Pfeile meiner heiteren Laune auf die aberwitzigen Korallengötterfabrikanten abschnellen darf. Man wird dir zuraunen, dass ich bei den Götterfabrikanten nicht beliebt bin. Ja, wenn die Esel Hörner hätten! Der ergrimmteste Götterfabrikant spielt im günstigsten Falle die Rolle eines modernen Ajaxerls. Er ist nur so lange fürchterlich als man ihn fürchtet, meist kann er nicht beissen.
Faulheit und Feigheit sind, wie Kant einmal hätte sagen können, die Ursachen, warum ein grosser Bruchteil der Menschen zeitlebens gern Sumsenbacher bleibt und warum es böhmischen Korallenfabrikanten so leicht wird, mit ihrer Bofelware die Menge sündhaft zu bemogeln. Zu einer eingreifenden Änderung der Sumsenbacherei, mag sie auch mit Schnecken-Eilzuggeschwindigkeit vor sich gehen, ist nur die Freiheit nötige von seinem vernünftigen Mutterwitz in allen Stücke öffentlich Gebrauch zu machen. Der Glaube, dass den Menschen die Freiheit von selber komme, und der Freischärler der Freiheit, nur Ehre ohne Püffe und Stösse einheimse, ist auch eine böhmische Koralle.
- 80 -
Seit vielen Jahren lasse ich es mir mit Fleiss und Eifer angelegen sein, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Produkte der böhmischen Korallenfabrikanten hinzulenken. Ich habe mir mittelbar geradezu Verdienste um die Popularisirung einiger Göttererzeuger erworben, aber statt Dank ernte ich für meine Mühewaltung just von jenen, die es am meisten angeht, Schmähungen und Drohungen ein.
Wozu diese weit ausgeholte Einleitung?! Nur Geduld, du wirst es gleich erfahren. Ich habe mich für den Götterfabrikanten Krek aufs wärmste ins Zeug gelegt, und, weisst du, wie er mirs gelohnt hat?
Davon muss ich dir erzählen. Angenehme Unterhaltung!
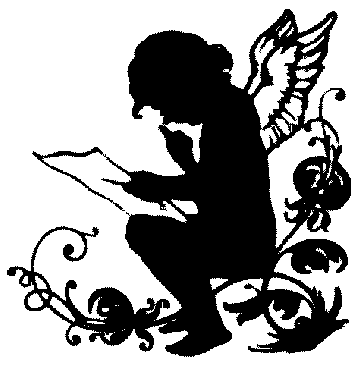
Im October d. J. 1888 schrieb mir der Redakteur der Zeitschrift f. vergl. Lit. und Renaissancelit. Herr Dr. Max Koch, Prof. an d. Univ. Breslau, ein launig Briefchen, worin er mich dringend bat, das Buch des Herrn Dr. Gregor Krek, o. ö. Prof. f. slav. Philologie an d. Univ. Graz, einer gründlichen Besprechung zu unterziehen. Vor einem Jahre habe ihm Krek das Buch mit der Bitte um ein ausführliches Referat zugesandt und er (Koch) habe es einem Fachmanne weitergegeben,
doch Ross und Reiter sah man niemals wieder.
Seit einigen Monaten dränge und martere ihn Krek unaufhörlich wegen der Besprechung, so dass ihm der Knabe schon fürchterlich zu werden anfange, und nun in der Klemme hoffe er pro primo, dass ich ein Exemplar Krekischer Manufaktur besitze und pro secundo, ihn nicht im Jammer vergehen lassen, vielmehr ihm mit beschleunigter Geschwindigkeit ein sehr langes Referat abliefern werde, damit ers ohne Verzug abdrucke.
Zu einem feinen Kraut- oder Topfenstrudel und einem lustigen Kumpan kann ich nicht „nein” sagen. Darum briefelte ich sofort zurück, beiläufig also: „Nicht gerne folge ich Eurem Rufe, doch es ist Euer Liebden erstmaliger Wunsch, und nun und nimmer möchte ich, wie eine taube Flinte gleich das erstemal versagen. Mit Ausreden wäre ich zwar versehen, sintemalen ich pro primo, Kreks Buch schon vor einem Jahre in den Mitteilungen der Wiener Anthropolog. Gesellschaft
- 81 -
angezeigt und pro secundo, weil mir eine neuerliche Besprechung etwas beschwerlich fällt Indessen dominatio fiat uoluntas tua!
Nicht gerne! Als Berichterstatter vieler wissenschaftlicher und Tagblätter und leider auch als Herausgeber einer Monatschrift für Volkkunde (kostet ganzjährig 4 M.) habe ich die gewalttätigen Lobschnorrer - denen man den Herrn Krek natürlich nicht beizählen darf - mehr als genug ausgekostet. Wenn einer jeden Tag nur Gugelhupf essen muss, wird er selbst des Gugelhupfessens überdrüssig. Nun sind aber die Lobschnorrer etwas unverdaulicher; denn sie wollen nicht unterrichtet und nicht belehrt, nur gelobt und gepriesen, bewundert und angestaunt, angedudelt und angestrudelt wollen sie sein Redakteur und Referent sind Leuchttürme der Literatur, Zeiger der Kulturuhr, weit in die fernste Zukunft blickende Hellseher, sofern sie brav die Winke des Lobschnorrers befolgen, wo nicht, so verhöhnt er sie: „Tintenjuden, erbärmliche Zeitungsclaven, die man in massgebenden Kreisen schon längst nicht mehr ernst nimmt,” und belegt sie auch sonst mit allerlei Beinamen und Auszeichnungen, die man auf keine Visitkarte setzen mag.
Mehr aus Mitgefühl für die peinliche Lage meines journalistischen Kollegen in Breslau als aus einem inneren Triebe ging ich also zur Hausbesorgerin hinab, holte mir den Bodenschlüssel und stieg 130 Stufen hinan zu meiner Abteilung. Fünf Kisten alter, abgelegter Bücher liegen da aufeinander, jede über einen Zentner schwer. Eine nach der andern musste ich herabheben - eine schweisstreibende Arbeit - und erst in der fünften zu Grunde lag friedlich neben Falbs Incareich Kreks Buch. Dann türmte ich die Kisten wieder aufeinander, schloss den Boden ab und kehrte abgemüdet und bestaubt in die Wohnung herab. Ja, die wenigsten Leute ahnen, wie sauer und hart das Brod des Marktberichterstatters ist! Den abverlangten Bericht verfasste ich in kürzester Frist; denn ich schreibe mit Leichtigkeit, zumal wenn ich heiterer Stimmung bin. Prof. Koch dankte verbindlich „für die sehr willkommene Arbeit” und veröffentlichte sie gleich ohne Aufschub sechzehn Monate später in seiner Zeitschrift (B. III. 1890. S. 377-388).
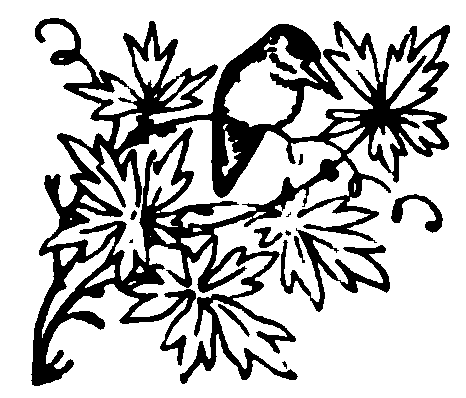
- 82 -
Ein Berliner Büchermarktberichterstatter spricht sich im Literarischen Merkur (IX. 27. S. 213) über Bücher und Bücherkritik so aus:
„Die Erscheinung, dass auch unter den geistigen Geburten eine erkleckliche Zahl von Fehl-, Miss- und Totgeburten sich findet, hat an sich nichts Auffallendes; sie ist ein ins Geistesleben übertragenes Naturgesetz der Entwicklung. Aber während man z. B. einem totgeborenen Kinde ansieht, was es ist, während man es sofort geräuschlos begraben lässt, während die betrübten Eltern öfter in diesem Falle sogar die Geburtanzeige - sie wäre ja eine Lüge - ängstlich vermeiden, pflegt es bei den geistigen Erzeugnissen etwas anders zu sein. Hier werden krankhafte Ausgeburten oft als gesunde Geisteskinder angepriesen, verwesende Totgeburten verpesten die Atmosphäre des Geistes; denn der Totengräber Zahl ist zu gering. Hierin liegt die Ursache ebensowohl der Urteillosigkeit so mancher Kreise, als des sinkenden Geschmackes ....”
Totengräber! Schauerliches Wort, das die traurigsten und trübsten Wehgedanken erweckt. In früheren, gemütlicheren Zeiten sprach man wohl von literarischen Totenrichtern. Das liess sich hören. Es gibt lebendigtote und tote lebendige Schriftsteller; der eine Kritiker zieht die, der andere jene vor die Schranken. Der eine liebt den Pfarrer, der andere mehr die Pfarrerköchin. Doch auch das Totenrichteramt würde mir nie behagen, denn es ist ein Kampf mit Schatten an der Wand. Der Arm ist kräftig, der Hieb wuchtig, der Erfolg nichtig. So hilft auch das viele Reden über ein Buch nicht viel. „Die Rechten verstehen schon Winke, die Schlechten wollen nicht hören, und die Dummen (Sumsenbacher von Geburt) verstehen alles links”, behauptet ein alter Kritiker.
Als Referent war ich mein lebelang ein teilnehmender Berichterstatter, der mit seinem Beileid nicht kargt. Meine Berichte überströmen von Wohlwollen und milder Nachsicht für jeden, den das Schicksal mit der Sucht des Bücherschreibens behaftet hat. Ich habe schon manchen wackern Büchermann zu Tode gelobt, und Lob verpflichtet zu nichts. Mein Vorbild hierin ist Humboldt, der auch alles für gut und schön befand. Einmal stellte ihn ein Stutziger zu Rede, wieso er denn das und das minderwertige Werk so auffallig gelobt. Erstaunt erwiderte Humboldt: „Ja, habe ich jemals irgend jemand
- 83 -
nicht gelobt?!” Geheimrat Ritter Vergilius von und zu Andes setzte sogar einen Tugendpreis auf ausgiebige Loberhebungen aus, indem er erklärte:
Est uirtutis opus famam extendere factis.
Jedes Buch ist ein Factum, von dem kein Rezensent eine Silbe abmäkeln kann. Darum wirkt das von gewissen gepfefferten Kritikern geübte Absprechen und Verdammen beleidigend, und nicht blos auf den Buchverfasser. Einer sagte: „Nur der ist zum Tadel, zur scharfen Kritik berechtigt, der zuvor ausspricht, was erreicht und geleistet worden ist.” Goethe meint aber: „Wenn man mit einem Buch an einen Kopf schlägt und es klingt hohl, muss nicht immer das Buch hohl sein.” Ich denke, am besten ists, ein für allemal zu loben und dazu etwas Tadel, wie Senf zum Fleisch, beizumengen. Ob ich viel aussetze, bessere und rüge, was alleweil lästig empfunden wird, schreibe ich mir lieber selber ein Buch nach eigenem Geschmacke und schaffe ein neues Factum. Zum Fiaker Staudinger sprach sein Berufgenosse Fenstaschwitz: „Geh, Freunderl, nimm mein' Sepp in d'Lehr' und besser' mer eahm. I kumm scho nimma auf mit dem teppschädlichten Buab'n!” Staudinger abwehrend: „Wasst, mein liaba Fenstaschwitz, ob i an' sulch'n talketen Buab'n besser', ehender mach' i selber drei neuche!”
Anspruchlos, wie ich schon bin, begnügte ich mich, Kreks Buch zu loben, dass die Schwarten krachten.

Vom gedruckten Referat erhielt ich zwölf Abzüge. Einen sandte ich an Kreks Verleger, einen anderen an Kreks höchsteigene Adresse, einen nach Marburg i. H., einen nach Weimar, einen nach Warschau u. s. w., zwei behielt ich mir vorsorglich für unvorhergesehene Nachlassenschaftordner zurück. Alle bestätigten dankend den Empfang, nur nicht Kreks Verleger und des Verlegers Krek nicht. Auf einmal schreibt mir Herr Prof. Koch, er habe von Krek wegen meiner Besprechung eine Zuschrift bekommen, die ihn mit Bekümmernis erfülle. Krek sei wütend geworden und werde mir entgegnen. Er (Koch) wolle die Erwiderung Kreks drucken
- 84 -
lassen und mir in der Fahne übermitteln, damit ich das letzte Wort behalte und den Fall beilege. „Ist mir auch recht,” antwortete ich. „In Ihre redaktionellen Angelegenheiten menge ich mich nicht hinein. Wie Sie wollen, will ich auch.” Fiat stultitia, pereat immundus!
Nach einigen Tagen läuft von Prof. Koch Kreks „Abfertigung” für mich ein, zwei gleichlautende, 70 cm. lange Bürstenabzüge in Perlschrift. Ich lese und lächle, und wie ich zu Ende gelesen, breche ich in ein schallendes Gelächter aus. Das helle, sorglose Lachen, das auch den Trübsinnigen aufheitert, habe ich von meiner Mutter her. Bei der Premiere von Paillerons „Welt, in der man sich langweilt” überfiel mich z. B. unversehens die Lachlust, und sie ergriff alle Zuhörer derart, dass selbst die Schauspieler mitlachend ihr Spiel fast unterbrachen.
Mein greiser Vater hört mich so lachen und tritt auf mich zu : „Nun, Fritz, du fängst schon in aller Früh froh an. Lass mich doch auch hören, was dich so aufmuntert.”
Götter erfinden kann ich zwar nicht, aber mit Betonung und Nachdruck vorzulesen und vorzutragen habe ich erlernt trotz einem Komödianten. So trug ich denn die „Abfertigung', vor, fünf Minuten ganz Krek.
Meinem Vater schwoll vor Zorn die Stirnader an. „Weisst du, mein Sohn, ich finde diesen Aufsatz gar nicht spassig. Das ist eine beispiellos niedrige Schimpferei. Das sind Reden, wie man sie kaum einem betrunkenen Gassenkehrer zutrauen möchte. Und das soll der Prof. Krek geschrieben haben?! Das kann ich nicht glauben. Ein gebildeter Mensch vergisst sich nicht so. Dein Breslauer macht sich offenbar mit dir einen Jux. Solche Schmäh- und Schandreden sind aber ein schlechter Jux.”
„Du täuschst dich, Vater. Das ist nur ein Auszug aus Kreks Buch, der kondensirte Krekische Styl, Kreks Leib und Leben Das ist so echt, dass es nicht nachgemacht werden kann.”
„Warum schimpft und lästert er dich so abscheulich?”
„Weil ich ihn in der Besprechung zu wenig gelobt habe.”
„Hättest ihn mehr loben sollen. Was ist dir daran gelegen gewesen? Ich hätte ihn gelobt, bis er an Lob erstickt wäre, aber zusammenschimpfen hätte ich mich nicht lassen.”
„Schau, Vater, du verlangst unmögliches. Soviel Lob als ein Krek verträgt, habe ich gar nicht auf Lager. Durfte
- 85-
ich denn meinen ganzen Vorrat für ihn verschleudern? Ich habe ja noch Kundschaften, die ich mir nicht vertreiben will.”
„Du weichst, Fritz, meiner Frage aus. Warum schimpft er wie ein Rohrspatz? Ich frage dich auch, wirst du dir das gefallen lassen?”
„Weil es ihn so freut. Man weiss ja, dass derjenige, der verliert, namentlich je tiefer er im Unrecht steckt, gewöhnlich um so grässlicher Gewalt schreit und schimpft. Deshalb hat man ja in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten das Schimpfrecht des Verlierenden für straflos erklärt, so z. B. bei unseren Urvätern im heiligen Lande, bei den Egyptern, den Griechen und Römern der klassischen Zeit, bei den Türken bis in die Gegenwart, bei den Südslaven und vollends bei den Nord- und Südamerikanern.” ¹)
„Das sind Narreteien. Du brauchst deine Ehre von niemandem beschimpfen zu lassen. Im Leben wird nur der respektirt, haben unsere weisen Vorfahren gesagt, der sich keinerlei Ungerechtigkeit gefallen lässt. Mir hätte das einer sagen sollen, wie ich noch in deinen Jahren war, der hätte mir vor Gericht Red' und Antwort stehen müssen, und wäre der Richter bestochen gewesen, würd' ich mir selber Recht verschafft haben. Ich sage dir, dies Gebelfer darf nicht gedruckt werden.”
„Vater, ich bitte dich, ereifer dich nur nicht. Dem Krek ist vielleicht die Ehre eines andern Schnuppe, mir jedoch nicht. Eleaser Ben Parta, auch einer unserer Weisen, meinte anders: „Die Art der Israeliten ist es, entweder Schriftsteller oder Schwertträger zu sein: beides zugleich ist unmöglich. Bin ich nun ein Schwertträger, so bin ich wohl kein Gelehrter.” Ich bin kein Schwertträger. Kreks „Abfertigung” soll just gedruckt werden. Was wird sein ? Die Gelehrten werden einsehen, dass ich ihn zu viel gelobt habe. Doch will ich ein Übriges tun. Zum Beweis, dass ich mit der Drucklegung der „Abfertigung” einverstanden bin, werde ich eine gleichgiltige Bemerkung daran knüpfen. Damit wird die Sache erledigt sein.”
- 86 -
Meine Meinung kennst du. Mit der Ehre spasst man nicht. Geh zu Gericht. Magst nicht, so mach dir Kren mit roten Rüben ein.”
Mein Vater, Gott hab' ihn selig, verstand wirklich in solchen Dingen keinen Spass. Ich schwieg, las die Correctur berichtigte zwei Druckfehler, gab mein „Imprimatur!” dazu nebst einer kurzen Anmerkung, in der ich wieder Krek belobte und sandte das Zeug an Prof. Koch zurück.

Trotzdem ich in jedem modern gekleideten Menschen den zukünftigen Ur-Quell-Abonnenten erblicke, und daher weder hochmütig noch rauh bin, habe ich mir doch nicht die für den Verkehr mit Korallenfabrikanten notwendige Krokodilhaut anwachsen lassen. Nur mit Rücksicht auf Kreks Weib und Kinder, die durch eine gerichtliche Abstrafung ihres Ernährers tiefen Gram schuldlos erfahren hätten, nahm ich die ehrenrührigen und ehrabschneiderischen Ausfälle Kreks still und gelassen hin. Vergebung ist der Rache Wissenschaft. Zu Gericht laufen kann jeder, um sich seine Ehre auszubessern, doch eines Kreks wissenschaftliches Gedärme bloszulegen, ohne ihm die Aussicht auf Erlangung des Hofrattitels für immer zu verrammeln, ist mehr Ehre.
Ein Wiener Schneidermeister čechischer Confession verpfuschte mir einen Rock. Auf meinen sanften Vorhalt dass der Rock entschieden dem Rockideal entspreche, nur dass er zufällig mir im Rücken zu schmal und vorne zu kurz, dafür die Ärmel um eine halbe Spannweite zu knapp geraten seien und ich darum dem Besitze des Rockes mein für den Stoff ausgelegte Geld vorzöge, bemerkte der Meister der Nadel: „Das ist niederträchtig.” Um die Berechtigung dieser Kritik zu erfahren, wandte ich mich an das k. k. Bezirkgericht am Neubau. Da gab es Vorladungen, Verhöre, Einvernahmen von Zeugen und Sachverständigen, Appellationen und anderweitige Zerstreuungen, die damit ihren Abschluss fanden, dass der Meister dies Intermezzo mit einigen siebenzig Gulden für verschiedene Spesen zu bestreiten hatte. Soviel ich mich entsinne, erhielt ich 32 fl. 50 kr. ersetzt, für die Ehrenbeleidigung bezahlte jener blos 15 Gulden, für ungebührliches Benehmen vor Gericht 10 Gulden, der Rest ging
- 87 -
in Kleinigkeiten auf. Darauf überkam ihn eine gewisse traumhäuptige Stimmung, in der er seinem Lehrjungen schüppelweise die Haare ausriss und die angetraute Gesponsin und sein mit ihr in gesetzlicher Ehe gezeugtes Kind halb tot prügelte. Acht Tage später erschien die 55 jährige Matrone zerschunden und zerschlagen bei mir, hob - was ich ihr gerne verziehen hätte - die Kittel auf und zeigte die fingerbreiten Striemen auf ihren dürren Lenden. Ich begütigte die arme Person mit Geschenken, doch die empfangenen Keile behielt sie weiter. Bald darauf erschaute mich der Lehrjunge in einem Kaffeehause, las einen Stein auf und schleuderte ihn durch die Spiegelscheibe auf mich. Die teuere Scheibe war hin, doch ein Wachmann hielt auch schon den hoffnungvollen Jungen fest. Für das zerbrochene Glas musste der Meister blechen, der Junge bekam Arrest und ward polizeilich abgeschoben. Damals gelobte ich mir, nie wieder jemand wegen Ehrenbeleidigung zu belangen, selbst sollte mich einer beschuldigen, dass ich das goldene Kreuz vom alten Stefansturme abgebissen. Es braucht sich also Herr Krek auch in Zukunft keinen Zwang aufzuerlegen. Von mir aus geniesst er unumschränkte Schmäh- und Schimpffreiheit. ¹)
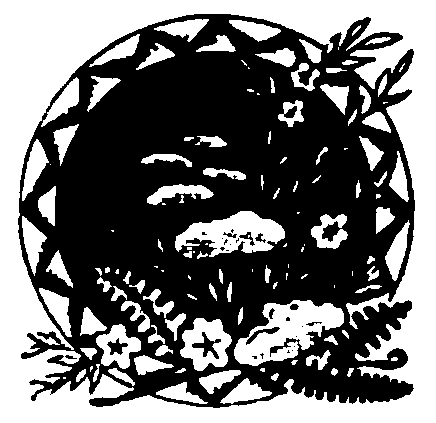
Drei Wochen später schreibt mir Herr Prof. Koch, er habe jede Beziehung zu Krek abgebrochen, die „Abfertigung” unterdrückt und die dem Briefe beiliegende Erklärung in Quart in mehreren hundert Exemplaren an Gelehrte versandt. Sie werde auch im 6. Hefte der Zeitschrift erscheinen.
- 88 -
Hoffentlich werde ich von dieser Lösung befriedigt sein. Die Erklärung erschien auch in Kürschners „Signalen aus der literarischen Welt” (S. 3731 f.) zur Stuttgarter Ausgabe der „Deutschen Nationalliteratur”. Sie sei hier wiedergegeben:
„Nach Ausgabe des letzterschienenen 5. Heftes der Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur erfuhr ich, dass zwischen Herrn Prof. Dr. Krek und Herrn Dr. Krauss persönliche Feindschaft bestehe. Ich erklärte mich Herrn Professor Krek zur Aufnahme einer sofortigen „Entgegnung” bereit und nahm auch die von ihm eingesandte „Abfertigung” trotz ihrer das Strafgesetz herausfordernden Schimpferei an, da Dr. Krauss' Objektivität durch sein persönliches Verhältnis zu Prof. Krek anfechtbar erschien. Professor Kreks Erklärung war bereits gesetzt und korrigirt, als der von der Reise zurückgekehrte Herr Verleger entschiedenen Einspruch erhob, dass diese nichts weniger als sachliche Erwiderung in einem Werke seines Verlages erscheine. Ich teilte Herrn Professor Krek dies Hindernis mit und machte ihm folgenden Vorschlag: Die Redaktion erklärt öffentlich, da die Unparteilichkeit des Herrn Dr. Krauss angefochten sei, eine zweite Rezension, deren Verfasser Herr Professor Krek selbst vorschlagen möge, im nächsten Hefte bringen zu wollen. Herr Professor Krek wies diese offene Erklärung als unmoralisch und unehrenhaft zurück, hält es aber für ehrenhaft, mich persönlich zu verdächtigen durch die Behauptung, der Einspruch des Verlegers sei von mir erfunden, um Dr. Krauss zu schonen. Er droht meine Briefe drucken zu lassen. Ich habe keine Veranlassung, ihre Veröffentlichung zu scheuen, wenn ich auch eine unautorisirte Drucklegung von Briefen moralisch und rechtlich unerlaubt finde. Jeder von persönlichen Beschimpfungen freien Entgegnung Herrn Professor Kreks steht die Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur offen; in eine weitere Polemik werde ich, nachdem Herr Professor Krek Drohungen und Verdächtigungen beliebte, mich nicht einlassen.
Breslau, 15. September 1890. Max Koch.”
„Nun, Vater, was sagst du jetzt?”
„Was ich schon einmal gesagt habe: Du hättest zu Gericht gehen sollen. Aber, willst du mir einen Gefallen erweisen ?”
„Und ob! Jeden.”
„Schreib deine Besprechung Kreks noch einmal um, er soll nicht sagen können, dass er doch sein Mütchen an dir gekühlt.”
„Muss das gleich sein? Mir scheint, Krek lauft mir nicht davon.”
„Du hast ja Zeit. Schreib nach tausend Tagen. Bist kein Schwertträger, bist ein Schriftsteller. Eine gespitzte Feder ”
„Gut.”

- 89 -
Mein Krek hat den Professor Koch in grossen Harnisch gebracht und ihm einen feisten Bären von einer Feindschaft aufgebunden, die zwischen ihm und mir bestehen soll. Betrachten wir einmal in aller Gemütruhe den Werdegang dieses Bären. Im Mai 1884, als ich auf meine Forschungreise nach dem Balkan auszog, hielt ich mich zwei Tage lang in Graz auf, um mir die Stadt und einige Gelehrte anzuschauen. Mit Krek hatte ich schon sozusagen angebandelt, da ich ihm mehrere meiner Schriften von Wien aus zugesandt und er mir jedesmal seine Anerkennung, Gewogenheit und Protektion brieflich kund und zu wissen getan. Mein Besuch war ihm recht genehm, er führte mich in seine literarische Wochenstube ein - ein geräumiges, lichtes, mit schön gebundenen Büchern gefällig austapezirtes Zimmer - und weihte mich in das Programm seines Lebenswerkes ein. Vor schwangeren Autoren und Frauenseelen hege ich seit jeher ein Gefühl zartester Rücksicht und Ehrerbietung, und so horchte ich andächtig dem Gesalbader Kreks zu, ohne blasse Ahnung, dass ich mich in einer Korallenfabrik befinde. Nach dem Privatissimum führte er mich zu Dumičić zu einer dalmatinischen Kneipweinkur, und wir stimmten alsbald in allen unseren Ansichten so sehr überein, dass wir das blöde „Sie” in ein trauliches „Du” umsetzten. Wir trennten uns als unzertrennliche Freunde. Sein Buch hätte, wie er mir versprach, 1885 erscheinen sollen. Aus Höflichkeit fragte ich im Laufe der nächsten zwei Jahre dreimal an, wann es doch gedruckt vorliegen werde und erhielt jedesmal die Antwort, es sei eine lebensgefährliche literarische Zangengeburt. Ich knauserte keineswegs mit teilnamvollem Beileid und hoffte auf eine erfreuliche Entbindung.
Endlich, im Jahre 1887 sandte er mir das Buch mit einer Widmung zu. Von einer Feindschaft noch immer keine Spur. Ich las das Buch mit zu hochgespannter Erwartung und gelangte zur Ansicht, dass der Volkglaube von den unterschobenen Wechselbälgen doch nicht ganz der oft genannten gesunden Grundlage entbehre. Ich schrieb gleich eine Rezension, die zu nichts verpflichtet (siehe oben) und barg das Buch an einem sicheren Ort. Als mich letzlich Professor Koch um einen Bericht ersuchte, musste ich, wie bemerkt, mit grosser Anstrengung meinen Krek hervorsuchen und von seiner Höhe herabholen. Offen gestanden, ich halte das
- 90 -
Abfassen des Krekschen Buches für keine so harte Aufgabe, wie die zweite Lektüre. Es ist wahr, dass ich im Stillen deswegen dem Freunde Krek grollte, doch mehr betrübte mich, den Marktberichterstatter, die traurige Lage der Götterfabrikation, der es, wie schon oben (S. 53.) erwähnt, sehr schlecht geht. Und wie sollte es nicht, wenn sogar ein k. k. o. ö. Univ. Professor den eigentlichen Fabrikanten ins Handwerk pfuscht! Wie sollten sich denn auch die protokollirten böhmischen Korallenfirmen behaupten, wenn sich die unbefugte Konkurrenz so dickleibig vordrängt?
Mir, der ich ja nur ein schlichter Marktberichterstatter bin, ging dies schliesslich doch nicht an die Gurgel und ich berichtete, wie immer, auch diesmal lobend. Prof. Koch hatte es leicht, meinem Krek es anheimzustellen, einen zweiten Referenten - einen objektiveren - namhaft zu machen. Darin eben liegt ja die Kränkung für ihn, weil er sich doch selber sagen musste, dass kaum jemand liebevoller als ich referiren würde. Daher die Mähr und der feindliche Bär.
Zwar haben die massgebendsten Sumsenbacherstimmen der „Fachkundigen” Krek greifbare Weihrauchdämpfe lobhudelnd dargebracht, so z. B. der „Laibacher Glockenschwengel”, das Klagenfurter „Johannisfeuer”, der „Cillier Bote für Stadt und Land”, das „Slovenische Volk”, ja sogar im nächsten Auslande der Agramer „Blumenkranz” u. s. w. Es unterliegt also keinem Zweifel, dass sich Krek konserviren wird; denn angeräuchert ist er genug, wozu Hippomachus im Kommentar bemerkt: perperam cecinisti, nam alioquin hi tibi non applauderent. Was mich anbetrifft, so habe ich niemals etwas Feindseliges gegen Krek unternommen, bin ihm auch jetzt gar nicht feind. Ich habe lediglich seine böhmischen Korallen aus der Götter- und Mythenwelt abgelehnt. Wenn die Kundschaft nicht kauflustig ist, muss ihr der Kaufmann doch nicht gleich mit dem eisernen Meterstab den Kopf löchern. Also brauchte mich Krek noch immer nicht mit dem lieblosen „Sie” und dem noch frostigeren „Er” zu kränken.
Krek bezichtigt mich unter anderem einer „unqualifizirbaren Niedertracht”, weil ich voll Tücke noch im dritten Jahre nach dem Erscheinen seines Buches eine Anzeige veröffentlichte. Seine Erklärung wiederhole ich, weil sie die ausdrückliche Selbsterkenntnis verschleiert ausspricht, dass über seine Leistung schon nach drei Jahren eine Erörterung unzulässig gewesen sei, womit er jedenfalls ein erfreulich
- 91 -
unbefangenes Urteil verkündet. In der Beurteilung meiner eigenen Siebensächelchen legte ich nie eine so grosse Objektivität an den Tag; denn ich hielt es z. B. für löblich, dass M. Landau, eben in Kochs Zeitschrift, meine „Sagen und Märchen der Südslaven” (aus den Jahren 1883 und 1884) erst oder noch im Jahre 1889 einer eingehenden Würdigung unterziehen mochte, ohne Furcht, bei irgend jemand anzustossen. Auch Gaidoz hat in seiner Melusine mein „Sitte und Brauch der Südslaven” erst vier Jahre nach der Veröffentlichung des Werkes besprochen ohne Angst, dass ich ihn dafür ankrekezen werde. Ich hoffe sogar, dass man meine verschiedenen Berichte auch nach 50 Jahren einer Erwähnung für wert und würdig erachten wird. Wenn ich nicht einmal zu der Hoffnung berechtigt mich fühlte, so tat ich lieber gleich mein Schreibzeug für zwei Heller versilbern und bewürbe mich um die nächsterledigte Stelle eines Theaterkoulissenschiebers in Varazdin. Ich meine sogar, dass man selbst an diesem neu gebosselten Marktberichte, der jetzund im sechsten Jahre der Krekischen Ära wieder ausfliegt, auch dann noch zur Kurzweil sich ergetzen wird, wann nach Krek, seiner Mache, seinen Meinungen und Meldungen kein Sumsenbacher mehr kräht. Der Schriftsteller, der in meinem Falle minder hoffärtig von sich denken würde, müsste rein ein Rabenstiefvater den eigenen Kindern gegenüber sein.

- 92 -
Einleitung in die slavische Literaturgeschichte.
Akademische Vorlesungen, Studien und kritische Streiflichter von Dr. Gregor Krek, ö. ord. Professor der slavischen Philologie an der k. k. Carl - Franzens - Universität in Graz, corr. Mitgliede der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag und der serbischen Gelehrtengesellschaft in Belgrad. - Zweite, völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. - Graz 1887. - Verlag von Leuschner & Lubensky. XI + 887 S. gr. 8°. Mk. 20 oder fl. 12.
Vor einem halben Jahrhunderte war „die slavische Welt”, besonders die nord- und südslavische, für die europäischen Kulturvölker im grossen und ganzen literarisch noch zu entdecken. Zwar fand auch damals, wie bekanntlich schon seit einem Jahrtausend, ein reger und nachhaltiger Wechselverkehr zwischen slavischen und nichtslavischen Völkern Europas in vieler Beziehung statt, doch erst in den jüngsten Jahrzehnten nahm zufolge der neuen, leichten und billigen Verkehrmittel ein ausnehmend bedeutender Austausch von Waren jeder Art, auch geistiger, zwischen den verschiedensprachigen Völkern einen ehedem ungeahnten Aufschwung. Früher unzugängliche Absatzgebiete haben sich für Handel und Wandel eröffnet, unerhörte, neue Werte sind aufgekommen, Börsen für internationalen Weltverkehr und Wettbewerb sind Jahr für Jahr entstanden, und unter dem Eindruck der ersten Überraschung schien es manchem, als müsste die Welt von Grund aus ein neues Gesicht gewinnen.
Wir Jüngeren wissen, dass mit dem Blitzzuge die Handtasche ebenso schnell, wie deren Eigentümer ans Ziel gelangt, während sich der menschliche Geist nach wie vor der uralten Schneckenpost bedient und an den holprigen, steilen, Kreuz- und Querpfaden der ältesten Zeiten fast unerschütterlich festhält. Telegraph und Telephon befördern mit Schnelligkeit der Elektrizität Mitteilungen, ohne Rücksicht darauf, ob sie geistigen Fortschritt enthalten. „Der Gedanke ist das Schnellste”, meint Lessing im Faustfragment. Ethnographen urteilen minder günstig; sie sagen nämlich, dass es kaum etwas Trägeres und Schwerfälligeres gäbe, als es Gedanken sind. Ethnographen sind nicht viele und die Menge bekehrt sich nicht zur Ansicht der Wenigen. Die Menge ist in einen Zwiespalt mit sich selber geraten. Sie folgt dem Gesetze der Trägheit und huldigt gerne jedermann, der sie darin bestärkt, indem er deren Velleitäten in einen Einklang mit den augenfälligen Errungenschaften auf dem Gebiete der Technik zu bringen sucht, den gewünschten geistigen Fortschritt als ein
- 93 -
fertiges Erbteil ihr vorschmeichelt und der allgemeinen Gedankenfaulheit damit Vorschub leistet.
Erst um die Mitte dieses Jahrhunderts begannen manche Völker ihrer Ichheit sich bewusst zu werden. Das politische Sumsenbachertum erzitterte für seinen Fortbestand. In einem vom Selbsterhaltungtrieb geschwängerten Angstdunstkreise fing sich das sogenannte Nationalitätprinzip zu entwickeln an und kam in eigentümlichen Erscheinungformen zur Geltung. Es brauchte anstandhalber ein Schamhütel und fand eines in der Sondersprache. Ehedem glaubte man, Sprachen wären Verständigungmittel; und je mehr solcher verschiedener Mittel jemand im geistigen Besitze hatte, desto mehr wurde er geachtet, nach des alten Ennius Ausspruch: quot linguas cales, tot homines uales, zu deutsch: „Je mehr Sprachen du verstehst, desto ähnlicher wirst du einem Menschen.”
Sprache und Schrift, die Bindemittel der Kultur, mussten ihrer eigensten Natur zuwider zum Hemmschuh des Fortschrittes umgestaltet werden. So hat uns die Neuzeit mit gar seltsamen Raçen- und Nationalitättheorien und Praktiken beglückt, die allen Erfahrungen der Jahrtausende alten Kulturmenschheit Hohn sprechen. Unter anderen ist der Kraftschlager der Menge eingepaukt worden: „Sprache und Volk sind ein und dasselbe.” Damit wurde die alte und doch immer neue Erfahrung: „die Sprache ist etwas angelerntes” mit einem Ruck bei Seite geschoben, um phantastisch aufgeputzten und zusammengeleimten Sprachvölkern Raum zu schaffen. Es erhoben sich Leute, die mit dem Brustton der Überzeugung und exstätischer Geschäftigkeit die Behauptung verbreiteten, das Hauptagens der Kultur sei die Pflege der nationalen Sprache. Als Trumpf konnten sie ausspielen, dass durch die nationale Sprache breiten Schichten einer zurückgebliebenen Bevölkerung Kulturelemente rascher zugeführt werden, als wenn das „unwissende Volk” erst eine fremde Kultursprache mühselig erlernen müsste. Also reinste und edelste Philantropie! Im Handumdrehen bildete sich jedoch ein Kultus der Sprache heraus, der nun z. B. bei den Slovenen und Kroaten zu einer Art chinesischen Mauer gegenüber fremdsprachigen Kultureinflüssen geworden ist. Die Sondersprache wird für vollwichtigen Ersatz erklärt für Religion, bürgerliche Tugenden, Rechtschaffenheit, Tapferkeit, Wissen und Können, Streben und Forschen, kurzum die „Sprache” ist als eigentliche Kultur proklamirt worden.
- 94 -
Das Wort „Nation” oder „Volk” ist ein kümmerlicher Notbehelf zur Bezeichnung eines in unserer Kulturwelt äusserst schwer bestimmbaren Begriffes. Ernest Rénan, ein gewiss geistreicher Denker und Dichter, veröffentlichte darüber im Jahre 1887 einen reizend hübschen Aufsatz, ¹) der in einem „ich weiss nicht” gipfelte. Der Geograph Prof. Alfred Kirchhoff bescheidet sich mit einer Umschreibung: „Nicht Bluteinheit macht die Nation, sondern geographisch und geschichtlich bedingte Interessengemeinschaft innerhalb eines gemeinsamen Vaterlandes." Der Ethnograph bedient sich des Ausdruckes „Volk" etwa so, wie der Sprachgebrauch das Wort „Sonnenaufgang” nicht aufgibt. Die Völkerkunde ist genau betrachtet, die Wissenschaft von den geographischen Provinzen (nach Bastian). Die sprachliche Zugehörigkeit einer Menschengruppe ist nach der Auffassung des Ethnographen zumeist nur ein wichtiger Nebenumstand.
Der Begriff „Volk” nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche ist also sehr unsicher, um wie viel mehr ist es der des „Slaventums”, unter dem man gar viele, durch Sitten, Gebräuche, religiöses Bekenntnis, geschichtliche und individuellkulturelle Entwicklung eigenartig gestaltete, durch unberechenbare Mischungen zusammengesetzte Gruppen verschiedener geographischer Provinzen zu begreifen hat, die nur das eine gemeinsam haben, dass sie jede ihre besondere, zu einer grossen Sprachgruppe gehörige Sprache spricht? Kittet die slavisch sprechenden Gruppen Bluteinheit aneinander? Haben die Russen, Polen, Serben, Čechen, Slovaken, Slovenen, Kroaten, Serben und Bulgaren, je in geschichtlicher Zeit auch nur politisch unter einer Haube gesteckt, ein Land ihr Vaterland genannt? Haben sie jemals gewisse gemeinsame grosse geistige Interessen durchzukämpfen gehabt? Ist jemals in ihnen das überwältigend mächtige, zusammenhaltende und zu Schöpfungen anregende Gefühl der Zusammengehörigkeit sonstwie zu Kraft bestanden? Haben sie je eine gemeinsame Literatur besessen?
Alle diese Fragen muss man, mit Rücksicht auf die klar zu Tage liegenden Tatsachen, verneinen. Und trotzdem eine „Einleitung in die slavische Literaturgeschichte”?! Prof Krek unternimmt es mit diesem „Versuche”, die
- 95 -
Einleitung zu etwas zu schreiben, was in der Wirklichkeit gar nicht bestanden hat, und, menschlicher Voraussicht nach, nie bestehen wird. Der Buchtitel ist keine geringe Täuschung, doch Prof. Krek steht im Banne des riesigen Nationaltätzaubers, eines unhaltbaren Gaukelspiels, das er zwar nicht geschaffen, doch sozusagen wissenschaftlich zu begründen kühnlich sich unterfangen hat, um der deutschlesenden Welt ein Lichtlein aufzustecken. Mit rührender Bescheidenheit, fast halb verschämt, benamsete er diese Leistung eine „Einleitung.”
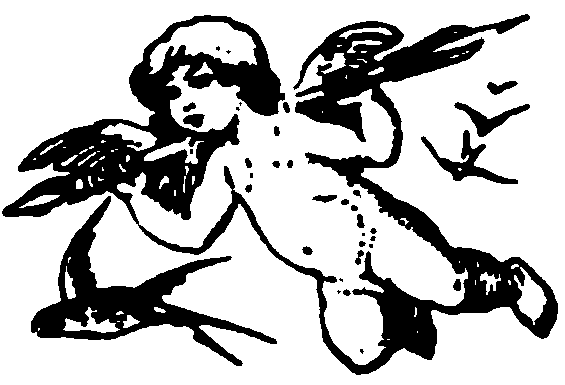
Kreks erste Tat war ein Beitrag zum slovenischen Parnass, ein dünnes Büchlein slovenischer lyrischer Gedichte an „Sie” (1864 oder 1865). Den effektiven Kurswert und die folgenschwere literarische Bedeutung seiner stürmischen Gefühlergüsse richtig abzuschätzen, bleibt einem slovenische Goedeke im dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung vorbehalten. Für uns Zeitgenossen muss die Vermutung ausreichen, dass „sie” „ihn” wohl nicht zu lange unerhört hat zappeln und schmachten sehen mögen. Alte serbische Bauern, die sich auch nicht auf den Kopf gefallen waren, brachten das Sprichwort auf: „Ein müssig Pfäfflein tauft Zicklein” (dokon pop jariće krsti). Nachdem Krek seinen durch slovenische männliche und weibliche Reime und vierzeilige Strophen eingeschnürten Pegasus genug geritten, nahm er ihm den Schnappsak Phantasie ab und liess den mit der Strophulosis lyrica behafteten Reimhengst für immer laufen. Mit dem kleinen Sack beschwert konnte Krek allein behäbig Fusstouren ins romantische Land slavischer Götter und Mythen unternehmen. Seine Ausflüge dahin beschrieb er in ungereimter deutscher Prosa und veröffentlichte sie in einem Gymnasialprogramm (1869) unter dem Titel: „Über die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle der Mythologie.” Der I. Theil (ein zweiter ist nie erschienen) der 1. Auflage des vorliegenden Werkes (1874) war nur eine Erweiterung und Verbreiterung der gedachten Programmbescherung, die wir endlich zu einem dickleibigen Buche ausgebaucht vor uns haben. Prof. Krek verfasste noch einige kleinere Aufsätze, die er in Zeitschriften ausgeschrotet und - 96 - sorgsam um das Wohl der Nachwelt bekümmert, auch mit in dem Buche verwertet hat. Unum sed leonem bohemicum! ¹) Lange vor Erfindung der Buchdruckerkunst in Europa tat schon ein Kirchenvater den Ausspruch: „timeo hominem unius libri.” Offenbar hat er unter seinen Zeitgenossen einen lateinischen Krek gekannt. Sei es wie immer, wenn einer sieben Jahre hindurch eine Einbrennsuppe kocht, so muss sie im achten die Königin unter den Einbrennsuppen sein und darf bei Leibe nicht brandeln. Wenn sich jemand bei solcher Musse, wie sich einer der Professor der slavischen Philologie an der Grazer Universität erfreut, schier zwanzig Jahre so gut wie ausschliesslich nur mit der Abfassung eines einzigen Buches abgibt, so mag man ungescheut Anforderungen höherer Art an die Leistung stellen, und der Autor darf es einem nicht sehr verübeln, wenn man ihm ein wenig nachspürt, ob und wie er sein teuer bezahltes Otium ausgenützt hat. Alles und jedes aus dem Buche auf den Gehalt prüfen, hiesse, eine Bibliothek schreiben. Es wäre gar nicht so widersinnig und unnötig zu diesem Zwecke ein Institutum Crecicum ins Leben zu rufen und eine „Monatschrift für Krekologie und angewandte Krekopädie” herauszugeben, doch vorläufig wird es vielleicht genügen, das Korallensystem und die böhmische Methode Kreks möglichst anschaulich zu beleuchten, indem einzelne Haupstellen, auf die es ankommt, besonders hervorgehoben und gewürdigt werden. Vor böhmischen Korallen aus der Götter- und Mythenwelt der Slaven alle Achtung.
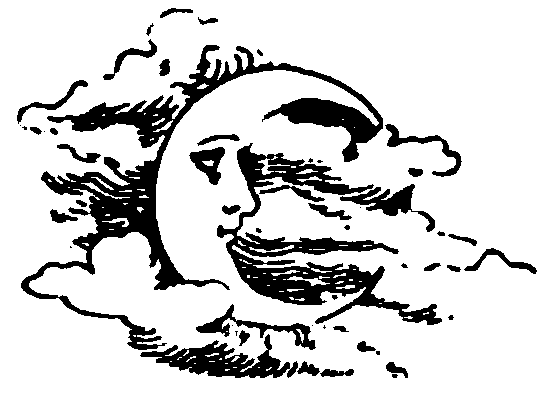
- 97 -
Krek nennt sein Buch „akademische Vorlesungen.” Mit Fug und Recht; denn ein schwerer und grosser Teil davon ist für ein grünes Publikum berechnet, das erst von einem slovenischen Gymnasium kommt und von einer wissenschaftlichen Literatur kaum einen blauen Dunst haben mag. Universitätvorlesungen sind in der Regel Kompilationen, was auch das Krekische Buch vollauf bestätigt, und unterliegen keiner Kritik solange sie der Professor durch Druck nicht veröffentlicht und das Urteil der wissenschaftlichen Welt herausfordert. Zu loben ist jedenfalls, dass Prof. Krek vorzugweise schon anfangs die Schüler über die selbständigen Forschungen deutscher Gelehrter eingehender zu unterrichten sucht. Es stellt mit rühmenswertem Fleisse wichtige Nachrichten und Ansichten über die Slaven zusammen. Das ist unstreitig eine grosse Arbeit gewesen, die Geduld im Abschreiben und Ausdauer im Aneinanderpicken der Zettel erheischte.
Es ist möglich, dass Krek eine dunkle Vorstellung vorschwebte, es könnte erspriesslich sein, für den Gebrauch angehender Slavisten und Ethnographen ein Handbuch zu liefern, das ein Seitenstück zu Wilhelm Freunds „Triennium philologicum” wäre. Freund war jedenfalls ein praktischer Schulmann durch und durch, dazu ein Mann von einer ausserordentlichen Literaturkenntnis und einer Objektivität, die jedem Autor gerecht wurde, der Namhaftes für die Wissenschaft geleistet, namentlich jenem, dessen Schriften anregend und aneifernd auf den Geist des Lernenden einwirken müssen. Wahrhaft klassisch ist sein feiner Spürsinn und sein Unterscheidungvermögen, wo es gilt, gute und nützliche Bücher vor Kompilationen und sonst handwerkmässig hergestellten Machwerken herauszustreichen. Unserem Krek gebricht es durchaus nicht an Wissen und Belesenheit. Er erdrückt und erdrosselt die zwei, drei Zeilen Text von oben, mit dreissig Zeilen langen Anmerkungen unterm Strich, die Titel und Zahlen, Zahlen und Titel enthalten. Wer neuntausend Büchertitel kennt, muss noch immer nicht ein Gelehrter, er kann ja blos ein Büchertrödler sein, und dreitausend Excerpte machen kein Buch, sondern zuerst einen Haufen. Kreks Buch ist wie ein vollgestopfter Bettelsack erschnappter Büchertitel und zufällig erhaschter Wissensbrocken; und solches Bücherschreiben ist nicht viel besser als Baumwolle mit der Hand spinnen, und Spinnen ist das nächste am Betteln, wie Jean Paul in Siebenkäs bemerkt.
- 98 -
Der besseren Übersicht halber sei die Kreks Buch vorgedruckte Inhaltangabe hier wiederholt: Erstes Buch: Die hauptsächlichen Nachrichten der linguistischen Paläontologie und der älteren Schriftsteller über die Sprache, die Geschicke und den Kulturgrad der alten Slaven. I. Abschnitt: Die Slaven ein Glied der Arier (3 - 66). II. Abschnitt: Die Slaven nach der Abtrennung vom arischen Grundstamme. 1. Die Loslösung der Slaven vom arischen Urvolke in Beziehung auf andere Glieder desselben Stammes (66 - 93). 2. Die Slaven als Einzelvolk. III. Abschnitt. Die Slaven unmittelbar nach der Lösung des Gesammtverbandes. A. Die Spaltung der slavischen Grundsprache (211-246). B. Gedrängte historische Notizen (246-353). C. Kultur- und Literaturgeschichtliches (353 - 473). Zweites Buch: Allgemeine Bemerkungen über die slavische traditionelle Literatur und deren Beziehung zur Kulturgeschichte, zunächst zur Mythologie. Vorbemerkung (477 - 483). Erste Abteilung: Die formale Seite der traditionellen Literatur. I. Abschnitt. Die Sprache (484-568). II. Abschnitt: Die Sitte. Zweite Abteilung. Die reale Seite der traditionellen Literatur. I. Abschnitt: Märchen und Sagen. II. Abschnitt: Sprichwörter, Aberglaube, Zaubersprüche und Rätsel. III. Abschnitt: Lieder (819-867).

Leser, die aus nationaler Begeisterung oder infolge ihres vom Autoritätglauben befangenen Gemütes butterweich gestimmt sind und sich jedes Nachdenkens begeben, verstehen immer alles, namentlich, wenn sie eigentlich nichts vom Gelesenen verstehen. Für sie ist Verworrenheit Klarheit, Verdunklung Erleuchtung und unverdaulicher Zitatenkrimskrams ein Triumph der Wissenschaft. Solche Leser müssen bei der Lektüre der ersten 100 Seiten Krek vor eitel Wonne zerschmelzen. Wie billig erwartet man, dass uns der Verfasser irgendwelchen Aufschluss über den Ursprung der Slaven geben wird. Die Notwendigkeit einer solchen Aufklärung empfand Krek wohl. Er half sich jedoch sehr geschickt aus der Zwickmühle heraus, indem er durch ein flinkes Kunststücklein die anthropologisch-ethnologische Frage zu einer sprachwissenschaftelnden Wortklauberei umstülpte. Kaltblütig, ohne mitzulachen, behauptet er:
- 99 -
(S 3): „Die materielle Archäologie und physiologische Ethnologie versagen uns jedwede befriedigende Antwort auf unsere Fragen oder verwickeln uns höchsten (?!) in Rätsel, an deren Lösung auch die schärfste Kombination scheitert.” „Nur sie (die Sprachvergleichung) hat es über jeden Zweifel sicher gestellt, dass die Slaven, entgegen der mitunter herrschend gewesenen, einfach (?) dekretirten Ansicht von der turanischen oder uralaltaischen Abkunft derselben, als Angehörige jenes grossen Sprachstammes anzusehen seien, den man den arischen, sanskritischen u. s. w., u. s. w. nennt.”
Ja, was soll das? Wenn einer von der turanischen Abkunft der Slaven spricht, hat er dann den slavischen Sprachstamm ins Auge gefasst? Djed šumom, baba drumom, „Der Ahn durch den Wald, das Ähndl auf der Fahrstrasse,” sagt der Serbe, wenn einer in der Weise die Ansicht des Partners in Erwägung zieht. Gesetzt den Fall, es würde ein Romanist eine Einleitung in die Geschichte der romanischen [Sprach-]Völker schreiben, dürfte er sich, ohne dem schärfsten Tadel sich auszusetzen, so leichthin der Aufgabe entledigen, die ethnische Zusammensetzung der romanischen Völker zu erörtern? Die zusammengestoppelten Traumgesichte über den Ursitz der „arischen” Völker, wie uns Krek mit solchen abspeist, wäre kaum als Ersatz für die nicht einmal versuchte Lösung viel dringlicherer und wichtigerer Probleme anzusehen.
Das Vorkommen gewisser gleicher Worte und Bezeichnungen in allen romanischen Sprachen würde vielleicht nur für die römische Kultur, nicht aber für die alte Kultur der romanisirten Sikuler, Gallier, Iberer, Longobarden u. s. w. etwas beweisen. Krek scheint jedoch an slavische Völker gar nicht zu denken, sondern träumt im allgemeinen von einem „arischen” Urvolke und von „Tatsachen, die es wohl über allen Zweifel stellen werden, dass die „Zivilisation” dieses (?) Volkes in dieser (?) Periode keine primitive mehr gewesen,” (S. 51 ff.). Warum verrät er uns nicht wenigstens beiläufig, in welches Jahrtausend „diese Periode” zu setzen und was man eigentlich unter „primitiver Zivilisation” zu verstehen verpflichtet sei? Krek ahnt keinen Unterschied zwischen Wanderung der Sprachen und Wanderung der Völker. Das ist ein Grundfehler, über den man nicht hinwegstolpern kann. Was nützt das riesige Aufgebot von gelahrt klingenden Noten und Nötchen im Damm der Anmerkungen, und was frommen die bestimmtesten Behauptungen im Geplätscher des schmalen Bächleins Text, wenn dem bedächtigen Leser der Glaube fehlt? Und dem Ethnographen fehlt der Glaube in solchen Sachen.
- 100 -
(S. 58 f.): „Gegen massenhafte Invasionen eines fremden Stammes war ausgiebigerer Schutz nötig, und diesen konnte nur der ganze Stamm, beziehungsweise das aus mehreren Stämmen bestandene Volk gewähren, das bewaffnet (man hatte Bogen, Speer, Schild) dem Feinde entgegen zu treten mächtig genug war.”
Wen das Spiel mit dem Worte Stamm in Ein- und Mehrzahl und das angedeutete Kriegspiel noch nicht genug verwirrt gemacht, dem versetzt Krek den Gnadenstoss mit der dem angeführten Satze unten angekoppelten Anmerkung (S. 59) :
„Ob Anzeichen vorhanden seien, dass unsere altarischen Urahnen sich auch offensiv an Kämpfen betheiligten, sowie ob sie überhaupt ein kriegslustiges Volk gewesen seien, worauf deren grosse Wanderlust deuten könnte, erachten wir beim Gegenüberhalten des unmittelbar
oben Erwähnten für sehr zweifelhaft.”
Die vertraulichen Plaudereien Kreks über den Küchen- und Speisezettel seiner allarischen Urahnen (die Handbücher für Kochkunst St. Hilaires und der Frau v. Szczepańska waren dazumal noch ein Wunsch der altarisch-urahnischen Jungfrauen) gehen auf unverdaute Lesefrüchte zurück, die er halbverarbeitet wieder von sich gibt:
(S. 60 f.): „Die friedliche Thätigkeit erstreckte sich auf die rohesten Anfänge des Landbaues und dürfen wir annehmen, dass es unter den Getreidearten sicherlich Gerste und wahrscheinlich Weizen gewesen sind, die angebaut wurden, und zu Mehl zerrieben und sodann gebacken
neben der Milch, die man zu Butter und Käse zu bearbeiten noch nicht verstand, und neben dem theils gekochten, theils auf Kohlen geröstetem Fleische der Hausthiere als Lebensunterhalt dienten. Demselben Zwecke entsprach die Frucht der wildwachsenden Obstbäume, deren Zucht und Pflege noch unbekannt war. Dass auch Fische genossen wurden, wird zwar mehrfach angenommen, lässt sich aber durch die Sprache nicht rechtfertigen. Die Nahrung der Urarier war demnach theils eine vegetabilische, theils eine animalische, eine Thatsache, die auch anderweitig vollkommen bestätigt wird.”
Da hat mans! Weil ihm die „Sprache” oder die den meisten indogermanischen Sprachen gemeinsamen Wurzeln jener Worte, die sich auf Nahrungmittel beziehen, keinen Aufschluss geben - quod non est in lingua non fuit in mundo - verurteilt er jene Menschen, die die allermeisten Wohltaten eines gesteigerten Kulturlebens ohnehin entbehrten, zu der Rolle von Hungerleidern, die zum Ueberfluss auch noch sehr wählerisch sind. Wer die Sitten und Gebräuche der Naturvölker kennen zu lernen sich bemüht, erfährt bald, dass dem „primitiven” Menschen nicht viel anders als bei uns einem einjährigen Kinde vor nichts ekelt. Er verschmäht gar keine Kost, Menschenfleisch ebenso wenig als faule Fische,
- 101 -
er delektirt sich an Läusen und trinkt den aufgefangenen und nachher ausgegohrenen Speichel. Sein Sinnen und Trachten ist nur auf den Frass und seine Hauptsorge auf die Befriedigung des Geschlechttriebes in jeder Form und jeder Art gerichtet. Wie mühelos kann man sich über alle diese Dinge bei den Ethnographen Belehrung einholen! Wohl schummert Krek etwas vor, dass seine einseitigen Expilationen nicht ganz koscher sein dürften, und er wehrt voraussichtliche Einwände ab:
(S. 116.): „Wer würde alle Griechen darum für Eichelesser erklären, weil die Arkader sprichwörtlich balanephagoi hiessen, oder die Nachricht des Herodot (IV. 109), dass die Budinen die Frucht der Zirbelfichte geniessen (phtheirotrageousi; viele übersetzen das Wort mit „Läuse essen”, entgegen dem Schol. ap. Tzetz. Lycophr. Cass. v. 1383, der phtheires als hol karpoi tōn pityōn erklärt), ethnographisch ausdehnen? Wer da weiss, wie oft bei solcher Namengebung neben notorischen Missverständnissen, Fabeln u. a. auch die Volketymologie im Spiele ist, wird auf derartiges ein grosses Gewicht zu legen nicht geneigt sein.”
Wenn Krek sagt: „Wer da weiss,” so hat man darunter jemanden zu verstehen, „der da gar nichts weiss.” Die essbare Eichel der Griechen, Gallier, Briten, die doch ihren Anwert als Volknahrungmittel im Orient noch nicht ganz verloren hat, ist nicht unsere bittere, sondern eine süsslich schmeckende Eichel. Das Läuseessen aber ist noch gegenwärtig bei einem ansehnlichen Teil, selbst der kultivirten Menschheit ein gewöhnlicher Brauch, der nach dem Zeugnis Johann Fischarts (157²) auch in Deutschland üblich war. Darüber lohnt es sich, die höchst lehrreiche Studie, Prof. Dr. W. Joests im „Globus” (LXII. S. 195 ff.) und vielleicht auch meine Ergänzung dazu im selben Bande (S. 365) nachzulesen. Wäre Herrn Krek die ethnographische Literatur nicht so wildfremd, er wäre ebensogut wie Prof. Joest auf die richtige Fährte gelangt, doch er weist, gleichsam ein Dictator aus eigener Machtvollkommenheit, alles ab, was ihm die eingebildete Idylle von des Urslaven wirtschaftlicher Behaglichkeit verunzieren könnte. So lässt er sich z. B. auf (S. 143 f.) derart über die altslavische Wohnung aus:
„Zwischen dem Hause domŭ und dem Stalle hlěvů, mit der Tenne gumĭno war der Hof dvorů, und ist die Ansicht, dass unsere Vorfahren mit den Thieren nicht nur unter demselben Dache wohnten, sondern auch die eigene Wohnung mit ihnen theilten, als durch nichts begründet, abzuweisen.”
- 102 -
Warum diese „Abweisung” bestens beglaubigter Erscheinungen?! Weil hlěv und gumno der Wurzel nach in den indogermanischen Sprachen nachweisbar und weil dvor „ge-nuin und etymologisch von dvĭrĭ nicht zu trennen” ist! Das passt zur Idylle, die er romantisch ausspinnt, z. B. (S. 148 f.):
„Mit dem eigentlichen Kriegswesen noch unzureichend vertraut, machte man Eroberungszüge in der Regel nicht, doch wich man auch dem Kampfe ratĭ nicht aus. Man verteidigte wacker den heimatlichen Boden und bediente sich dabei allerlei Waffen” u. s. w.
Die „Prähistorie und Geschichtforschung,” bezw. die Ethnologie sind ihm ein Dorn im Auge. Er fertigt sie ständig mit Hohn ab, zwar nicht so täppisch wütig wie mich, den bescheidenen Arbeiter auf dem Gebiete slavischer Völkerkunde, doch immerhin in genügend albernanstössiger Weise, so z. B. auf S. 66, wo er über „die Loslösung der Slaven vom arischen Urvolke in Beziehung auf andere Glieder desselben Stammes” zu phantasiren beginnt:
„Schon jetzt wird von dieser Seite gegen die Sprachwissenschaft der Vorwurf erhoben, dass sie die Urzeit zu idyllisch und zu civilisirt zeichne, und wird zu verstehen gegeben, es habe da neben Polygamie und Polyandrie auch Sklavenraub, Kindermord, Kinderaussetzung, Menschenfresserei, Abtreibung der Leibesfrucht und anderes derartige gegeben - lauter Kulturblüten (?!), für die die Sprache ohnmächtig ist aufzukommen. (?!) Trotz der lohnenden Perspective, die ungeahnt vor unseren Blicken sich eröffnet, ziehen wir es dennoch vor, dem von der Sprachwissenschaft gepredigten „frommen Köhlerglauben” nicht untreu zu werden” u. s. w.
Er selber sagt es, dass es Köhlerglaube sei, nur über die Frömmigkeit sind wir verschiedener Ansicht. Gerne bestätige ich hiemit öffentlich, nachdem ich das Buch dreimal durchgelesen, dass Krek unverbrüchlich treu dem Köhlerglauben geblieben ist, ja noch mehr, nach Kräften bestrebt war, den vorgefundenen Vorrat aus eigenen Mitteln zu bereichern. Mit grösserer Naivetät und deutlicher konnte Krek seine Unfähigkeit, wissenschaftliche Fragen der Ethnologie zu begreifen, gar nicht bekunden. Satiram scribere non difficile!

Die Sprachwissenschaft in allen Ehren! Es fallt mir nicht im allerentferntesten bei, die Last der Krekologie ihr aufzubürden. Die Sprachwissenschaft ist eine helfende und beratende Schwester der Ethnologie. Beide sind auf einander angewiesen und bedürfen zu Stützen noch der Anthropologie und Prähistorie. Schliesslich sind alle vier Disciplinen
- 103 -
zusammen in den engen Betrachtungkreis weniger Jahrtausende der Entwicklung des Menschengeschlechtes gebannt, so man sich bescheidet, keinen Träumen nachzujagen. Krek würde wohl manche närrische Glosse unterdrückt haben, wäre er nicht zu stolz gewesen, die Vorträge seines jüngeren Universitätkollegen Prof. Dr. Rudolf Hoernes zu besuchen und da zu lernen. Hoernes ist ein Naturforscher, der eine Stimme im Rate hat. In seinem Schriftchen über die „Herkunft des Menschengeschlechtes” (Graz 1891) bemerkt er mit Hinblick auf unseren Gegenstand: „Auch die Kraniometrie ist wenig geeignet, uns bei der Aufhellung der Verwandtschaftbeziehungen der Stämme und Rassen zu fördern. Anderseits liegt es auf der Hand, dass die Ethnologie durch Berücksichtigung der Sprache, der Sitten und Lebensgewohnheiten, der Kleider, Waffen und Werkzeuge nicht leicht im Stande sein kann, die ursprünglichen Verwandtschaftverhältnisse und die Stammgeschichte aufzuhellen.” [Der Ethnologe formulirt seine Hauptaufgabe freilich etwas anders.] „Denn allzuoft haben Wanderungen und kriegerische oder friedliche Besitzergreifungen fremde Völker zu Herren auf Landstrichen gemacht, deren Urbevölkerung zurückblieb, mit der neu angesiedelten innige Beziehungen einging, deren Sprache und Sitten annahm, oder auch wohl umgekehrt die eigenen den Einwanderern überlieferte. riegerischer und friedlicher Verkehr hat oft die Erzeugnisse der menschlichen Hand über ungeheure Strecken verbreitet, und selbst flüchtige Berührungen mit fremder Kultur haben veranlasst, deren Werke nachzuahmen oder nachzuäffen. Anderseits konnten sich unter ähnlichen Vorbedingungen bei ganz heterogenen und räumlich getrennten Stämmen ähnliche Sprachformen entwickeln, Werkzeuge und Waffen von demselben Materiale und in ähnlicher, ja ganz in derselben Gestalt zur Anwendung kommen. Die Sprachforschung und die Untersuchung der Sitten und Lebensgewohnheiten vermag daher nur unter Berücksichtigung aller dieser, oft schwer genug aufzuhellenden Umstände mitzusprechen bei der Erörterung der Verwandtschaftbeziehungen der Stämme und Rassen.”
Alle diese Umstände sind Kreks allerletzte Sorge gewesen. Seine Ausführungen über das Alter seiner altarischen und urarischslavischen Urahnen sind romantische Kunstmärchen müssiger Tage und Jahre, Grübeleien über Wortwurzeln, die er aus den Werken der Sprachforscher excerpirt und
- 104 -
exstirpirt hat. Es ist ihm unbekannt, dass die slavisch redenden Völker Mischlinge sind, die spätestens am Anfange unserer Zeitrechnung aus den Trümmern zersplitterter und in politischer Auflösung befindlicher Völkerschaften und auf den Überresten von deren Kultur sich gesondert zu entwickeln begannen. Völker entstehen und vergehen, sang schon der Psalmist. Dieser Prozess steht auch heutigen Tags so gut wie nirgend auf der Welt stille. Die prähistorischen Forschungen mahnen uns aber, dass in Europa schon vor 4000 Jahren eine Kultur bestanden, die zum mindesten alles überragte, was Krek seinen imaginären altarischen Urahnen zugesteht. Ja, wir dürfen, wenn wir wollen, noch weiter in die Vergangenheit bis in die Zeit des Mammuts uns zurückversetzen. Im September d. J. 1891 fand man bei einer Grabung im Löss in Brunn Menschenschädel und Bildnisse aus Mammutzahn. Die Funde sind ausserordentlich wichtig, „denn sie beweisen, dass der Mensch in Europa gleichzeitig mit Mammut und Nashorn gelebt und schon damals nicht ohne Kunstfertigkeit und Sinn für Schmuck gewesen. Sein Knochenbau und seine Schädelbildung war derartig, dass wir diesen Ureuropäer als Vorfahren der später in unserem Weltteil auftretenden Kulturvölker ansehen dürfen.” („Globus” v. Rieh. Andree LXIII. 1. S. 15 ff. nach Makowsky i. d. Mitt. d. Anth. G. i. Wien. 1892, Heft 2 u. 3.)
Wie viele Völker sind entstanden und vergangen, bis Germanen, Romanen und Slaven auf der Bildfläche auftauchten? Wer kann das ergründen? Wir Ethnologen brauchen uns damit nicht den Kopf zu zerbrechen, weil wir uns darauf beschränken, kontrolirbare Erscheinungen des Völkerlebens, den Völkergedanken, zu erheben. Was die slavischen Völker anbetrifft, so spielten und spielen die Russen, Polen, Serben und Bulgaren noch gegenwärtig kleineren, fremdsprachigen Völkern gegenüber, auf die sie durch politische Macht, durch Sitte, Sprache und höheren Kulturzwang einwirkten oder einwirken, eine ähnliche Rolle, wie Griechenland und Italien seinerzeit in Süd- und Westeuropa. Sehr wertvoll sind in dieser Hinsicht die Andeutungen Prof. W. M. Flinders-Petries (Ten Years' Digging in Egypt, 189²), wo er die Bedeutung des sogenannten Bronzezeitalters in Europa und Afrika würdigt:
”This bronze age is the source of the objects we now use. Thence these types were carried into Egypt a couple of
- 105 -
centuries later by the Greeks. When we descend further, we see this independent culture of Europe prominent. The Saxons and the Northmen did not borrow their weapons, their laws, or their thoughts from Greece or Italy. The Celts swamped the south of Europe at their pleasure; and against the fullest development of Greek military science they were yet able to penetrate far south and plunder Delphi. They were powerful enough to raid Italy right across the Etrurian territory. When we look further east, we see the Dacians with weapons and Ornaments and dresses which belong to their own civilization, and were not borrowed from Greece. In Short, Greece and Italy did not civilize Europe, they only headed the civilization for a brief period.”
Ein in sich abgeschlossenes Ariertum oder Urslaventum ist eine seelenlose, unbestimmbare, aus traumhaften Phantasien zusammengeflickte und zusammengepappte Wahnromantik, eine böhmische Korallenschnur ohne Anfang und Ende. Victor Hehn bezeichnet in seinem Tagebuche (De moribus Ruthenorum, 189²), das übrigens an schiefen Verallgemeinerungen lächerlich viel darbietet, die Russen als ein seniles Volk, bei dem man noch heute die ältesten Gebräuche der Urzeit zur Kraft bestehend vorfinde. Letzteres ist wahr, wie von einem Forscher gesprochen, es gilt aber das gleiche auch von den Polen, Kleinrussen, Südslaven, Čechen, ja im Sinne der Volkwissenschaft von jedem anderen Volke. Doch „senil” sind die Völker darum ebensowenig, wie der Eichenwald, den alljährlich herbstliche Stürme und Ungewitter, des Winters Schnee und Frost entlauben. Jeder neue Lenz verjüngt den Wald und die Auen. Jung oder senil sind im Sinne des Ethnologen alle Menschen in ihrem Gehaben, Tun und Lassen, sofern man überhaupt die Zulässigkeit derart unzulänglicher Bezeichnungen in unserer Wissenschaft hingehen lassen mag; denn die gesammte Menschheit ist in der organischen Welt nur eine einzige Rasse, die sich in unberechenbar entlegenen Zeitläuften aus einem gewiss sehr kleinen Kreise entarteter Pithekoiden durch Zuchtwahl, Anpassung und Vererbung im langwierigen Kampfe ums Dasein herausgebildet hat.

- 106 -
Pammler, Ordner, Beschreiber und Erklärer, wie Volkforscher es nun einmal sind, sprechen und schreiben immer nur in ihrem eigenen Namen, im höchsteigenen Auftrage, für eigene Rechnung und Gefahr. Da meint so ein armer Kärrner der Wissenschaft, wer weiss was geleistet zu haben, wenn er scharfsinnig einen neuen alten Gedanken aus den verborgensten Schlupfwinkeln des Seelenhaushaltes der Völker herausgefunden, und bildet sich was darauf ein, wenn die Fachgenossen daheim und in der entlegensten Fremde seine Beobachtung für richtig und wichtig anerkennen, bekräftigen und sie für ein Gemeingut der Wissenschaft erklären. Volkforscher sind durchgehends gar bescheidene Leute, ohne rechtes Selbstvertrauen; denn nichts bedünkt ihnen zuverlässig und gesichert, wofür sie nicht Parallelen aus dem ganzen bewohnten Erdkreise beizubringen in der Lage sind. Für irgend eine besondere Erscheinung wünschen sie ehebaldigst hundert und noch mehr ähnliche und verwandte zusammen- zulesen, bis ihnen das Besondere unter der Hand zu einer allgemeinen Erscheinung sich auswächst. Eher ruhen und rasten solche Leutchen nicht, als bis sie auf den von Bastian in Kurs gesetzten Völkergedanken kommen. Den Völkergedanken halten sie für den einzigen und unentbehrlichen Prüfstein.
Wie doch ganz anders Prof. Krek als Mann des pyramidalsten Selbstbewusstseins. Er spricht maximo hiatu und schreibt nur meterhohe Unzialen im Namen des altarischen Urslaventums, mit dessen offizieller Vertretung er offenbar betraut sein muss. Auch stappelt er das gelahrte Gebebber weniger als objektiver Forscher denn als Parteimann für panslavische Grösse und Macht und slovenisch-chrowotischen Glorienschein auf. Als Staffage hat man sich das provinziale, politisch nationale Sumsenbachertum hinzuzudenken, von dem sich KreksBuch im Haut relief abhebt. Wer das nationale Gezanke der Laibacher und Agramer Kannegiesser nicht näher kennt, dem bleibt mancher Zug Kreks unverständlich. Er wurzelt in dem nationalen Boden und der „Ur”-Idee. Es ist ja auch nur natürlich, dass ihn die heimatlichen und freundnachbarlichen patriotischen Blätter mit Jubelhymnen begrüssten, als er dem Volke sein Buch offenbarte. Ihm jauchzt die „Partei” zu, deren Wissenschaftelnder Anwalt er geworden. Es ist für so manchen Biedermann aus dem „Volke” nützlich, der nationalen
- 107 -
Idee mit Haut und Haaren sich zu verschreiben. Das Risiko bei dem Geschäfte ist minimal die Gewinnstchancen kolossal. Die „nationale Idee” ist eine bequeme Stufenleiter zu vielen mit Einkünften verbundenen Ehrenstellen, Würden und sogar, wie es den Anschein gewinnen will, staatlichen Versorgungen; sie ist häufig Stellvertreterin des schon etwas abgebrauchten Mantels der Patentliebe für gar viele Schwächen und Fehler; sie ist aber auch ein mächtiger Popanz, ein grosser Fetisch bei den neugebackenen Natiönchen, um den sich Halbheiten, Schalheiten, Albernheiten und Trostlosigkeiten zu einem imponirenden Rudel scharen.
Einem solchen Publikum muss Krek, der sich zum Panegyriker des Slaventums aufgeworfen, der es nicht verabsäumt, ab und zu die Moral der Slaven zu loben, herzlich gefallen. Krek bewegt sich da auf glatteisiger abschüssiger Bahn, die man lieber nicht betreten soll, wenn man ethnographisch etwas zu ergründen sucht; denn Moral ist ein konventioneller Begriff, der selten auch nur bei einem einzigen Volke einförmig zu sein pflegt. Wie gering ist zuweilen der Anlass zu einer Verhimmelung in diesem Buche! Weit entfernt, die slavische Familieneinrichtung als ein Entwicklungstadium von internationaler Verbreitung ethnographisch zu erfassen, ohne Ahnung von vater- oder mutterrechtlichen Sippen, ohne Einsicht in die mannigfachen geographisch bedingten Lebensverhältnisse der slavische Sprachen redenden Gruppen, übergiesst Krek alle mit einem zuckersüssen Aufguss staunender Bewunderung. Besonders stolz ist er auf die „Feinheit der Distinktion” in der verwandtschaftlichen Nomenklatur, die „jene der urverwandten Völker weit übertreffe”. Anstatt zu beweisen, was doch erst zu beweisen gewesen wäre, die für den Fall behauptete Wichtigkeit der Nomenklatur nämlich, schickt Krek seine Zuhörer und Leser mit überquellender Begeisterung für das Slaventum heim. Die eine Stelle sei hier im Wortlaute angeführt:
(S. 160 f.) „Diese Organisation musste es auch veranlassen, der Entwicklung des Familienlebens den freiesten Spielraum ( ? ! ) zu gewähren. Dass solches tatsächlich der Fall gewesen, erklärt zur Genüge (?) die überaus reichhaltige Familiennomenklatur, die uns schon für die Epoche der slavischen Stammes- und Spracheinheit in scharf ausgeprägten Formen entgegentritt und mehr als irgend ein anderes kulturhistorisches Moment, die Slaven als ein gesittetes, der Monogamie ergebenes Volk vorführt. Da ein näheres Eingehen auf diesen interessanten Gegenstand ausser dem Rahmen unserer Aufgabe gelegen ist (?!?), sei auf Grundlage positiver Resultate (?) lediglich
- 108 -
darauf hingewiesen, dass in diesen Terminis ebenso die Blutverwandtschaft - wie die Schwägerschaftgrade in einer Durchbildung und sprachlichen Pointirung gegeben werden, wie solche wohl kaum einem von den verwandten Völkern eigen sind, und sich dieselben bei einem grossen Teile der Slaven noch bis heute in ungestörter Fortdauer erhalten haben, bei einem geringeren dagegen erst in historischer Zeit durch den Einfluss fremder Rechtsinstitutionen verdrängt wurden. Wo aber jedes Glied im Rahmen des Familienlebens eine passende Stellung zugewiesen erhält und organisch (?) mit dem Ganzen sich verbindet da sind keine Anzeichen vorhanden, von dem moralischen Zustande dieses Ganzen in abfälliger Weise urteilen zu dürfen, zumal die Heiligkeit des Familienlebens noch heute einen charakteristischen Grundzug der Slaven bildet.”
Hoch soll er leben, der Beschützer bedrängter Unschuld, der unerschrockene Verteidiger der Schwachen! Ethnographisch aber betrachtet, kann man nicht leicht eine grössere Menge unsinniger Aufstellungen in so wenig Worte kleiden. Nur behauptet hat Krek so viel Löbliches und Rühmliches, doch bewiesen gar nichts, und es wäre jetzt an mir, ihm dies zu beweisen, indessen enthebt mich z.B. C. N. Starcke dieser kleinen Mühe, auf dessen vortreffliches Buch „Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwicklung” (Leipzig 1888. S. 181 bis 22¹) ich verweisen muss. (Zur Wahrung meines Standpunktes bemerke ich, dass ich sonst mit den jedenfalls scharfsinnigen und geistreichen Schlussfolgerungen des ganzen Werkes nicht einverstanden bin, mich vielmehr Bastian und Post anschliesse, was mich freilich nicht abhält, in besonderen Fragen dem Verdienste meines dänischen Fachgenossen gerecht zu sein.) Starcke wiederlegt mit deutscher, gründlicher Umständlichkeit die auf Nomenklatur bezüglichen, weitgreifenden Schlüsse Morgans, Mac Lennans, Lubbocks u. a. m. und sagt zuletzt: „Die Nomenklatur war Punkt für Punkt der treue Spiegel der rechtlichen Verhältnisse, die unter den nächsten Verwandten jedes Stammes bestanden. Personen, die dem Redenden rechtlich gleichgestellt sind, werden auch gleich benannt. Von diesem Punkte aus entwickeln sich auf ganz formale Weise die übrigen Verwandtschaftkategorien. Dass Reflexionen über Ehe- und Abstammungverhältnisse unter den Kategorien der Nomenklaturen verborgen seien, ist die völlig unbewiesene Annahme, die den genannten Gelehrten das richtige Verständnis der Nomenklaturen vorenthielt. Wir müssen aber gestehen, dass das richtige Verständnis, welches gewonnen zu haben wir uns jetzt schmeicheln, die Bedeutung
- 109 -
der Nomenklaturen als Hilfmittel für ethnologische Forschung so sehr schmälert, dass alles weitere Verharren dabei interesselos wird.”
Was von den „Naturvölkern” gilt, auf die sich in erster Reihe Starckes Ausführung bezieht, findet in diesem Falle auch auf die Slaven vollkommene Anwendung, wofern man ihnen nicht eine übernatürliche Ausnahmestellung einräumen will. Es gibt keine Extrawurstvölker. Krek hat eine gute Ausrede, wenn ihm just eine fehlen sollte, er habe Starckes Buch noch nicht gekannt und darum auch nicht expiliren können, doch für mich ist dies noch lange keine Gewähr, dass er sonst seinen oben angeführten Passus nicht geschrieben haben würde; denn er hat die Liebhaberei, die ernstesten Arbeiten, die ihm in den panslavischen Kram nicht hineinpassen, totzuschweigen, als ob sie gar nicht vorhanden wären; dagegen zitirt er alles, was nur irgendwie seine vorgefassten Meinungen zu stützen scheint. So z. B. beliebt es ihm auf S. 161 auch mich einmal wider meine Absicht und meinen Willen zur Bekräftigung heranzuziehen:
„Am besten bisher sind die südslavischen Verwandtschaftsnamen aufgeführt und systematisch geordnet bei F. S. Krauss, Sitte und Brauch der Südslaven, Wien 1885, S. 4-14.”
Meinen verbindlichsten Dank für die gnädige Belobigung! Jene Tabellen stellte ich ohne jeden Hintergedanken zusammen, blos um die rechtlichen Zustände in der Hausgemeinschaft und Sippe besser erläutern zu können, doch nichts lag mir ferner als solche Schlüsse, wie Krek, daraus zu ziehen. Wozu beruft er sich auf mein Buch? Mit welchem Rechte macht er mich zu seinem Helfershelfer? Für sein „Urslaventum” beweisen meine Tabellen, so viel Mühe und Zeit sie mir auch gekostet, gar nichts; denn es ist absolut nicht ausgemacht, dass man befugt sei, die südslavische Form der Hausgemeinschaft und Sippe erstens als eine allgemein slavische oder vollends als urslavische Institution hinzustellen. Krek spielt mit Worten, die allgemein slavisch sind, statt uns historisch die Entwicklung der Begriffbedeutungen der betreffenden Ausdrücke jeweilig bei jedem einzelnen slavischen Volke klarzulegen.

Krek verficht mit leidenschaftlichem Eifer, indem er jeden, der anders als er die sog. alten Quellenschriftsteller interpretirt, für einen Tolpatsch hinstellt, seine Marotte,
- 110 -
die „alten Slaven” hätten „in Gesittung und Monogamie” gelebt. Die drei Seiten (196 - 198) darüber hier auszuschreiben, ist mir zu langweilig, und es bleibt jedem anheimgestellt, wen gerade die Neugierde plagt, das Gewäsche von und bei Krek nachzulesen; doch da fiel es ihm nicht ein, die gegenteiligen Angaben aus meinem genannten Buche anzuführen. Er nennt mich nur, um für Brautraub einen Erklärer zu haben, während ihm der Grund und Zweck meiner Darlegungen nicht in die Augen fiel. Dr. A. H. Post, ein deutscher Gelehrter, dem keines Volkes Rechtbrauch fremd geblieben, der sich in diesen Dingen als einer der besten auskennt, war ein mehr aufmerksamer und erkenntlicher Leser meines Buches, wie man dies leicht aus seinem Werke „Studien zur Entwicklunggeschichte des Familienrechtes” (1890, S. 66 f.) und so auch aus Dr. Lothar v. Darguns „Studien zum ältesten Familienrecht” (189²) ersehen mag. Die zeitlich älteren, sehr glaubwürdigen Nachrichten der Nestorischen Chronik über Polygamie, wofür der Folklore unserer Zeit hundertfache Bestätigung liefert, will unser Krek mit aller Gewalt für Irrtümer „christlicher” Schreiber erklären. Würde es sich um die Nachrichten der Conquistadoren über die alten Einwohner Yucatans handeln, so liesse ich die subjektiv willkürliche Auslegungweise Kreks ruhig hingehen, obgleich sie auch da nicht zu empfehlen wäre, aber was tut man nicht alles um des leidigen Friedens willen? Die Germanen waren einst keine Monogamisten; warum müssen es die Slaven gewesen gewesen? Seien wir einmal offen, sind denn in der Gegenwart die Deutschen und die Slaven in der Tat ausschliesslich Monogamisten? Gewiss nur dem rechtlichen Scheine nach, in Wirklichkeit sind sie es nicht. Man schlage darüber bei B. Björnson, „Monogamie und Polygamie” (Autorisirte Übersetzung. Mit einem kurzen Vorworte des Verfassers. Berlin 1889) und über die Institution im allgemeinen und besonderen das vortreffliche Werk Ploss-Bartels' „Das Weib in der Natur- und Völkerkunde” (Leipzig 189²) nach. Dem zweiten Bande des letzteren Werkes ist auch ein gewaltiges Literaturverzeichnis beigegeben, das mir weitere Anführungen erspart.
Das Bestreben, die Slaven auf Kosten der „deutschen Stämme” gross zu machen, bestimmt Krek zu eigentümlichen Abschweifungen von einem fast dichterischen Schwunge. Der Pegasusreiter verläugnet seine Natur nicht. Blech,
- 111 -
gediegenes Blech. Man lese darüber die Seiten 207 - 211 nach. Die Idylle vom alten Slaventum gefällt ihm so gut, dass er selbst die Auseinandersetzung über die Spaltung der slavischen Grundsprache mit einem freundlich aufs Gemüt wirkenden Rückblick wie folgt, eröffnet:
„Innerhalb des oben besprochenen Zeitraumes entwickelten sich die Slaven, dem Glücke stiller Häuslichkeit huldigend und von Natur aus kriegerischen Raubzügen abgeneigt, zu einer Nation, die in intellektueller und moralischer Beziehung nicht unwürdig den übrigen Sprossen des arischen Stammes an die Seite gestellt werden kann.”
Das tut dem Herzen wahrhaft wohl und beruhigt die Nerven! Abgesehen von dieser wunderlichen Einleitung ist gerade der dritte Abschnitt (von S. 213 - 250) mit besonders dankenswertem Fleisse und in Bezug auf die historischen Notizen der byzantinischen Zeit mit grösster Abschreibersorgfalt und mit gesundem Vorurteil zusammengeschweisst. Warum sollte ich ein rühmliches Verdienst irgendwie schmälern, obwohl ich niemand anrate, ohne Kontrole auf die Richtigkeit der Krekischen Zitate zuviel sich zu verlassen. Nur die nationale Augendienerei Kreks, diese fixe Idee, ist mir ein Gräuel; denn sie verführt ihn z.B. dazu, Bücher und Schriftsteller anzupreisen, die notorisch minderwertig sind. So z. B. zitirt er als Quellenwerke auf S. 353: V. Klaić „Poviest Bosne do propasti kraljestva”, 1882 (Geschichte Bosniens bis zum Untergange des Königreiches) und T. Smičiklas : „Poviest hrvatska”, I.: 1882. (Geschichte Kroatiens.): „Zwar in populärer Darstellung und daher ohne kritischen Apparat, aber sehr reichhaltig und verlässlich.”
Klaić war zeitlebens ein unwissender, unkritischer literarischer Pechvogel und dazu ein verächtlicher Stänker, der dem kleinen Kroatenvölkchen masslosen Hass bei den Serben geschaffen. Er hat inzwischen selbst in Agram seine bemitleidenswerte Rolle ausgespielt, er hat sich völlig abgenützt, er ist zurückgesetzt und zurückgeschoben, überflügelt vom jüngeren Nachwuchs, der die Kunst des Verhetzens noch gründlicher auszuüben versteht, der ihn zwar nicht an Bedeutunglosigkeit, jedoch an Dreistigkeit und Lungenstärke überragt. Im Jahre 1887 war Klaić noch Redakteur des kroatischen belletristischen Wochenblattes „Vienac” das er nahezu zu Grunde richtete, und er quittirte gleich die Nennung seines Namens mit einer überschwänglichen Grabrede, will sagen Lobrede auf Krek. Unser Krek, der die kroatische Literatur ebenso eifrig wie ich verfolgt, hat gewiss auch das Urteil des Domherrn Adolf
- 112 -
Veber über Klaić gelesen, dass er es jedoch nicht beherzigen mochte, ist traurig genug. Die Kroaten sind lange nicht so einfältig und urteillos, dass sie sich von einem Klaić auf die Dauer nasführen liessen.
Das Buch Prof. Smičiklas' ist tendenziös, vom Hass gegen das Deutschtum, Magyarentum und Italienertum diktirt und an zahllosen Geschichtverdrehungen überreich. Es ist nicht reichhaltig an Gedanken, sondern reich an nationalen Expectorationen von der Art jener im Ljubićischen Werke über kroatische Geschichte; es ist nicht zuverlässiger als sonst ein Werk aus Lord Lougensheaples historischem Archive; es steht im Gegensatze zu den Anforderungen geschichtwissenschaftlicher Kritik, ausgesprochen zu dem Zwecke verfasst, um künstlich ein höheres Nationalbewusstsein im Lande zu erzeugen. Krek ist durchaus nicht so geistig beschränkt, um das nicht zu verstehen, doch was tut man nicht, um Aufnahme zu finden in die nichtprotokollirte Agramer Genossenschaft für wechselseitige Beweihrauchung? Es wäre aber ungerecht, die angenehme Seite Smičiklasens zu verschweigen. Er macht im bürgerlichen Verkehre einen guten Eindruck und zeichnet sich als Schriftsteller durch vollkommene Beherrschung der serbischen Sprache vor so vielen anderen neukroatischen Literaten vorteilhaft aus. Der Mann hat Phantasie, wie ein landläufiger Romanschreiber, doch bei weitem nicht so viel wie z. B. Leo Norberg, dessen historische Romane im „Neuen Wiener Tagblatt” nicht allein den ungarischen Gardeoffizieren, sondern auch anderen Leuten gefallen, die spannende Romanbruchstücke zum Morgenkaffee zu sich nehmen mögen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Leo Norberg ungleich mehr Verständnis für historische Kritik, gewiss jedoch ein geordneteres, gründlicheres Wissen und einen geläuterteren Geschmack besitzt als Krek samt Smičiklas.

Es tut einem ordentlich das Herz weh, dass es einem beschieden ist, in dieser durch und durch verjudeten Welt zu leben, anstatt Zeit- und Mitgenosse der alten Herren Slaven und der altslavischen Damen zu sein, wie sie uns Krek schildert. Ja, die Damen haben es halt bei Herrn Krek gut! Bei ihm lebt im altslavischen Staate jeder wie der Herrgott in Frankreich. Unsere Freilandgründer sollten statt bei
- 113 -
Bellamy, Bebel und Hertzka in die Lehre, zu Krek in die leeren Hörsäle gehen. Er würde ihnen das auf S. 361 f. skizzirte Bild von urslavischer Glückseligkeit farbensatter ausführen, während wir uns mit dem Entwurf, wie folgt, bescheiden müssen:
„War jede ihrer Handlungen gegen Fremde von Humanität getragen, so waren sie gegen Einheimische nicht minder von Herzensgüte durchdrungen, und genossen Greise die grösste Pietät, Kranke und Arme die sorgsamste Pflege (auf den arisch-alturslavischen Universitätkliniken?) und Unterstützung (arische Staatspfründner?), daher es unter ihnen eigentlich Vermögenlose nicht gab (jeder hatte bei der arischen Postsparkassa oder altslavischen Nationalbank seine zehntausend Stück 4% Notenrente) und arm nur derjenige war, der aus der Gesellschaft als böse ausgestossen ward. Gleichermassen bewies man sich gegen das schwächere Geschlecht wohlwollend und achtete dessen an geborenen Rechte.” Dazu in der Anmerkung ²): „Für die vorzüglichsten (also gibt es auch da Rangstufen nach Wohlverhaltungzeugnissen?!) slavischen Völkerschaften ist es historisch nachweisbar, dass das Weib bei ihnen keinen geringen Grad von Unabhängigkeit behauptete.”
Die Anhänger gewisser Philosophenschulen fabeln mancherlei von angeborenen Rechten, doch in ethnographischen Arbeiten ist diese Redewendung, so viel ich weiss, unerhört. Dass sie trotzdem auf Damen passe, habe ich von einem versoffenen Förster erfahren. Auf meiner Forschungreise kehrte ich einmal bei einem herzögischen Expositurleiter in einem Dörfchen ein. Der ledige Mann bewohnte ganz allein ein gefälliges Häuschen, das zugleich Amthaus war. Nachts schliefen wir in derselben Stube, er in dem einen, ich im anderen Bette, d. h. in der Wanzensammelstelle.
Ich vertrieb mir im Mondlicht die Zeit durch erfolgreiche Wanzenjagd. Riss mich eine, so griff ich rasch hin, und griff ich fehl, so hatte ich doch eine andere und zerknickte sie. Mich störte nur das Geseufze und Geächze des Herrn Beamten. „Ärgern auch Sie die blutrünstigen Viecherl?” - „Ach nein, die bin ich gewohnt.” - „Ham S' eppa a Bauchzwicken?” - „0 nein.” - „Ham S' a Zähntweh?' - „0 nein.” - „Vielleicht ham S' a Rheumatismus?” - „Wenns nur das war!” - „Ja, wo happerts denn, Schockschwerenot!” - „Verliebt bin ich in die Förster-Hanne, und der alte Rauber, das betrunkene Rhinozeros gibt sie mir nicht, weil ich ihm zu wenig bin.” - „Ja, will denn Hanne Sie haben !” - „Sie möcht schon, wenn nur der Alte auch wollt?” - „Na alsdann, nachher lassen S' mich morgen mit dem Alten a Wörtl reden: den wer mer umstimmen. I wer schon alles machen!” Der verliebte Expositurleiter sprang mit einem Satze von
- 114 -
seinem Bette auf meines zu und fieng mich an vor Entzücken abzuherzen. „So, san S' so guat;' sagte ich „lassen S' mi do aus; So zerdruck'n ja meine schönste Wanzenkultur!”
Gegen acht Uhr morgens beehrte ich mich mit einem Besuch beim Förster. Er, der Vater des Hauses, ein kupfernasier, wohlbeleibter Sechsziger, Witiber und wirklicher Inhaber von vier Töchtern gleich Löwinnen, hochblond die drei älteren, dunkelbraun die jüngste; Hanne, des Expositurleiters Auserkorene war die fetteste und älteste, eine Kanone von schwerem Kaliber mit breitem Hintergestell. Der Förster begrüsste mich als „ein Menschengesicht in schauriger Wildnis” und wir huben nach dem üblichen Scheingefecht zwischen Gastgeber, der nicht gern viel bittet und dem Eingeladenen, der sich nicht lange weigert, zu gabelfrühstücken an. Mein Nachtmahl beim Expositurleiter hatte aus sauerer Kresse und das Frühstück aus einer Schale Kaffeesud bestanden, und so war ich denn in der Früh ziemlich leistungfähig, umsomehr als ich am Vortage keine Gelegenheit gefunden, ein Mittagmahl mir zu vergönnen. In der ersten Stunde brachen wir zweien Flaschen Rotwein aus Mostar den Kragen, in der zweiten, nach der vierten Flasche, tauschten wir Küsse aus und schlossen Duzbruderschaft, in der dritten, bei der fünften, erklärte der Förster, es gäbe im ganzen Čechenlande keinen so gemütlichen Kerl wie seinen Gast, als aber von der sechsten der Stöpsel draussen war, und ich schon sechs in Schmalz ausgebackene Spiegeleier und dazu eine Blechschachtel Sardinen vertilgt hatte, wünschte er sich thränenden Blickes einen Schwiegersohn begabt mit meinen Tugenden. Nun standen alle meine Backbordsegel und ich lavirte gegen die Brandung. Mein ganzes Reissen und Zerren wäre in Wahrheit, sein Eidam zu werden, doch ein höherer Wille gebeue mir, ruhelos den Wanderstab von einer menschlichen Ansiedlung zur anderen zu tragen, und zudem sei auf Reisen selbst die angetrauteste Ehegesponsin ein gar kostspielig und heikel Gepäck; doch wüsste ich ihm herrlichen Ersatz, eine Perle der Männlichkeit, einen hoffnungfreudigen Jüngling in den schönsten Jahren, der noch einmal Finanzminister werden könne, sobald man an massgebender Stelle auf sein bedeutendes Talent aufmerksam wird, mit einem Worte: den Expositurleiter.
„Von dem Ross Gottes, dem Kürbisschädel will ich nichts wissen!” erwiderte etwas unwirsch, doch nicht böse der Alte. Ich fasste Mut, schänkte ihm aus der siebenten Flasche
- 115 -
ein und setzte ihm die Lage auseinander. Prinz Horkenez de la Ribeïra, der Herr und Gebieter beider Kastilien und der Estremadura habe sich schon jüngsthin zu Arragon mit der stolzen Dona Elvira aus dem weitverzweigten, mächtigen Geschlechte derer von Di Pumpdichan vermählt, und Ritter Ganélon, der Held von Roncesvalles, von Arabella di Madrigal schnöde abgetrumpft, sei ein geschworner Frauenfeind geworden und beabsichtige die Gründung einer Bank für verkrachte Ritter und Barone. So wären denn die schönsten Freier von selber vom Kampfplatz der Liebe zurückgetreten, und nur der getreue Expositurleiter habe unverdrossen im Minnedienste ausgeharrt.
„Weil er ein Rindvieh ist!” rief der Alte lachend aus. „Weil er ein schätzbares Mitglied des Menschengeschlechtes ist,” erklärte ich unbeirrt weiter; im übrigen stellte ich dem Alten unter Hinweis auf zahlreiche Fälle aus der altbabylonischen und čechischen Geschichte die Notwendigkeit vor, die Töchter bald unter die Haube zu bringen. Zumal da er ihnen keine Mitgift zu geben habe, wäre der Expositurleiter das Prachtexemplar eines Eidams in spe. „Was!” schrie der Alte auf, „keine Mitgift? Das Mütterliche ist ihnen angeboren, das Monatliche kriegen sie und meinen väteriichen Segen haben sie!”
Aus der neunten Flasche füllte ich einem glücklich verlobten Pärchen die Gläser voll und hielt nach der Hauptmahlzeit - ich ass mir für drei Tage Vorrat an - in vorgreifender Höflichkeit eine feierlich ernste Strohkranzrede, die aber an der Heiterkeit meines Publikums wirkunglos abprallte. „Der Frau sind”, sagte ich, „für jeden unberechtigten unantastbare Rechte angeboren, doch hervorragend ist des Mannes angeboren Recht. Holdselige Jungfer Braut, demnächstige Gattin! Und du verschämter, züchtiger Bräutigam! (Lach nicht so blöd drein!) Wo sich angeborene Rechte innig zu einander gesellen, verschmelzen die Seelen in einander, wie Spielhagen poetisch zart sich auszudrücken pflegt, und fortzeugend wirkt das vereinigte Recht, neue angeborene Rechte ins Leben setzend!” u. s. w. Abends hatte mein Diener, der Guslar Milovan, einen solchen Rausch, dass er hoch und heilig schwur, im nächsten Türkendorf Moslim zu werden, um die noch übrigen drei Försterischen aufheiraten zu dürfen.
Ob Herrn Krek bei der Stilisirung der angeborenen altslavischen Damenrechte ein stenographischer Bericht meiner Rede vorgelegen, ist mir bei der Überhäufung mit amtlichen
- 116 -
Geschäften nicht möglich gewesen zu ermitteln. Sollte er von selber darauf gekommen sein?! Die Geschichte hat jedenfalls einen Haken.
Angesichts unzähliger Berichte der nord- und südslavischen Epik über Frauenkauf und -Verkauf, über Raub und Schändung, über das Mundschaftrecht des Hannes und des Bruders gegenüber der Frau und Schwester, bzw. den Töchtern, ist Kreks Mitteilung von den „angeborenen Rechten des schwächeren Geschlechtes” sehr auffällig. Zum Beweis für die sociale „Unabhängigkeit” der slavischen Frau beruft sich Krek auf die Schwestern Tuga und Vuga der „kroatischen” Sage. Schön ist es freilich nicht, diese von Ludwig Gaj neuerlich eingeschmuggelte, nichtsnutzige, weil wertlose böhmische Koralle des purpurgeborenen Konstantin, uns als eine kroatische Volksage aus der Zeit der Völkerwanderung gar (!) aufmutzen zu wollen. Er führt uns an, so gut er kann, der Mythen-Mann. Wir sind gerührt, wies sich gebührt und - angeführt.
Mit dem Abschnitt: „Kultur- und Sittengeschichtliches” wird sich schwerlich je ein Ethnograph befreunden, weil Krek darin zu viel auf einmal von seinem frömmsten Köhlerglauben breitschlägt und ausdrischt. Bei der Besprechung des Namens Dažbog versteigt er sich plötzlich zur Redewendung. „Unsere Altvorderen,” just als ob er in direkter Linie von einem der Teilnehmer am Heerzuge Igors abstannnen und archivalisch die intimere Geschichte seines Bojarengeschlechtes verkünden würde! Köstlich gelungen ist seine herausfordernde Verteidigung (S. 393. Anmerk. 1.) einer angeblichen, serbischen Gottheit Dabog. Anstatt geradenwegs einzugestehen, dass die gesammte südslavische Volküberlieferung alter wie neuer Zeit, soweit sie bekannt geworden, von einem Dabog nicht die leiseste Ahnung besitzt, beruft er sich auf eine unverfälscht echtböhmische Koralle eines serbischen Lehrers in der Vila (IL 1866. 64²) und schleudert Beleidigungen gegen jeden Ungläubigen aus, indem er ihn von vornherein als einen verschrobenen Kopf und Mitglied einer Schwindlergilde hinstellt. Der durch nichts begründete, unanständige Ausfall ist für die wissenschaftelnde Methode Kreks bezeichnend; er lautet:
„Den Mythophoben wird es bei der ihnen vielfach eigenen Willkühr von den Lautsubstitutionen nicht schwer fallen, im Dabog den Gottseibeiuns aliter Diabolus zu entdecken, zumal ja Dabog hier augenscheinlich in dieser Rolle sich präsentirt. Wir gehören der Gilde nicht an und acceptiren den Namen als willkommenen Beweis, dass
- 117 -
Daždĭbog selbst bis auf unsere Tage herab in der volktümlichen Tradition eine leise Spur zurückgelassen habe.”
Er brauchte sich durchaus nicht so zu verschanzen, der Herr Krek; denn den lieben Dažbog findet er hundertemal bei dem fruchtbaren serbischen Korallenfabrikanten Milojević vor. Das ist kein Leisetreter und kein Patzer, wie jener Dorfschullehrer, der sich nur zweimal in der Vila produzierte und darauf gleich die Fabrikation für immer einstellte.
In seinen Abschweifungen aufs Gebiet der Mythologie bewährt sich Krek noch am meisten als selbständiger und unabhängiger Fabrikant böhmischer Korallen, ohne jedoch durch Phantasie und Gestaltungkraft einen Veckenstedt oder Nodilo zu erreichen, eher wäre ein Vergleich mit Rudolf Falb am Platze. Von Falb unterscheidet er sich durch Anführung einer Menge „Literatur”. Man glaubt, das Verzeichnis eines Büchertrödlers zu lesen, nur die herabgesetzten Bücherpreise sind nirgend angegeben. Neben Quellenwerken citirt er mit aller Unbefangenheit auch Anthologien der Jugendgeschenkliteratur, die weder für den Studenten noch den Fachgelehrten etwas taugen. Der grösste Teil der Krekischen bibliographischen Zusammenstellung ist nun aber völlig wertlos geworden, weil uns die russischen, polnischen, čechischen und bulgarischen Folklore-Zeitschriften (und -Jahrbücher) in dieser Hinsicht aufs beste bedient haben; namentlich sei dankbar erwähnt, dass der Pole Stanislaus Ciszewski in Karłowiczs Wisła eine historisch-bibliographische Übersicht der kroatischen und serbischen Folklore-Literatur geliefert, die, ein nachahmenswertes Vorbild für ähnliche Arbeiten, bestens zu empfehlen ist. Das Übel besteht darin, dass Krek, der nichts weniger als ein Folklorist ist, mit der gleichen Sorglosigkeit, wie über Prähistorie und einem durch kein intimeres Vertrautsein mit der Volkkunde getrübten Blick auch über den Volk- und Völkerglauben sich gemacht hat und lehren will, wo er selber erst die Anfanggründe der Wissenschaft lernen soll. Bei einer halbwegs gründlichen, kritischen Durcharbeitung der Bücher, deren Titel er mitteilt, wären gewisse Aufstellungen unmöglich gewesen. Ein Beispiel für viele. Auf S. 407 sagt er:
„Als mythische Wesen niederen Grades wurden verehrt .... die Vilen und die an Stelle eines älteren Namens getretenen Rusalken, die Herscherinnen über Flüsse, Wälder und Berge.” - Dazu in der Anmerkung 1: „Die Tradition kennt Luft-, Berg- und Wasservilen.”
- 118 -
Sind die Vilen wirklich „Herscherinnen” der Gebiete, die in modernen Staaten dem Ressort der Finanz-, Handel-, Ackerbau- und Marineministerien zugehören, so involvirt die Bezeichnung „Wesen niederen Grades” unstreitig das Vergehen gegen die Sicherheit der göttlichen Ehre. Prinz Marko, Milos Obilić, Reija mit den Flügeln und andere blaublütige, edle und vürnehmbe Herrschaften stellten sich unter den Schutz von Vilen und waren mit einzelnen wahlverschwistert. Ein Glück für Krek, dass die Herren schon gestorben sind, sonst könnte es ihm schlimm ergehen. Im übrigen wäre die „Herrschaft” der Vilen erst nachzuweisen gewesen, ebenso, dass es Luft- und Wasservilen gebe. Vilen sind Baumseelen und gehören als solche zur grossen Sippe internationaler Baum- und Waldgeister. Krek zitirt zwar häufig genug Mannhardts „Baumkultus”, doch wäre es erwünschter, wenn er es nicht verschmäht hätte, auch etwas daraus zu lernen. Nebenbei erwähne ich, dass mein Buch „Volkglaube und religiöser Brauch der Südslaven” (Münster i. W. 1890) eine Studie über die Vilen enthält, durch die die böhmische Koralle von einer Herrschaft der Vilen und den Wasser- und Luftvilen, wie ich meine und Fachgelehrte es anerkannt haben, endgiltig aus der Wissenschaft ausgemerzt ist.
Prof. Kreks Auseinandersetzungen über die Totengebräuche der Slaven schliessen sich eng an A. Kotljarevskijs bekanntes, von Spasowicz als vollkommen unkritisch nachgewiesenes Werk an. Hätte uns Prof. Krek, ich sage nur beispielweise, die Totengebräuche der Südslaven nach guten Quellen dargestellt, die allgemeinen Ergebnisse wären sicherer und lohnender ausgefallen. Ich kann dies um so gewisser behaupten, als ich seit Jahren Materialien für eine solche Spezialstudie ansammle und einen Überblick über das Vorhandene gewonnen habe. Die Leichenverbrennung als einen einst slavischen Brauch hinzustellen, wie dies Krek tut, ist durchaus unstatthaft.
So schrieb ich wörtlich diesen Passus auch in Prof. Kochs Zeitschrift. Seitdem habe ich in Weinholds Zeitschrift für Volkkunde zwei Kapitel meiner Studie über den Tod in Sitte, Brauch und Glauben der Südslaven, vorwiegend nach eigenen Ermittlungen veröffentlicht und ohne Kotljarevskijs Buch zu berühren, dessen Wert in Frage gestellt. Zu meiner Originalarbeit konnte ich ihn und sein Material leicht entbehren. Was sagt aber Krek in seiner verunglückten
- 119 -
„Abfertigung”? Die Stelle ist gar zu hübsch und unterhaltlich, so dass sie als Beitrag zur Ckarakteristik [sic] der Krekologie als modernster Wissenschaft einen Neuabdruck erfordert:
„Auf S. 384 der Zeitschrift heisst es: Professor Kreks Auseinandersetzungen über die Totengebräuche der Slaven schliessen sich eng an A. Kotljarevskijs bekanntes, von Spasowicz als vollkommen unkritisch nachgewiesenes Werk [,an' ist ausgelassen]. Merkwürdig! Bisher galt dieses preisgekrönte Werk bei allen Fachkundigen, zu denen ich Herrn Fr. S. Krauss selbstverständlich nicht rechne, als eine allen Anforderungen der wissenschaftlichen Kritik möglichst entsprechende Leistung und auch bei nichtslavischen Forschem finde ich es nicht selten rühmend hervorgehoben. Und, Spasowicz also hat die völlige wissenschaftliche Wertlosigkeit dieses Werkes, wie es heisst, nachgewiesen. Das konnte nur nach Kraussscher Manier und Methode der Verunglimpfung per Bausch und Bogen fertig gebracht worden sein und V. D. Spasowicz, der Verfasser der polnischen Literatur in Pypins bekanntem Werke, scheint (?) nur nicht danach angelegt, so etwas Widersinniges verschuldet (!) zu haben. In der Tat (?!) hat Spasowicz nicht eine Zeile gegen Kotljarewskijs Schrift geschrieben, es wäre denn, die betreffende Streitschrift wäre ein literarisches Geheimnis geblieben und für Herrn Fr. S. Krauss sozusagen ad personam verfasst worden.”
Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, als ob Krek für das Urteil der Preisrichter mich verantwortlich machen wollte. Es ist Regel, dass das Pubhkum preisgekrönte Stücke ablehnt; das ist sein Recht, und auch Spasowicz hat als einer aus dem Publikum sein eigenes Urteil abzugeben für gut befunden. Was er übrigens auch an Kotljarevskij ausstellt, wäre für mich noch lange nicht allein ausschlaggebend, ständen mir meine (zum Teil noch ungedruckten) sehr ergiebigen Sammlungen nicht zu Gebote, von deren Inhalt weder, weiland Kotljarevskij noch Spasowicz ein Wissen hatte. Spasowicz hat auch keine „Streitschrift” ad personam meam verfasst, sondern lediglich eine schlichte Rezension veröffentlicht, die leicht zugänglich ist. Wollte Krek wissen, wo, so brauchte er bei mir blos mit einer Postkarte höflich anzufragen, wie er es auch früher, während der Drucklegung seines Buches, einigemal getan, als er sich über einige seltene, ihm nicht zugängliche südslavische Werke, die ich besitze, unterrichten wollte. Er weiss es doch am besten aus eigener Erfahrung, dass es mir weder an Artigkeit noch an Dienstgefälligkeit gebricht. Mein Auskunftbureau liefert unentgeltlich Bescheide ohne Rücksicht darauf, ob einer wirklicher Abonnent des Urquells oder nur Gratisblitzer ist. Mochte Krek durchaus keine Auskunft mehr von mir
- 120 -
haben, so stand es ihm frei, an Herrn „Spasowiez, o. Mitglied der kaiserl. russischen Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg” zu schreiben. Das ist ein gar lieber, freundlicher, alter Herr, der keine in anständigem Ton an ihn gerichtete Anfrage unbeantwortet lässt. Krek hätte sich zum Überfluss auf mich berufen dürfen, und Herr Spasowiez, der mir, wie ich wohl weiss, nicht abgeneigt ist, würde ihm sogar das Heft mit dem Referat im Original geschenkt haben. Mit einer Zeile könnte ich gleich hier dem Herrn Krek das Postporto ersparen, aber justament tue ich es nicht, weil er mich so unsanft anrempelt. Krek voll altarischurslavischen Stolzes lässt sich übrigens nicht leicht zu Dank verpflichten. Er hält es für männlich edler, sein kritikloses Ab- und Nachschreiben aus Kotljarevskij durch einen wohlfeilen Ausfall gegen meine Vertrauenswürdigkeit und literarische Ehre in Schutz zu nehmen. Warum er aber selber, im Überflusse von Musse schwelgend, es verabsäumt hat, die Totengebräuche an der Quelle zu erforschen, verschweigt er weise als Meister des Stillschweigens. Die Volkseele ist eben für ihn abgeschlossener als die Komorner Festung für russische Spione, namentlich in Erwägung, dass er sich gar nicht bemüht zu haben scheint, in das ihm fremde Gebiet einen Einblick zu gewinnen. Darum nehme ich seine Äusserung, dass er mich selbstverständlich nicht zu seinen Faxenkundigen rechne, für eine, wenn auch unbeabsichtigte Schmeichelei hin. Der Schäker, er will sich wieder bei mir eintegeln.

Wenn einer in Österreich, ohne regelrecht medizinische oder juridische Studien an einer Universität absolvirt zu haben, Rezepte verschreibt oder Rechtsachen führt, wird er wegen Kurpfuscherei oder Winkelschreiberei vors Gericht gezogen; ja, in Wien wird nach dem Wortlaute der Gewerbeordnung jeder streng bestraft, der ohne Befahigungnachweis Sauerkraut oder gebratene Erdäpfel feilbietet. Nur die Photographie und die Ethnographie darf jeder Steuerzahler frei betreiben. Photographen-Ateliers gibt es zu viel, die Konkurrenz ist zu gross und die Nachfrage um so geringer, als die Amateurs in allen Formaten fast hinter jedem Haustor auf der Lauer stehen. Vorderhand sind die Apparate noch etwas teuer im Preise und das bremst ein wenig die Photographierwut;
- 121 -
in der Ethnographie hegt die Sache bedeutend günstiger. Diese Wissenschaft ist jedem, wie Kreks altslavischen Frauen die Rechte, angeboren. Daraus erklärt es sich ohne Widerspruch, wieso Krek, ohne jemals seine Befähigung für Ethnographie erwiesen zu haben, mit grösster Sicherheit auf dem Zweiggebiete der Ethnographie, der Volkkunde, tiefe Furchen ziehen darf. Das „II. Buch” Kreks ist gar ausschliesslich der traditionellen Literatur gewidmet.
Wem mein literarisches Steckenpferd nicht fremd ist, der wird es begreiflich finden, dass ich schon das II. Buch Krekii mit grösster Aufmerksamkeit lesen musste. Bereichert er auch nicht mein Wissen, so zeigt er mir doch Seite für Seite, wie man es nicht machen darf, was immerhin nützlich ist. Es ist ja männiglich bekannt, dass man leichter und oft mit Vergnügen von jenen lernt, die unsere Vorbilder nicht sein können, als von jenen, die uns offiziell als Muster dienen sollen. Als ich auf S. 532 f. eine Legende von der Wanderung Christi und Petri auf Erden las, heimelte mich die Sprache so traut und bekannt deutsch an, dass ich in Gedanken Herrn Prof. Krek schon Abbitte zu leisten anfing, weil ich der Meinung war, er verstehe es nicht, volktümlich deutsch zu erzählen. Neugierig schaue ich mir auf S. 533 die Anmerkung 1 an und lese:
„Podgoriški in A. Janežičs Slovenski glasnik IX. 213, 215, v Celovci 1863. B. Krek Slovenske narodne pravljice in pripovedke, v Mariboru 1885, pg. 32, 33. F. S. Krauss Sagen und Märchen der Südslaven, II. 421,422, Leipzig 1884.”
Noch immer neugierig schlage ich mein altes Buch nach und richtig finde ich, dass Prof. Krek meine Übersetzung abgeschrieben. So hatte ich ihn doch an meiner Feder erkannt. So oft sich Krek mit fremden Federn, will sagen Übersetzungen behilft, z. B, der Talvyschen, S. Kapperischen oder A. Grünischen, er selber kann wohl keinen deutschen Vers anfertigen, so unterlässt ers nie, die Übersetzer namhaft zu machen, freilich um ihnen fast jedesmal am Zeuge etwas zu flicken. Meine Übersetzung scheint ihm dagegen wert, dass er sie für seine eigene auszugeben bereit ist. Um so merkwürdiger ist es, dass er sonst von meinen Studien nur flüchtig und gezwungen, förmlich blos zur Parade, um mit einigen Büchertiteln mehr die Anmerkungen zu verstärken, gleich wie von den Werken Andrees, Mannhardts, Kopernickis u. a. Notiz nimmt. Eigentlich ist es auch nicht merkwürdig; denn das hängt mit seiner Auffassung und seiner eigensinnigen Richtung zusammen, die er mit manchen anderen, sonst sehr
- 122 -
gelehrten und verständigen Männern gemeinsam hat. Nicht ich allein, jeder Ethnograph nimmt an solchem Vorgehen Anstoss. So äussert sich z. B. Albert H. Post in seinem gar trefflichen Handbüchlein. „Über die Aufgaben einer Allgemeinen Rechtwissenschaft” (Oldenburg 189¹) auf S. 11: „[Es] besteht in juristischen [und philologischen] Kreisen gegen die Ausnutzung des geographischen und ethnographischen Materials, welches in unserer Zeit durch Forschungreisende herbeigeschafft wird, noch ein ganz sonderbares Vorurteil, welches wohl zweifellos auf Unkenntnis beruht. Unzählige neuere Reisewerke sind Quellenwerke allerersten Ranges. Jeder Historiker [und Philolog] könnte sich glücklich schätzen, wenn ihm solche Quellen zu Gebote ständen. Aber da werden beispielweise die oft durchaus unzuverlässigen und ärmlichen Schriften des griechischen und römischen [in Kreks Falle des mittelalterlich slavischen] Altertums mit der höchsten Verehrung betrachtet, während die höchst gewissenhaften und reichhaltigen Sammlungen wissenschaftlich gebildeter Männer unserer Tage so angesehen werden, als wenn sie alle miteinander lediglich Phantasten, Schwindler und Abenteurer wären. Man stösst hier wieder einmal auf eine jener verzopften Anschauungen, die sich regehnässig in schulmässig stärker angebauten Disciplinen zu entwickeln pflegen.”
In seiner „Abfertigung” bedenkt mich Krek freigebig mit weitaus lustigeren Schimpfwörtern, als die von Post beispielweise genannten es sind, im Buche jedoch begnügt er sich noch, mich mit einer gewissen mitleidigen Gleichgiltigkeit unter der Zahl der angeführten Autoren mitlaufen zu lassen. Natürlich, ich und Kolberg und andere unseres Gleichen gelten ihm blos als Sammler, während er, der niemals derartige Handlangerdienste der Wissenschaft verrichtet hat, über dem Sammler hocherhaben sich dünkt. Auch hierin ist er im Irrtum. Sammeln und Sichten der Volküberlieferungen ist heutigen Tages noch die beste Schule für den Ethnographen, und es ist nur zu beklagen, dass Krek diese Schule nicht durchgemacht, sondern a priori seine slavische Mythologie konstruirt hat. Anstatt uns mit Phantastereien abzuspeisen und statt einen Kolberg zu schmähen - er sagt von ihm auf S. 467:
„Er hat den wissenschaftlichen Anforderungen zuweilen nur in geringerem Masse Rechnung tragende Sorgfalt angedeihen lassen.”
hätte Prof. Krek eine „Rechnung tragende Sorgfalt” dem
- 123 -
Riesenwerke Kolbergs (bis jetzt 33 Bände ¹) in gr. 8°) widmen sollen. Die Zuhörer Kreks hätten dann erfahren, was auf dem Gebiete slavischer Volkkunde noch zu leisten ist. Kolbergs wunderbares Werk ist eine unerschöpfliche Fundgrube ausgezeichnetster Materialien und wird einen bleibenden Wert für kommende Geschlechter behalten, während Kreks Buch schon in einigen Jahren veraltet sein dürfte.
So lautet bestimmt und unzweideutig der Absatz über Kolberg auch in Prof. M. Kochs Zeitschrift S. 385. Ich sage doch deutlich genug, was ich bei Krek vermisse: eine Würdigung der ausserordentlich wichtigen Leistungen Oskar Kolbergs. Das wäre doch Kreks verfluchte Schuld und Pflichtigkeit gewesen. Anstatt diese Unterlassungsünde irgendwie, wenn auch nur versuchweise zu entschuldigen, zeiht mich Krek in der „Abfertigung,” was ihm entschieden weniger Anstrengung kostete, der Verdrehung und Unwahrheit, also:
„Auf S. 566 ff. meines Buches ist von der slavischen Dialektologie die Rede (er fälbelt auch, oder doch hauptsächlich, „von den Äusserungen der Volkspsyche!”) und wird auf S. 567 hervorgehoben, dass neuestens zumal bei den Polen auf diesem Felde sich eine sehr rege Tätigkeit zu entfalten beginnt, dass die Krakauer Akademie durch Herausgabe einer Reihe von einschlägigen Monographien sich für die Forschung verdient machte, sowie schon vordem Oskar Kolberg in seinem noch wiederholt zu nennenden bändereichen Werke „Lud” dem gleichen Gegenstande eine liebevolle, wenngleich den wissenschaftlichen Anforderungen zuweilen nur in geringem Masse Rechnung tragende Sorgfalt angedeihen liess. Ich spreche somit an dieser Stelle von Kolbergs Sammelwerke in Bezug auf die dialektologische, das heisst also streng linguistische Fragen, berühre aber dessen eigentlichen Inhalt mit keiner Silbe (Was des Pudels Kern ist, weder da noch sonst). Herr Fr. S. Krauss muss dies natürlich sofort verdrehen und operirt wieder mit einer Unwahrheit, nur um damit eine Schmähung, deren ich mich Kolberg gegenüber angeblich schuldig machte, stützen und mir obendrein, wie dies schon nicht anders geht, ein par durch nichts motivirte Grobheiten an den Kopf werfen zu können.”
Solche Art des Widersprechens übte auch die alte Krassl „mit dem ledernen Nabel.” ²) Krassl (oder Crescentia) war oder ist, wenn sie noch lebt, eine betagte Hebamme im Dorfe, mit der die Honoratioren: der Pfarrer, Schulmeister und Dorfnotär zum eigenen Gaudium öfters über das Bachische System und
- 124 -
die Vorteile des kroatischen Selfgovernments zu politisiren pflegten. Die Alte schwärmte für Minister Bach oder richtiger in der Erinnerung an einen Bachhusaren, mit dem sie ihrer Zeit manche vergnügte halbe Stunde verlebt haben mochte. Wenn ihr der Faden ausging, überschüttete sie ihre Mitunterredner mit spitzigen Glossen. Das war jedesmal die Krönung des Spasses. Ein barfüssig Büblein mit dem Zumpel draussen, ein kleiner barhäuptiger Kammfeind, ein Stotterer, dem das Reden schwer fiel, staunte, hingerissen von Bewunderung, die Zungengeläufigkeit der Frau Krassl „mit dem ledernen Nabel” an. Trotz dem Rate meines altrömischen, satirischen Genossen Horaz: „nil admirari” muss ich die Gewandtheit Kreks bewundern, mit der er der Besprechung des „Inhaltes” der Kolbergischen Werke auszuweichen versteht. Sagte der Pfarrer, die bürgerliche Freiheit im kroatisch-slavonisch-dalmatischen dreibeinigen Königreiche wäre die Erfüllung idealer Wünsche, so replizirte Krassl „mit dem ledernen Nabel,” indem sie das Lob ihres Leibhusaren anstimmte. Bei Krek muss die Dialektologie für den Leibhusaren eintreten.
„Hoide kus zworach Sack,” ¹) sagt dazu das russischjudendeutsche Sprichwort. Eines passt nicht zum anderen. Kolberg hat sich sein Lebtag für keinen Grammatiker ausgegeben, und doch wird es kein verständiger Leser seiner Schriften bestreiten, dass jener im kleinen Finger mehr Grammatik inne hatte als zehn Kreke, und mehr für die slavische Mundartenkunde geleistet hat als fünfhundert Korallenfabrikanten mit ihrem ganzen Leib und Leben. Er war nur kein Schuderer, kein Silbenstecher, kein Himmelflicker, kein Wortklauber, kein Akzentschleifer, er war blos ein Genie, Krek aber gebricht es an Talent, um jenes Genie zu begreifen und seinem Verdienste nach zu würdigen. Ob Krek das Riesenwerk Kolbergs gesehen und in Händen gehabt, will ich nicht im Ernste anzweifeln, denn er verweist auf einige Kapitelüberschriften, doch die Vermutung, dass er die Reinheit seiner Seele durch die Durchlesung des Werkes befleckt habe, müsste man als eine schnöde Verdächtigung abweisen. Krek kennt das Werk Kolbergs auswendig, nicht inwendig.
Woher das kommt, ist unschwer zu erfassen. Für Krek ist eben der Sammler eine nicht ganz gesellschaftfähige Person;
- 125 -
bei ihm fängt der Mensch erst beim Dialektologen an. Die Lehrer in Israel waren seit jeher milderer Anschauung, und die war mir schon in meinen Jünglingjahren von meinem Vater eingeschärft worden, noch bevor ich das Glück hatte, die Arbeiten unserer neuzeitigen Ethnographen kennen zu lernen. Abraham Ben Nathan Jarchi aus dem rebenumrankten Lunel in Südfrankreich schrieb ums Jahr 1204: „Es heisst, sich zu einer wichtigen Tat aufzuraffen, eine bedeutende geistige Arbeit vorzunehmen, die Bräuche der Städte und Länder zu beobachten.” Sein Ha Minhag (Der Brauch) ist ein volkwissenschaftliches Werk, das jetzt, nach schier vollen siebenhundert Jahren, erst recht zur Geltung kommt. Und David Kimchi, um mich auf eine so unter Juden wie Christen allgemein anerkannte literarische Grösse zu berufen, bemerkt in der Einleitung zu seiner Erklärung der Propheten: „Deshalb heissen die Weisen „Männer der Sammlungen” (Pred. Salom. 12, 1¹), weil sie ihre eigenen Worte und die anderer in Bücher sammeln, dass sie für immer aufbewahrt und zu stetem Gedächtnisse bleiben; ihnen wird guter Lohn für ihre Bemühungen zu Teil und ihre Gerechtigkeit besteht immer.”
Kolberg ist uns nicht ein Name, sondern ein Born der Wissenschaft von unversieglicher Stärke. Das meinte auch Isidor Kopernicki in der Pädagogischen Encyklopädie (Warschau 1885), ¹) wo er unter anderem die Verdienste Kolbergs, von dessen Werk damals erst 19 Bände vorlagen, so abschätzt: „Schon die imponirende Anzahl der in diesen 19 Bänden ethnographisch beschriebenen sechs Provinzen zeugt von der umfangreichen Leistung und dem unendlichen Verdienste Kolbergs auf dem Gebiete der Ethnographie. In jedem dieser Bände, die wahrhaftig mustergiltig sind, bemühte er sich, nach Massgabe der gewonnenen Stoffe, alle Eigentümlichkeiten des Lebens und alle geistigen Erscheinungen der Bevölkerung der betreffenden Provinz zu schildern Überblicken wir die bisherigen Arbeiten Kolbergs, so erscheinen sie uns als eine so unerschöpflich reiche Schatzkammer ethnographischer Materialien über unser Volk und zugleich als ein so strahlend
- 126 -
köstlicher Gewinn für die heimische, die slavische überhaupt und die allgemeine Völkerkunde, wie ähnlich noch in keinem Lande und bei keinem Volke durch die Arbeit eines einzigen Mannes diese Wissenschaft beschenkt worden ist. ¹) Indem sich Kolberg dies unbeschreibliche Verdienst erwarb, ist er seit zwanzig Jahren der Hauptrepräsentant polnischer Ethnographie, oder besser, deren unvergleichlicher Meister und das Musterbild der gegenwärtigen und zukünftigen Arbeiter auf diesem Gebiete.”
Ludwig Kuba, der čechische Ethnograph, ein namhafter Erforscher und Kenner der slavischen Volkmusik, äusserte sich nicht minder rückhaltlos anerkennend (Osvěta, Prag 1888. Hft. 8) ²) : „Dank den Werken Kolbergs überragt die polnische ethnographische Literatur unter gewissen Gesichtpunkten die russische, obgleich diese günstigerer Lebensbedingungen sich erfreut und eine stattliche Anzahl, gut organisirter und materiell bestens gestellter Arbeiter aufweist. Um so höher ist daher unsere Bewunderung für die Leistungen Kolbergs, als sie von einer einzigen Person vollbracht wurden und trotz ihrem gewaltigen Umfange nicht allein vom Standpunkte der descriptiven Ethnographie, sondern auch von dem der Musik systematisch, vollendet und erschöpfend sind.”
Diese Abschweifung war ich dem Andenken meiner teueren Freunde Kolberg und Kopernicki, deren Bilder von der Wand über meinem Schreibpulte auf mich herabschauen, und der Ehre deutscher Wissenschaft schuldig. Jetzt darf ich mit Befriedigung Kreks Verdikt über mich aus der „Abfertigung” anführen:
„Herr Fr. S. Krauss ist empört darüber, dass ich ihn nur als Sammler gelten lasse. Auch das werde ich - und gewiss nicht ich allein - in Hinkunft bleiben lassen. Wer selbst in Dingen, die jeden Augenblick der Kontrole unterzogen werden können, mit der Wahrheit so leichtfertig umspringt, der verdient überhaupt keinen Glauben, er hat sich selbst diskreditirt für immer.”
Mit Vergunst! Euere gestrenge Gnaden beliebten nur misszuverstehen und hoffen nun, dass ich zerknirscht in Euere
- 127 -
Schlinge meinen Hals bette. Im Texte stand und steht wiederum: „ich und Kolberg und andere unseres Gleichen gelten ihm blos als Sammler” u. s. w. Ihr scheint nicht recht deutsch zu verstehen. Einem leichtsinnigen Verschwender gilt das Geld wenig oder nichts, doch gelten lassen muss es er und jedermann; denn der Staat garantirt für das Geld; ob es einer mehr oder weniger achtet, ist dem Staate fast gleichgiltig. Den Verschwender und den Schwachsinnigen, denen Geld nichts gilt, stellt der Staat unter Kuratel Von einem „Nur als Sammler gelten lassen” war keine Rede, daher ist auch das gemutmasste Empörtsein Eure Koralle und so mögt Ihr auch die Schlussfolgerung für Euch behalten. Ferner gefällt es Euch, über mich die Strafe des in Hinkunft Nichtmehrgeltenlassens zu verhängen! Kruzitürken, das geht mir über den Spass! Das wäre ja in pessima forma eine Entziehung der Konzession! Ich remonstrire, protestire, rekurrire und appellire an die löbl. k. k. Gewerbebehörde, an die hochlöbliche k. k. Statthalterei und an das hohe k. k. Reichgericht wegen Annullirung Eueres Verdiktes, alldieweilen ich bis jetzunder ohne offizielle Intimation geblieben, dass Ihr zu Graz in Steiermark befugt seid, Sammlerlizenzen und Konzessionen ad libitum zu gewähren oder nicht mehr welche gelten zu lassen. Ich supponirte bis dato, Marktberichterstattung sei an keine andere Konzession gebunden als an die des Wissens, Könnens und der Urteilkraft. Ex improviso deklariret Ihr Euch nunmehro als ein gewerbebehördlicher Konzessionendezernent! Bevor ich bussfertig zu Euch über die steierischen Alpen nach Krekanossa pilgere, um meine Opposition zu revoziren, animire ich unseren Bezirkablegaten, den Antisemiten mit der ausgewetzten Schnautze, zu einer Interpellation an den Handelminister im Parlamente; denn ich negire nicht nur die Heiligkeit Eueres Anathemas, sondern auch Euere Kapazität zum Amte eines Sammlerkonzessionerteilers.

Fast 80 Seiten des „II. Buches” beschäftigen sich mit der Polyphemsage und ihrer internationalen Verbreitung. Ich überlasse es dem Urteil eines jeden vernünftigen Fachgenossen zu entscheiden, ob man nach dem Titel des Buches und dem schleppenden Gang der früheren Auseinandersetzungen Kreks eine derartige Spezialuntersuchung erwarten darf,
- 128 -
eine Untersuchung, die zum Überfluss resultallos verläuft und lediglich Kreks mitleiderregende Hilflosigkeit im Folklore offenbart. Was für einen patriotischen Standpunkt er der Überlieferung gegenüber einnimmt, offenbart er uns pathetisch auf S. 742, wo er von den „Hundeköpfen” spricht:
„Manches derartige ist [aus der Literatur] in der lebendigen Volküberlieferung erhalten geblieben und amalgamirte sich damit, so dass es als Lehngut nicht mehr gefühlt wird, wie wir dies gerade an dem obenerwähnten wertvollen slovenischen Volkliede, in das nach diesem Vorgange unter das einheimische mythologische Gold die fremde Schlacke sich mengte, deutlich beobachten können.”
Wir Ethnographen und Folkloristen lernen da urplötzlich eine neue, prinzipiell wichtige Unterscheidung in Volküberlieferungen kennen: einheimisches, mythologisches Gold und fremde Schlacke. Kann man nichtssagendere, böhmische Korallenphrasen in die Wissenschaft einschmuggeln? Volkkunde ist eine Erfahrungwissenschaft, die streng auf gut beobachtete Tatsachen des Seelenlebens der Volkindividuen sich stützen muss und sich stützt, doch bei Leibe mit keinem nationalen Golde, mit Schlacken und böhmischen Korallen schachert. Es ist nur selbstverständlich nach Kreks Methode dass er (S. 747) „unsere slavischen einschlägigen Märchen (Polyphemsagen), Einzelnheiten abgerechnet, für einheimisches Gut hält.”
Wer Kreks Buch liest, um daraus slavische Mythologie zu lernen, wird klug wie der Honigesser im Talmud. Da lehrt nämlich ein Rabbi: „Wer weise werden will, soll Honig essen, wer aber Honig isst, um weise zu werden, ist ein Narr.” Krek verfällt mitunter in eine mystische Mythenexegese in der Art der von Beda Venerabihs im achten und Rhabanus Maurus im neunten Jahrhundert formulirten Lehre vom vierfachen Schriftsinne: historia (littera), tropologia (moralis), allegoria, anagogia. Dadurch hat er sich die Freiheit gewahrt, aus jedem Ding, alles, was ihm just einfällt, zu machen. Was er uns z. B. über slavischen Sonnenkult und speziell über südslavische Sonnenmythen vorerzählt, sind grösstenteils böhmische Korallen zweiter Ordnung, ist ein pfadverschlungener Irrtum, der seinen Höhepunkt auf S. 846 ff. erreicht, wo Krek durch Missverständnis und aus Unkenntnis der Volkbräuche eine Bauerngeschichte in Versen als einen „Sonnenmythos” erklärt, „den wir bei Besprechung des mythologischen Wertes der Lieder nun einmal im Auge haben.” Diese angeblichen Sonnenmythen zerfasert und zerschleisst das
- 129 -
erste Kapitel meines Buches „Volkglaube und religiöser Brauch der Südslaven,” wo auch die angedeutete Dorferzählung des ihr von Krek angedichteten mythischen Nimbus entkleidet wird. Einmal musste mit diesen böhmischen Korallen aus der Götterwelt, mit dem krekologischen Firlefanz gründlich aufgeräumt werden, um Platz zu schaffen für die nüchterne volkwissenschaftliche Forschung. Die durch böhmische Korallenfabrikation künstlich erzeugte Sonderstellung der Slaven in mythologischen Dingen hört damit auf, und die slavische Überlieferung wird gleich jener anderer Völker ein ergiebiges Forschunggebiet zum Nutz und Frommen der Volkkunde als einer (internationalen) Wissenschaft. Die ersten und berufensten Forscher haben einstimmig die Richtigkeit meiner Darlegungen anerkannt und mich dafür ehrend
ausgezeichnet.
Zwei reizend hübsche, allerliebste böhmische Korallen will ich noch hervorheben. Auf S. 792 f. sagt der k. k. ö. ordentliche Univers.-Professor Gregor Krek:
„Das Auffressen der himmlischen Lichtkörper durch einen Wolf ist ausgesprochen in dem Satze „Sěryj volk na nebě zvězdy lovit (der graue Wolf fängt am Himmel die Sterne). - Dass man in dem Koledafeste in der That die Feier der Geburt der Sonne zu suchen habe, beweist wieder ganz deutlich folgendes serbische Sprichwort: Pitali kurjaka: kad je najveća zima? a on odgovorio: Kad se sunce radja. (Man fragte den Wolf, wann die grösste Kälte sei, und er erwiderte: Zur Zeit, wo die Sonne geboren wird.) - - Diese und ähnliche Sprichwörter sind ohne genauere Analyse verständlich.”
Der erste „Satz” ist ein Kinderstubenrätsel, für das es ein Schock Varianten gibt. Auflösung: „Wolke am nächtlichen Himmel.” Auch die Verdeutschung Kreks ist unrichtig, denn es muss heissen: „Ein grauer Wolf jagt am Himmel Sterne. [Was ist das?]” - Der zweite Satz ist weder ein Rätsel noch ein Sprichwort, sondern ein Bonmot (apte dictum) der volktümlichen Meteorologie. Krek las den Satz: „Sunce se ragja” (die Sonne wird geboren) und es klang ihm geheimnisvoll. Auf Grund seiner Kenntnisse vom Bau des Kosmos musste er sich gestehen, dass die Sonne nicht geboren wird. Kurzum freudig bewegt erkannte er, dass er den Sinn der Frage und Antwort nicht verstehe, und was er nicht versteht, das ist Mythologie. Daraufhin setzt er ohne Skrupel den Spruch in unmittelbare Verbindung mit dem „Koledafeste” und der „Feier der Geburt der Sonne.” Für zutreffend billige ich nur die Schlussbemerkung, dass dieser Satz ohne genauere
- 130 -
Analyse verständlich ist, doch nur jenem, der die Ausdruckweise der serbischen Volksprache mit ihrem Reichtum an Metaphern kennt.
Wir sagen deutsch: „die Sonne geht auf” und bekunden damit täglich und stündlich eine klägliche Unwissenheit betreffs der Mechanik des Himmels, als ob es nie einen Kopernikus, Galilei, Herschel und Laplace gegeben. Der Serbe ist wo möglch noch gleichgiltiger gegenüber den exakten Forschungen der Astronomen, indem er von der täglichen Wiedergeburt der Sonne daherredet. Nicht genug damit, er lässt sie sogar in der rauhen Winterzeit beim nahenden Frühling erst recht eine Generalwiedergeburt durchmachen.
Zeitlich morgens, wenn sich das Frühlicht zeigt, (oder wie der serbische Guslar singt:
istor zora iskesila zube
just zeigte sich Aurora zähnefletschend,
oder:
istom zora pomolila lice
just streckte vor ihr Angesicht Aurora,
während der klassische Grieche um die gleiche Tagzeit der Eos Rosenfinger zu erschauen glaubte) steht die Temperatur am niedrigsten, wie uns Barometer und Thermometer lehren. Die Hauptgeburt der Sonne erfolgt in den Monaten Februar-März. Die Märzsonne (marčano sunce) hat bei den serbischen Alpenbewohnern einen schlimmen Ruf. Darüber witzelt unser Bäuerlein, indem er den ständigen Gast der Sonne, den Vetter Isegrimm, mit der Frage, wann es am kältesten sei, aufzieht. Isegrimm, durch die winterliche Hungerkur mürbe geworden, erwidert arglos: „Zur Zeit der Sonnengeburt.” Darin liegt die Pointe, dass der Wolf die triviale Erfahrung der Bauernregel bestätigt. Er weiss es durch eigenen Jammer am besten, worüber der Bauer seine Schadenfreude hat. Im Sommer, wann die Gänse barfüssig gehen, stattet der Wolf dem Bauern keine Besuche ab und spricht sich mit ihm nicht aus. Der Wolf nimmt im Weistum der Südslaven einen sehr grossen Raum ein. Es gibt auch schon seit vielen Jahren eigene Zusammenstellungen, so z. B. von Stojanovic und Vrcevic über den Wolf im Sprichwort. Hätte Krek davon Notiz genommen, er würde sich trotz seiner mangelhaften Kenntnis der serbischen Sprache, die Anfertigung der böhmischen Sonnenkoralle erspart haben.

- 131 -
Den grössten Nachdruck legt Professor Krek auf die dicke Wehr von Bemerkungen unterm Striche. Da schaltet und waltet er mit Lust und sonder Zwang. Da bringt er sein letztes Excerptchen noch unter, hier kritisirt und spintisirt er, dass die Splitter in der Nachbarschaft herumfliegen. Ohne Übertreibung, der dritte Teil davon ist unnützer Ballast. Darunter sind mir einige wegen ihrer schlecht versteckten Gehässigkeit und der hämischen Sucht, auf Kosten deutscher Schriftsteller sich und sein quasselpatriotisch Publikum zu erlustigen, unangenehm aufgefallen. Krek ist als Kritiker überhaupt häufig ergetzlich. Selten versteigt er sich zu einem Urteil über die Gesammtleistung eines Autors, woraus ersichtlich wäre, wie und was und wodurch der Mann die Wissenschaft gefördert, wo der angesetzt und jener aufgehört, vielmehr spricht er am liebsten als infallible Autorität vom Katheder herab, als ein uir inlustrissimus, teilt Gnaden und Ungnaden aus, kanzelt den einen ab und nickt huldvoll dem andern zu. Auch liebt er es, aus dem und jenem Buche kleine Schnitzer und Fehler herauszugreifen, die ihm offenbar nicht passirt wären.
In der für sentimentale Frauen und höhere Jungfrauen bestimmten Wochenschrift „Über Land und Meer” von 1884, Nr. 7 gibt K. Braun in Wiesbaden seine Reiseerinnerungen aus Krain zum Besten. Unter anderem teilt er dort, wie wir aus Kreks Buch erfahren, eine unzutreffende Beobachtung über den Gebrauch der Sense bei den Slovenen mit. Niemand dürfte mehr als Braun, ehemals Feuilletonredakteur der „Münchener Allgemeinen Zeitung” und noch jetzt ein redegewandter Plauderer vieler Frauen- und Tagblätter, darüber erstaunt sein, dass ihn Krek gelegentlich der Besprechung der „einzelnen Phasen des Ackerbaues” bei den alten Slaven gleichsam als den Typus oberflächlicher deutscher Gelehrter an den Pranger stellt. Prof. Krek sagt von Braun (S. 124):
„Münchhausen redivivus. Man merkt die Absicht und lacht über diese Art Gründlichkeit.”
Krek hat unzweifelhaft die Geschichte Bürgers von des Freiherrn von Münchhausens weltberühmten Taten nie zu Gesicht bekommen; denn sonst könnte er unmöglich den schlichten Journalisten Braun einen neuerstandenen Münchhausen nennen. Es wirkt erheiternd, wenn Krek, k. k. ö. ordentlicher Professor der slavischen Philologie „Gründlichkeit” und tiefere Kenntnisse bei dem Plauderer einer Damenzeitung sucht. „Man merkt die Absicht” Kreks, deutsche Forscher in den
- 132 -
Augen seiner Zuhörer und Leser herabzuwürdigen, und man ist davon höchlich erbaut. Auch Anastasius Grün kommt einmal (auf S. 739) in einer langen Anmerkung unter Kreks grammatische Tranchirhacke. Krek wirft ihm vor, mit Bezug auf eine Stelle, die durchaus nichts mit der slavischen Literaturgeschichte zu schaffen hat, und die ins Buch wie eine Faust aufs Auge passt, dass er (Grün) roŽič (Hörnchen) mit roŽica (Röslein) verwechselt habe. Daran knüpft Krek eine Auseinandersetzung über die Etymologie von rog (Horn) an, als ob diese hier jemand suchen oder verlangen würde. Grüns unbeabsichtigte Flüchtigkeit - einen Fehler kann man es kaum heissen - hindert den Herrn Professor Krek doch nicht, das Lied in Grüns Verdeutschung zu bringen. Fast müsste man annehmen, Professor Krek zitire die Übersetzung nur darum, um Grün, dem toten Löwen, einen Tritt versetzen zu können. Die Urnurslovenen in Laibach haben vor einigen Jahren die Büste Grüns, ihres grossen Wohltäters, mit Unflat beworfen und zu zertrümmern versucht, warum sollte es einem Professor Krek verwehrt sein, Grün wegen eines Übersetzungschnitzers, der sich in den „Volkliedern aus Krain”, Leipzig 1850, vorfindet, noch im Jahre 1887 in den Kot zu zerren? Grün ist ihm ein verhasster Deutscher, ein liberaler Freiheitkämpfer, eine der ersten Zierden der deutsch-österreichischen Literatur. Grosse Schuld genug. Darum also keine Nachsicht, keine Schonung, keine Vergebung und keine Verjährung, selbst nach 27 Jahren nicht. Ein bosnisches Geschichtchen fängt so an: Als der Zigeuner zum König erwählt worden, hing er zuerst seinen Vater auf ....
Zwanzig Jahre lang reitet Krek auf dem einen Schnitzer herum. Müssen denn durchaus alle nachwachsenden Generationen seiner Hörer und Leser diesen einen Schnitzer sich einprägen? Soll etwa dieser Schnitzer Grüns, wie so mancher Vers seiner Lieder, zum geflügelten Worte werden? Na, meinetwegen, um Krek einen Gefallen zu erweisen. Mancher lustige Übersetzungfehler und manches Missverständnis eines Autors oder des Setzkastenkobolds haben ihr Glück in der Welt gemacht. Berühmt ist jener Schnitzer Luthers in seiner deutschen Bibel: „Eher wird ein Kamel durch ein Nadelöhr” u. s. w. Das alte Testament kündet mit keiner Silbe, dass Kamele die hysterische Neigung besässen, sich durch eine Nadelöhre hindurchzuzwängen, doch so mancher alttestamentarische Junggeselle dürfte sich gemopst haben, wenn er, im Begriff
- 133 -
die aufgetrennten Nähte seines Mantels zu heften, die Entdeckung machte, dass der Zwirn „dick wie ein Strick und die Nadelöhre winzig wie eine Sandlaus” sei. Im hebräischen Bibeltexte steht das Wort gomol, das sowohl (dickes) Schifftau als auch Kamel bedeuten kann. Luther gab dem Kamel den Vorzug und ist trotzdem ein ziemlich angesehener Schriftsteller geworden. Ich habe mir voriges Jahr sogar eine neue Ausgabe seiner Werke eingewirtschaftet. Die ungarischen Juden nennen Slavonien und Kroatien das Schweineland, das heisst Chazirmedine. Warum so? Die Schweinezucht im ungarischen Tieflande ist ja ungleich entwickelter als die in Kroatien und Slavonien! Weil vor Zeiten Slavonien und Kroatien nach dem Save- (Sau-) Flusse, das Sauland genannt wurde. In Nordamerika: heissen die Irländer bei den Juden die Bezimer; (Bezoh ist hebr. das Ei, bezim die Eier [auch im Sinne des lat. Wortes testes]) denn die Yankees sprechen den Namen wie „Eierländ” aus. Sprachunkenntnis hat auch bei geographischen Namengebungen zuweilen mitgewirkt und prächtigen Treppenwitz geheiligt. Als die Spanier zum erstenmal an der mexikanischen Halbinsel Yucatán landeten, fragten sie die Urbe wohner: „Wie heisst das Land?” und erhielten die ständige Antwort: „tecte án?” (ich verstehe euch nicht [nach Egli, Geschichte der Namenkunde]). Also heisst jener mächtige Strich noch heutigentags, richtig übersetzt, das Ichversteheuchnichtland. In Bosnien und Serbien hat der Deutsche den Spitznamen „Wósokter,” das heisst „was sagt er,” weil der des serbischen unkundige Reisende an seinen Dolmetsch öfters diese Frage zu richten pflegt. Die in der Bandasee, westlich von den Aruinseln gelegenen Ewâf-Inseln (Schweine-Inseln) führen den allgemeiner bekannten Namen Key-Inseln (auch Kai, Kei und Keei geschrieben), vielleicht aus dem missverstandenen „Kei wait” (ich weiss nicht) der Eingeborenen entstanden, womit sie unverständliche Fragen der ersten fremden Besucher beantworteten (Globus LXIL Nr. 20. S. 314; Ausland LXVI, Nr. 22. S. 340).
Ins Gebiet der Korallenfabrikation fallt dagegen die in neuester Zeit von einer hochwohlvermögenden Persönlichkeit aufgestellte Erklärung des Namens Guanahani, die, falls sie just keine Koralle wäre, die vorigen zwei Beispiele durch ein drittes vermehren würde. Einem spanischen Akademiker gebührt der Ruhm, den Namen jener Insel, auf der Kolumbus
- 134 -
zuerst die neue Welt betreten, auch zuerst richtig gedruckt zu haben. Auf den Schiffen des Kolumbus befand sich auch eine Menge von Juden - zwar kommen unter den uns urkundlich bekannten neunzig Gefährten des Entdeckers keine Juden vor, aber offenbar beruht dies nur auf einer Vergesslichkeit, denn Juden tragen an allem die Schuld. - In der Entdeckungnacht spazierten zwei Juden auf der Schiffbrücke auf und ab: der eine rief auf hebräisch: „Siehe, dort ist Land!”(Ji!) Der andere fragte: „Wo denn?” (Waana?) Darauf der erste: „Siehst du denn nicht da das Land?” (Hen-i?) Dies alles zusammen gibt: Waana-hen-i. (Henry Harrisse in Christophe Colombe devant l'histoire, Paris 1892.)
Aller guten Dinge sind drei. Auch ich will diesem Spruche nicht untreu werden und auf ein drittes kritisches Beispiel bei Krek hinweisen. Im Feuilleton der Wiener Zeitschrift ,Zukunft' vom J. 1867, Nr. 153, hat ein Ungenannter eine Übersetzung des bei Rakovski im „Wegweiser” (1859, S. 127 - 129) abgedruckten Liedes veröffentlicht. Echtere Poesie in echterer Prosa ist noch nie so glücklich vereinigt zu lesen gewesen, z. B. wie sangbar klingen die Verse:
Könnt' er ja doch nicht die Stumme freien!
Bittet er als Brautjungfer sich die Fürchterliche.
Der Anonymus verdeutschte irrigerweise den Frauennamen Grozdanka (die Traube) mit „Fürchterliche” als ob er aus groz'n (grausig) entstanden sei. Das war einmal ein fetter Fang für Krek. Er druckte unter obligater Zurechtweisung des Feuilletonisten das Lied zuerst in dem bewussten Gymnasialprogramm, dann in der einteiligen zweiten und nun auch in der zweigespaltenen dritten Auflage ab. (S. 848 - 851, und dazu früher zwei Dritteile der 534. Seite!) Ein anderer Slavist würde sich so ein Lied selber korrekt verdeutscht haben. Mir fällt dazu eine alte jüdische Schnurre ein. Eine Jüdin las zum erstenmale die Bibel deutsch und zerfloss in Thränen, als sie die Geschichte, wie Josef von den Brüdern nach Egypten verschachert worden, durchgenommen. Als sie im nächsten Jahre zu demselben Abschnitt kam, stutzte sie und war sehr niedergeschlagen, weil die hartherzigen Brüder ihr frevles Spiel erneuert hatten; wie sie jedoch im dritten Jahre nochmals dieselbe Erzählung las, da rief sie ärgerlich aus: „A Kränk af Jossef, wer' ich wanen! War' er ka Narr gewön, hätt' er sich nit wieder verkafen lass'n!” Als ich das erstemal die Fürchterliche in Kreks Programmbüchlein antraf,
- 135 -
war ich sehr erfreut; als sie mir in der 2. Auflage begegnete, begrüsste ich in ihr eine gute Bekannte, wie sie mir aber auch in der 3. Auflage aufstiess, nahm ich mir vor, dem Herrn Krek mir zu Liebe eine lesbare deutsche Übersetzung nach dem Original bei Rakovski gratis et con amore für die 4. Auflage zu liefern; denn die Fürchterliche wird einem zuletzt wirklich fürchterlich.
In der Berichtigung fremder Schreib- und Druckfehler entwickelt Krek einen merkwürdig grossen Scharfsinn. Er würde als Korrektor in jeder Buchdruckerei seinen Platz ehrenvollst ausfüllen. Was hätte ein Uhland für einen solchen Korrektor gegeben! Seinen Gedichten schickte er eine Widmung voraus, die so anhebt:
Lieder seid Ihr, euer Vater
Schickt euch in die Welt hinaus!
Als das Buch schon fertig war, entdeckte er, dass der Buchstabe i im ersten Worte ausgefallen sei. So etwas ist einem Krek noch nie widerfahren und darum ist er von unerbittlicher Strenge gegen jeden Nachlässigen. Ich bin minder schroff und neige mehr dem Franziskanermönche zu, der da sagte: quandoque et bonus dormitat Homerus (d. h.: zuweilen liebte auch der selige Homer einen Schlaftrunk) und eine volle Flasche Wein aus dem Refectorium mit in die Zelle nahm.
Wenn es sich Herrn Krek um irgend einen in den weitesten Kreisen unbekannten obskuren und skurilen slavischen Korallenfabrikanten handelt, so überquillt er gar bald von Lob. Mit einigen slavischen Gelehrtennamen treibt er wieder förmlichen Fetischkult. Vor dem Agramer Koch-Kuhač (siehe oben im ersten Teil der böhmischen Korallen S. 53) wirft er sich einmal fast auf den Bauch. Veckenstedts böhmische Korallen aus dem Wendenlande (Graz 1880), die er (Krek) an den Verleger gebracht, citirt er natürlich, als ob Veckenstedt über jeden Tadel erhaben wäre. (S. 575, Anm.) Wie denn nicht, Veckenstedt war oder ist noch sein Schützling. ¹) Trstenjak (siehe oben S. 65), Hannš, Erben und Nodilo nennt er in einem Athem mit den ehrenwertesten und hervorragendsten Volkforschern Europas. Die Stelle lautet (S. 624):
„Wir brauchen kaum zu bemerken, dass die contemporäre Mythenforschung auf Märchen und Sagen die gebührende Rücksicht nimmt, und gehören denn die Arbeiten eines F. Buslaev, A. Afanasĭev, 0. Miller, A. Potebnja, Dav. Trstenjak, I. J. Hanuš, K. J. Erben, N. Nodilo . . . ebenso hieher, wie mehr oder minder die von A. Kuhn, F. L. W. Schwartz, K. Simrock, W. Mannhardt, J. W. Wolf, F. Linnig, M. Bréal, Ang. de Gubernatis, W. R. S. Ralston und der grossen Zahl anderer Mythenforscher.”
- 136 -
„Wie mehr oder minder!” Sagen wir lieber: nicht am mindesten! Altmeister Schwartz in Berlin kann sich etwas darauf einbilden, dass ihn Krek einem Nodilo und Hanuš anreiht. Über den Čechischen Korallenfabrikanten Hanuš mochte ich im ersten Teile nichts schreiben, weil er doch auch im Heimatlande abgetan ist. Er gehört eigentlich zu den Etceteramythologen, von denen Karłowicz a. a. 0. in der Mélusine (S. 136) spricht, wo er nach Anführung der verlässlichen Quellen über lithauisches Volktum, so schliesst: „tout ce trésor de la bonne et vraie monnaie est resté clos pour M. Veckenstedt: il a dû se contenter de jetons et de fausse monnaie .... Mais au lieu de cela il a fait connaissance, d'une façon superficielle au moins, avec des mythologues d'ancienne école, bien connus par leur manque de critique et que personne ne cite aujourd'hui, tels que Schwenck, Hanusz, Narbutt, etc.”
Ein klassisches Beispiel für eine vollständig überflüssige, bei den Haaren herbeigezerrte lange Anmerkung findet sich auf S. 673, wo Krek eine Etymologie von pretil (feist, fett) breit schlägt. Zweifelt denn irgend jemand, der slavisch versteht, an der Bedeutung des Wortes pretil, welches zudem in jedem Wörterbuche richtig erklärt vorkommt. Doch genug für diesmal von solcher Kost.
So steht dieser Absatz wörtlich auch in Prof. Max Kochs Zeitschrift zu lesen. Für mich, der ich ebensowenig, wie Prinzess Sosa, Märchen ersinnen und böhmische Korallen fabriziren kann, ist der Sinn klar. Ich meinte eben, das eine Wort aus dem krekischen Texte habe durchaus keiner weiteren Erläuterung bedurft, weil dessen Bedeutung offenkundig und zweifellos sei. Der Text lautet nämlich bei Krek (S. 672 f.):
„Der Riese fängt an sie am Nacken zu befühlen, um zu sehen, welcher von Beiden feister sei,¹) damit er ihn schlachten und braten könne.”
Zu 1) gibt er uns zwölf Zeilen Kleindruck Anmerkung mit der Etymologie von „fett, feist.” Daran nahm ich Anstoss, weil mich die Anmerkung unnötigerweise in der Lectüre des Textes unterbrach. Was tut aber Krek in seiner „Abfertigung”? Er schürzt die Ärmel auf, sagt: allez, passez, changez, hop! und hast dus nicht gesehen, hat er aus meiner Bemerkung die allerniedlichste böhmische Koralle hervorgezaubert, mit
- 137 -
meinem Namen versehen und überreicht sie mir. mit einer graziös verzerrten Miene zum Geschenke. Ich nehme sie mit Vergnügen und dankbarst an, weil ich nun auch meine eigenste böhmische Koralle besitzen werde, die mir nichts kostet und mich umsomehr erfreut. Indem ich sie hier veröffentliche, reihe ich sie in meine Sammlung ein. Sie lautet:
„Den Kommentar zu dieser Art Schriftstellerei kann sich auch der den Dingen ferne stehende Leser selbst machen. Im sozialen Leben wird der Lügner als ehrlos gemieden, im literarischen Leben scheint man in diesem Punkte nachsichtiger zu sein, was Wunder, wenn es dann auch derlei Früchte zeitigt. Herr Fr. S. Krauss segelt schon lange unter dierer[sic] Flagge und rechnet dabei in frivoler Weise auf die Gutmütigkeit, um nicht zu sagen Unwissenheit der Leser, denn wie wäre es sonst möglich, mit derartigen Dingen förmlich öffentlich zu prunken und auf Gläubige zu rechnen? Er glaubt eben den Lesern alles, was ihm durch sein abnormal funktionirendes Gehirn fährt, bieten zu dürfen. Dabei läuft mit derlei Dingen natürlich vieles andere Wunderliche und Possirliche mit, wie z. B. der kostbare Satz auf Seite 387: für Wörter, deren Bedeutung feststeht, sei eine Etymologie überflüssig, ein Satz, womit gleich ein Stück philologischen Programms aufgestellt wird und (beiläufig bemerkt) ein würdiges Seitenstück zu dem Satze auf S. 386, dass sich Herr Fr. S. Krauss, der ja immer etwas Apartes haben muss, zur Bestimmung der Temperatur des Barometers bedient.”
Für einen Gott erklärt er mich nicht, blos für seinen grammatischen Korallenapostel. Viel ist das nicht, doch immerhin etwas. Besser etwas als gar nichts. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und wer den Apostel nicht ehrt, ist den Krek nicht wert. Ich hege jedoch trotz alledem Bedenken, ob ich das Geschenk behalten oder lieber dem Fabrikanten zurückerstatten soll; denn ich habe durch nichts den Beweis seiner Grossmut verdient, die bei näherer Prüfung des Falles mir als ein Akt der Übereilung erscheint. Weh demjenigen, der sich die Unerfahrenheit des Nächsten zur eigenen Bereicherung zu Nutze macht, und ich will lieber darben und entbehren, als den Vorwurf mir zuziehen, dass ich, dank der Unwissenheit Kreks, auch nur eine einzige böhmische Koralle für meinen Ruhm zum Privatgebrauche widerrechtüch mir angeeignet, ja dass ich ihn um seine Kostbarkeit beraubt hätte.
Es ist keine Kunst, einem taubstummen bosnischen Schildkrötenbändiger den musikalischen Unterschied zwischen der Bravourarie der Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte und Richard Wagners melodischem Wigelawajahothotbandwurm
- 138 -
in Nickelmünzen zum Bewusstsein zu bringen; eine Kunst ist, Herrn Prof. Krek, von der Freigebigkeit ab-, und ihm den klaren Sinn meines von ihm beanständeten[sic] Tadelsatzes beizubringen. Nun, ohne Selbstüberschätzung darf ich mir schmeicheln, dass ich in meinen Studentenjahren sowohl als Hofmeister wie auch als Stundengeber den verstocktesten Stierköpfen gegenüber gewöhnlich den pädagogischen Sieg im Prinzipe errungen habe; für den Zufall, dass meine Klienten ausnahmlos bei den Prüfungen durchfielen, war ich nicht verpflichtet aufzukommen; denn die Schuld traf immer nur die unbefriedigte Neugier der Professoren, die mehr fragen als meine Jünger der Weisheit beantworten konnten. Vielleicht habe ich mit meinem ehemaligen Duzfreunde Krek einen schöneren Erfolg.
Kreks etymologische Erklärungfreudigkeit frischt mir im Gedächtnisse eine Anekdote auf, die schon einen langen, weissen Bart hat. Es war in der Zeit, ehe das antischämistische Sumsenbachertum in Wien aufgekommen, als noch Wiener Gemütlichkeit und freundliche Zutraulichkeit im Kurs hoch stand. Kam mal eines abends, wie gewohnt, ein rescher Wiener Bürger mit seiner harben Godel ins Stammbeisl, erblickte am Tische einen feingekleideten „Fremden” steifleinen dasitzen und bequemte sich behäbig zu ihm hin mit dem üblichen Grusse: „Wünsch' Eahna an guat'n Ab'nd!” - Der Fremde feierlich: „Ich wünsche Ihnen einen guten Abend, du wünschest Ihnen einen guten Abend, er wünschet Ihnen einen guten Abend, wir wünschen u. s. w.” - Der Wiener
verdutzt: „Wos moanen's?” - Der Fremde: „Was meineich, was meinst du, was meint er, was meinen wir?” - Der Wiener aufgebracht: „So, wann's mi frozzeln wull'n, hau i Eahna ane oba!” - Der Fremde: „Mit nichten, o mein Herr und geschätzter Bürger der Residenzstadt! Meiden Sie Übereilung. Ich heisse Kornehus Bartholomäus Vervliet, bin aus Antwerpen und reiste nach Wien, um mich in der Kenntnis der deutschen Sprache zu vervollkommnen. Mein Präceptor schärfte mir vor meiner Abreise ein, bei jeder Gelegenheit mich in der Grammatik zu üben”
Der Minherr Nederlander war ein gerechter Mann, denn er wandelte jedes Wort, bezw. jeden Satz ab, Krek jedoch vergriff sich nur an dem einen
- 139 -
Worte feister. ¹) Sind etwa die fünfzehn vorangehenden und acht nachfolgenden Ausdrücke ungeratene Stiefwörter oder herrenlose Hunde, dass er ihnen seine Rechnung tragende Sorgfalt nicht angedeihen lässt? Ich vermisste schmerzlich die grammatische Gerechtigkeit; denn nichts erfüllt meine Seele so sehr mit Gram, als der Anblick unschuldig Zurückgesetzter, die sich nicht wehren können. Und warum sollte nur der eine, oben mitgeteilte Satz der Durchetymologisirung glücklich teilhaftig werden, warum nicht alle vom Titel des Buches angefangen bis zur Adresse der Druckerei? Wenn schon, denn schon, wie der alte Kniebeis vom Bisamberge sagt, dann hätte er ja in einem Aufwaschen auch gleich ein etymologisches Wörterbuch mehr kompiliren und exstirpiren mögen. Der Einwand, dass es schon genug etymologische Ladenhüter gebe, ist unhaltbar; denn Kreks Einleitung in der Stille des Verlagmagazins schreit förmlich nach Gesellschaft. Zu zweit langweilt man sich gründlicher.
Auf die Gutmütigkeit und Unwissenheit Kreks rechnend, hoffe ich nun, dass er seine böhmische Koralle doch wieder in sein Eigentum zurücknehmen und mich von der leidigen Dankschuld entlasten wird. Nur die etwas aparte Schlussbemerkung über den Barometer finde ich geistreich und wie man im Parlamente zu rufen pflegt: „sehr wahr!”

- 140 -
Noch eines zum Schluss. Für einen Deutsehen, der seine Sprache als ein Kunstwerk liebt und behandelt, ist Kreks deutsche Sprache Labsal und Erquickung. Er widmet ihr seine besondere steifbeinige, holperige „Sorgfalt,” so wie jener flügellahme, hinkende Storch in Kobaš, dem die Hälfte eines nassglitschigen langen Weiberstrumpfes im Schlunde stecken geblieben, zur Kurzweil der Bäuerinnen einen Kreistanz aufführte. Zur Erläuterung des unnachahmlichen Krekostils noch einige kleine Pröbchen:
S. 7: „Vorher jedoch ziemt es, schon an das Gesagte anknüpfend, Erwähnung zu tun.”
S. 147: , »Waren aber auch die Wohnungen unserer Vorfahren noch nicht gemauerte, so repräsentiren sie, wie wir sahen, immerhin schon einen so vervollkommneten Holzbau, dass man fehlginge, wollte man dieselben mit der Nomadenzeit in Kontakt bringen.”
S. 155: „Die Verteidigung war keine regellose, sondern ward die wehrhafte Mannschaft von Stammeshäuptern geführt und hatte sich den Befehlen derselben genau zu unterordnen.”
S. 172: „Lediglich in dem damit sprachverwandt sein wollenden Magyarischen u. s. w. u. s. w.”
Es wundert mich, dass es Krek verschmäht hat, sein Buch vor der Drucklegung dem liebenswürdigen Berufgenossen an derselben Universität, Professor Dr. Gustav Meyer, zur Durchsicht zu übergeben. Der versteht ein ausgezeichnet schönes und gefälliges Deutsch zu schreiben, wie er dies z. B. in seinen „Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkkunde” (Berlin 1885) und sonst oft glänzend dargetan hat. Professor Krek möge Meyers, auch inhaltlich gediegenes Werk zur Hand nehmen und fleissig daraus deutsch und noch etwas anderes lernen. Er scheint es noch nicht zu kennen, zum mindesten geschieht dessen in seinem Buche mit keiner Silbe eine Erwähnung, trotzdem es an fünfzig Stellen genannt zu werden verdiente.
Raten macht Schuld, und du selbst stellst Wechsel aus, wenn du Rat gibst, meint v. Hippel (Lebensläufe). Wie schon oben auf S. 120 bemerkt, will Krek niemandem verpflichtet sein. Er hält sich lieber an Schefers Laienbrevier (Oktober XVI), wo es heisst:
Kein Mensch kann eines andern Treppe brauchen.
So viele Häuser, so viel andre Treppen.
Wer Rat gibt, zwingt dir seine Treppe auf,
Ja, Schlimmeres: sein Leben, seine Weisheit!
Meine weisen Ratschläge hat aber Krek auf seinem Kerbholze! Für den Rat hat er für mich in der „Abfertigung” nur Schläge:
- 141 -
„Nichts charakterisirt Herrn Fr. S. Krauss besser, als die masslose Vergötterung, die er mit dem eigenen Ich treibt. Diese lässt ihn bei sich alles gross und erhaben, bei anderen alles klein und erbärmlich erscheinen. Da pocht er z. B. auf sein vortreffliches Deutsch und ist um Lehrer besorgt, die es anderen auch in dieser Vollkommenheit beibringen könnten, er bedenkt aber nicht oder weiss es nicht, dass sein Deutsch bereits Belege für Sprachmischung abgegeben hat und dass dasselbe nach Versicherung kompetenter Richter überhaupt ein sehr ansehnliches Material für einen künftigen „deutschen Antibarbarus” liefern wird. Da hiesse es denn wohl, sich des Spruches medice, cura te ipsum zu erinnern, anstatt in albern aufdringlicher und möglichst geschmackloser Manier anderen sogenannte gute Lehren zu erteilen.”
Nachdem ich zwar die viel schönere grammatische Koralle abgelehnt, wäre es doch albern und möglichst geschmacklos bei meiner Ichvergötterung mit diesem Korallensplitterchen mich abfertigen zu lassen. Krek scheint mich tatsächlich mit Meyer verwechselt zu haben. Aus meinem Urteil über Gustav Meyers Deutsch mag man vielleicht richtig auf meinen stilistischen Geschmack schliessen. Im Sommer 1885 lag ich an einem Beinbruch krankend in einem Einkehrwirtshaus in Spalato danieder. In meiner trüben Laune las ich wiederholt Meyers Buch durch und befreundete mich mit ihm. Mir war das Buch in meiner kummervollen Verlassenheit ein Tröster und Gesellschafter. Der Gegensatz zwischen diesem und dem Krekischen Buche drängte sich mir später von selber auf und so schrieb ich die Bemerkung oben arglos nieder. Die Schande, aus G. Meyers Buch zu lernen, ist gering, doch geringer die Ehre, solche Sätze zu bauen, wie die krekischen sind. Schon vor zweihundert Jahren hat F. R. L. Freiherr v. Canitz auf Stilübungen von der Art Kreks eine Satire gemünzt, die mit den Versen
schliesst:
Ein Teutscher ist gelehrt, wenn er solch Teutsch versteht.
Kein Wort kommt für den Tag, das nicht auf Stelzen geht.
Durch die Lektüre des krekischen Lebensmachwerkes kann man also auf die billigste Art in den Geruch eines gelehrten Teutschen gelangen, man braucht sich nur in öffentlichen Wartezimmern oder auf Alleebänken sitzend, im Parlamente und bei Strassenaufläufen mit Kreks Buch bepackt sehen zu lassen. Dass ich selber aber jemals und irgendwo auf mein vortreffliches Deutsch gepocht, d. h. wohl, mein Deutsch als vortrefflich bezeichnet hätte, muss Herrn Krek geträumt haben. Dichter pflegen ja unter Visionen zu leiden. Übrigens kann und darf ich als ein Marktberichterstatter schreiben,
- 142 -
wie immer ich will, bei meinesgleichen kommt es einzig und allein auf den Inhalt, nicht auf die Form an, und unsereiner hat auch keine zwanzig Jahre Zeit, um sich so einen unübertrefflich grandezzigen Urstil, wie Krek sich eines berühmen mag, zuzuschnitzeln. Arme Leute kochen mit Wasser. Ich habe es folgerichtig auch weder bedacht, noch es bis zur Mitteilung Kreks gewusst, dass „kompetente Richter überhaupt ein sehr ansehnliches Material für einen künftigen deutschen Antibarbarus” aus meinen Berichten zu schöpfen beabsichtigen. Kann wol sein: denn Dichter, und Krek ist ja einer, sind uates; ich bin nicht in der Lage, den Schleier der Zukunft zu lüften, bin auch nicht neugierig; denn für das was sein wird, gibt der Jude nichts, doch soviel glaube ich, dass Herrn Krek mein Deutsch gräulich barbarisch schon jetzt in den Ohren gellt.
Aus Kreks „Abfertigung” zitire ich blos einige Bruchstücke; denn meinem Herzenswunsch, die ganze unverkürzt wiederzugeben, darf ich nicht willfahren, sonst verfolgt mich am Ende Krek mit einer Klage wegen unbefugten Nachdrucks seiner geistigen Originalarbeit. Die kräftigen Schlager im Oberteile des Bürstenabzugs müsste ich zwar ohnehin unterdrücken, aus Rücksicht auf die gute Erziehung, lieber Leser, die du im Elternhause genossen hast oder die du deinen Kindern gibst. Es wäre aber unverzeihlich, wenn ich dir den Schlusstein, der mit so viel Witz, Geist und Verstand aufgebauten und mit ausserordentlicher logischer Schärfe wissenschaftlich gründlich ausgeschmierten Halle der „Abfertigung” nicht vorlegen würde. Er sieht so aus:
„Zum Schlusse muss ich bekennen, dass mich der Entschluss, einem Manne dieses Schlages doch einiges zu erwidern, sehr viel Selbstüberwindung kostete. Unter anderen Umständen wäre auch dies unterblieben, denn in fachkundigen slavistischen Kreisen ist Herr Fr. S. Krauss längst nach Gebühr gerichtet und die Beschäftigung mit ihm bringt alles andere eher denn Ehre ein, wohl aber könnte sie selbst dahin ausgelegt werden, dass man ihm doch irgend eine wissenschaftliche Bedeutung beimisst. Gegen das letztere müsste ich mich natürlich entschiedenst verwahren und einfach erklären, dass meine vorstehenden kurzen Ausführungen lediglich mit Rücksicht auf die Leser dieser Zeitschrift, denen es grösstenteils in diesen Dingen an Autopsie fehlt, niedergeschrieben wurden. Eine Abfertigung in wenigen Zeilen wäre hier nicht am Platze gewesen, und so habe ich denn wenigstens nach einer Richtung hin (in gleicher Weise liesse sich auch alles andere, worin übrigens auch nicht ein gesunder wissenschaftlicher Gedanke sich
- 143 -
findet, zurückweisen) das saubere Gebahren des Herrn Fr. S. Krauss in das rechte Licht gestellt, so dass es nun auch den Lesern nicht schwer fallen wird, sich über den Ehrenmann und dessen Treiben ein Urteil zu bilden. - Graz. Gregor. Krek.”
Der Mann kennt sich beim Wurstkessel pathetischer Radomontaden aus! „Längst nach Gebühr gerichtet”, „entschiedenst verwahren und einfach erklären”, „nicht ein gesunder Gedanke”; vortrefflich! es fehlen nur noch die Wendungen: „Das Volk steht hinter uns!” „Uns gehört die Zukunft!” „selbstlose Hingebung”, „flammende Begeisterung”, und „bis auf den letzten Blutstropfen”, und das „hochgehaltene Panier” des „an die Wand gedrückten Urslaventums” ist vor dem „drohenden Ansturm der Umsturzpartei” „unentwegt sieghaft” in den „schützenden Hafen” eines politischen Leit- artikels gerettet. Ganz Unrecht hat Krek aber doch nicht.
Mit einigen Mitgliedern der krekologisch faxenkundigen slavistischen Kreise habe ich mir, teuerster Leser, die Ehre gegeben, dich näher bekannt zu machen. Zur Würdigung aller müsste ich einen Katalog vom Umfange des krekischen Buches anlegen. Meinetwegen, doch bezahlst du die Druckkosten? Es ist nur zu wahr, dass mich die Herren nicht gern haben, was ich recht sehr bedauere. Wen aber trifft dafür die Verantwortung? Niemand anderen als nur den oben auf S. 51 genannten alten Juden Raschi, dessen Erläuterung zu II. Mosis 32, 2 mir von meinem Vater s. A. ins Herz eingepflanzt worden ist. Raschi sagt nämlich: „Der Sinn des Verses ist: Sei nicht nach den Vielen zum Bösen! d. h. wenn du siehst, dass die Frevler das Recht beugen, sag nicht, weil ihrer viel sind, will ich ihnen mich zuneigen, und antwort nicht über einen Streitfall, indem du dich nach den Vielen neigest, um das Recht zu beugen, d. h. wenn du über den Rechtfall nach deiner Meinung befragt wirst, so antwort nicht so, dass du dich nach jenen Vielen richtest und mit ihnen die Entscheidung von der Wahrheit ablenkst, sondern sag das Urteil, wie es in Wahrheit richtig ist; möge die Verantwortlichkeit für die Rechtbeugung auf der Mehrheit lasten!”
Auf Markt und Plätzen rast der wilde Kampf! Auch zwischen den mehr friedlichen Bewohnern von Gelehrtenstuben. Hie Judentum! hie Heidentum! Die Kluft der Gegensätze zwischen meinem und krekischem Wesen ist sowohl in rehgiös-sittlicher wie auch in wissenschaftlicher Beziehung unüberbrückbar. Ich, der Zöghng nüchterner Denker und
- 144 -
Forscher, er (Krek) ein Commis voyageur der wunderschönen hochpoetischen urslavischen Götter und Mythen, zum Teil eigenen Fabrikates; ich, in wissenschaftüchen Dingen ein vorsichtig tastender Beobachter und Sammler, er (Krek) ein glaubenstarker Mann, ein verzückter Wolkenreiter, dessen Ross auf altarisch-urslavischem Vorahnenhimmel einheimisch ist. Wie wahr sagt er doch zuvor, dass er in gleicher Weise, wie in der Abfertigung, auch alles andere, was ich vorgebracht, zurückweisen könnte! Wie betrübend klingt aber sein freiwilliges Geständnis, dass er in meinem Marktberichte nicht einen gesunden wissenschaftlichen Gedanken finde! Ist das vielleicht die Folge seiner Vertiefung in die Nodiloischen Götter und Mythen? Könnte da nicht die himmlische, urchrowotische Schwerenotmutter aus Nodilos Fabrik mit gutem Heil ihre arischen Geheimmittel zur Anwendung bringen? Liegen, ihm die böhmischen Korallen aus der Götter- und Mythenwelt schon so schwer in den Eingeweiden, dass sein geistiger Magen jede andere Speise als ungesund mit Ekel abweist? Grosse und bedeutsame sozialpolitische Fragen harren vergeblich ihrer Lösung; dürfen wir nun der eitlen Hoffnung fröhnen, dass die viel schwierigeren Probleme der Krekologie sobald ihre endgiltige Erledigung gewinnen werden? „Chi lo sa? Mein A--rm ist finster!” war der Leibwahlspruch des Bürgermeisters meines Heimatortes.
Krek nennt mich einen Ehrenmann. Habe ich ihm so etwas je nachgesagt? Dann spricht er auch von meinem „abnormal funktionirenden Gehirne”. Gottlob, dass er wenigstens zu der Einsicht gelangt ist, dass ich mich eines funktionirenden Gehirnes erfreue. Habe ich in meiner Besprechung die kitzliche Frage über die Qualität seines Gehirnes aufgeworfen? Sein Buch genügte mir. Ohne Grund wirft ein so bedächtiger und kluger Mann mit Vorhalten wie „abnormal funktionirendes Gehirn” und „Ichvergötterung,” nicht herum. Ohne Grund wird keine schwanger, sagte Krassl „mit dem ledernen Nabel.” Es verlautete zwar bisher nichts darüber, dass Professor Krek Psychiater sei und eine richtige Diagnose stellen könne, doch mit Hinblick auf sein Buch, mit dem er uns den erschöpfenden Nachweis erbracht hat, dass ihm die Wissenschaft der Ethnographie ein böhmisches Korallenfabrikdorf sei, hat die Vermutung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für sich, dass er sich in der Fülle seiner müssigen Zeit insgeheim im Laufe der zwanzig Jahre
- 145 -
zu einem philologisch-slavistischen Krafft-Ebing ausgebildet. Woher wüsste er denn sonst das herrliche Wort medice, cura te ipsum? Vor fünf Jahren musste ich einmal als Gerichtdolmetsch bei der Einvernahme einer Bulgarin in der Leidesdorfischen Irrenanstalt (Wien, Ober-Döbling) vermitteln. Damals verbrachte ich dort den ganzen Tag, besah mir die im englischen Stile gehaltenen prachtvollen Wald- und Gartenanlagen und das gewaltige, den grössten Ansprüchen neuzeitiger Gesundheitpflege gemäss eingerichtete palastartige Gebäude und verkehrte mit mehreren stillen Irren, die im Grünen und zwischen Rosenhecken und Jasminsträuchen frei einher wandelten. Ich glaube nun wohl, dass es Krek in seinem überschäumenden Gefühle des Wohlwollens und der Gutherzigkeit, gerne sähe, könnte er den Prof. Max Koch in Breslau und meine marktberichterstatterliche Wenigkeit vor ein Gericht zerren und uns für das crimen laesae Krekestatis einer empfindlichen Züchtigung unterwerfen lassen. Wenn mich nun ein unerbittiicher Richter vor die Wahl stellen würde, zur Busse für mein abnormal funktionirendes Gehirn, an dessen Schaffung ich selber eigentlich unschuldig bin, entweder dreimal nacheinander Kreks Buch abzuschreiben oder für ein Jahr in der Leidesdorfischen Heilanstalt Aufenthalt zu nehmen, so würde ich mich mit Wonne für das angenehmere Teil entscheiden, doch stelle ich die Bedingung, dass sich nicht gleichzeitig mit mir auch Krek dort einquartiere; denn für meinen Umgang würden mir die stillen Irren vollauf ausreichen.

Hochverehrter, ausdauernder Leser! Wer dir Böses gönnt, möge von Lakrizensaft in Stengeln und chinesischen Rhabarberwurzeln leben und zehren, dir aber sei für deine mir bewiesene Anhänglichkeit jeden Tag eine fein gebratene Gans, und eine Flasche Tokayer dazu beschieden, denn in Leiden und Freuden muss der Mensch gut essen, wie Odysseus im Phäakenlande so treffend betonte. Wie du gesehen, habe ich, so
gut ich es in meiner Einfalt verstanden, mich bemüht, mein Wort einzulösen, das ich meinem Vater s. A. verpfändet. Ob ich es Herrn Krek recht gemacht? Ich wage es nicht zu hoffen; denn so viel ich mich auch für ihn einsetze, um seine Leistung weltbekannt zu machen, ist er doch nicht zu befriedigen.
- 146 -
Was tun? Woher nehmen und nicht Korallen erzeugen? Es heisst, ein Schelm der mehr hat als er gibt. Ich habe mich noch lange nicht ganz verausgabt. Ich gestehe es dir offen und unumwunden ein, dass ich, aus verschiedenen Erwägungen, meine launigsten Einfälle unterdrückt und die saftigere Satire für ein andermal dir vorenthalten habe. Ich hatte ursprünglich die Aufgabe, nur über Kreks böhmische Korallen zu schreiben, und was ist daraus geworden? Zwei ausgewachsene Marktberichte von der Götter- und Mythenbörse! Ich bin wirklich daran unschuldig; die leidige Methode der Ethnographen, selbst das Unbedeutendste, so schal und nichtig es für sich betrachtet auch sein mag, vom Gesichtpunkte einer allgemeinen Erscheinung und Äusserung des menschlichen Geistes aus zu behandeln, hat auch mich zu den weitausgeholten, umständlichen Darlegungen verleitet und verführt. Jeder Hahn auf seinem Mistberge. Wie die Alten brummen, so die Jungen summen. Mir lag es also ob, gewissermassen den Boden zu untersuchen, auf dem Korallenfabrikanten am üppigsten gedeihen. Krek für sich allein besehen, wäre dir kaum verständlich gewesen. Ihm allein eine unterhaltliche und anziehende Seite abzugewinnen, um dich auf eine halbe Stunde an meinen Bericht zu fesseln, war mir zu schwierig. Daher musste ich den Kreis seiner fachkundigen Genossen erforschen und sozusagen den Grundstock zu einer Geschichte der Entwicklung böhmischer Korallenfabrikation zu schaffen suchen. Die Mühe war im übrigen recht gering. Die angesehensten, weil fruchtbarsten, d. h. konkurrenzfähigsten böhmischen Korallenfabrikanten fanden sich als fachkundige Autoritäten ehrenvollst schon in Kreks Buch vermerkt vor. Eine Satire zu schreiben ist leicht, wenn man nur abzuschreiben braucht Crecio duce et auspice Crecio!
So oft ich mit der Pferdebahn in den Prater hinabfahre, um mich zu meiner Erquickung in den schattigen Auen zu ergehen, versetzt mich das Pferdegetrappel, Wagengerassel und Glöckleingeklingel in eine traumverlorene, lyrische Krekstimmung. Ich bilde mir da immer ein, ich fahre mit Krek ins göttliche Dabogland. Bei jeder Fahrt kommt wenigstens ein neues Liedchen auf Krek zu stande. Sie lehnen sich, die Liedchen, meist an rühmlichst bekannte Muster an ; denn ich selber bin kein Dichter und bin daher noch weniger verpflichtet als Musensöhne von Beruf, durch Originalität zu überraschen. Jetzt habe ich freilich erst hundertundzweiundsiebzig
- 147 -
Stücke beisammen. Bis ich ihrer fünfhundert fertig habe, gedenke ich eine Auswahl von hundert der sinnigminnigsten zur Jubelfeier einer vierten Auflage von Kreks „Einleitung” drucken zu lassen. Das feinst ausgestattete Goldschnittbüchlein wird den Titel führen:
IN CRECIUM
Lyrische Blüten und Blätter eines Marktberichterstatters.
Um deine Kauflust zu erwecken, und deine Neugierde einigermassen zu stillen, will ich dir gleich jetzt zwei anspruchlose Proben daraus mitteilen:
IN CRECIUM.
Frei nach Hölty:
(Melodie bekannt.)
Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab!
Und schneid nicht einen Finger breit die Ehr dem Nächsten ab.
Noch freier nach Heine:
(Melodie: Du hast Diamanten und Perlen.)
Du hast bezupfelt, berupfelt
Autoren ein ganzes Heer;
Du hast dein Schäflein geschoren,
Mein Kreklein, was willst du noch mehr?

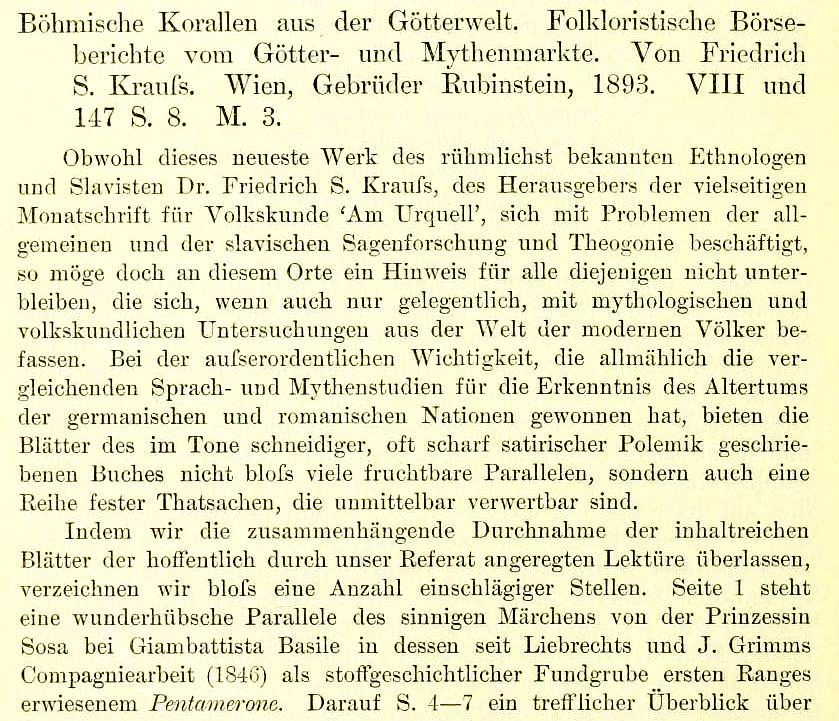
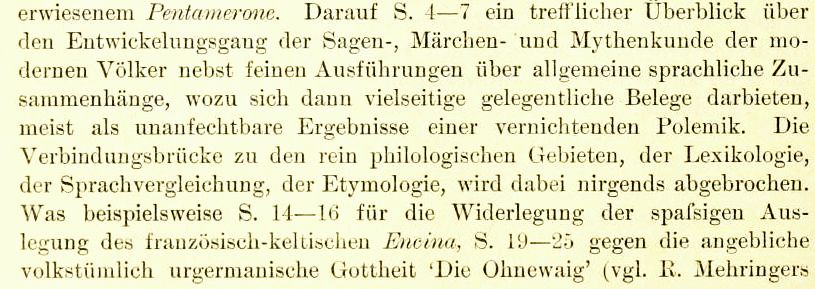
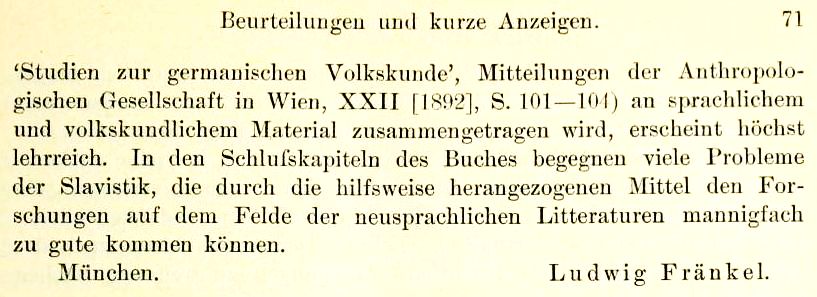
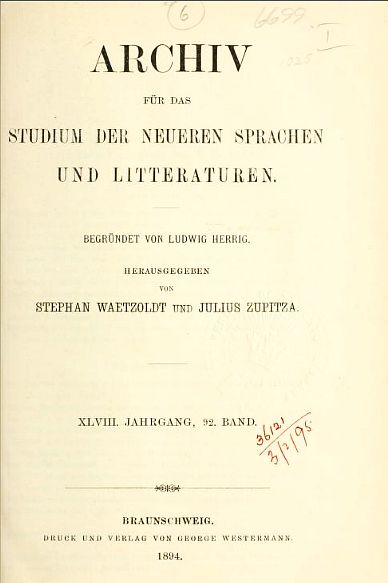
Erstellt am 11.04.2011 - Letzte Änderung am 11.11.2012.