Zur Volkskunde unserer Heimat
Neumärkische Mundart - Eigenarten ihres Wortbestandes - Lbg/W Heimatblatt 1974 11-12
Von Karl Lueda
Die Sprache eines Volkes bewahrt seine Begriffe, Empfindungen, Leidenschaften, dies alles bis zu der feinsten Nebenausbildung und Abstufung wie in einem Behältnis auf. Man könnte das Aufbewahrte die Seele der Sprache nennen.
Friedrich Gottlieb Klopstock, 1797
Im vorigen Jahre wurden unsere lieben Leserinnen und Leser schon einmal mit unserer neumärkischen bzw. Warthebruchmundart malträtiert; damals handelte es sich um den Lautbestand, d. h. um den Klang der landläufigen Haussprache — eben hauptsächlich des Warthebruches südlich von Landsberg. Es wurde versucht, den Klang unserer Heimatsprache mit den gegenwärtigen drucktechnischen Mitteln, also mit den 24 Lettern unseres Alphabethes, darzustellen; das erste Telefonat „Onkel Ferdinands“ mit Amerika brachte abschließend die visuellakustische Aufhellung.
Soviel zur verständnisfördernden Erinnerung, und als Brücke zu der heutigen Abhandlung des wohl nicht weniger interessanten, ja fast belustigenden Wortbestandes unserer Heimatmundart. Denn Sprache und Sprechen sind nicht nur der Klang der Laute, sondern beinhalten auch Begriffe und Begriffsformungen, kurz Wortbestände eigener Art.
Oberall in den vielen Mundartlandschaften unseres klein gewordenen Vaterlandes, in die unsere Landsleute zerstreut sind, und wo sie eine neue Heimat finden mußten, werden sie alltäglich Wort- und Begriffsgestaltungen begegnen, die sie bisher nicht kannten. Aber auch unsere Volks- und Haussprache, unsere Mundart, wies eine Fülle derartiger Wörter auf, die allein bei und mit und in und durch uns in unserm Alltag lebten und wohl auch sobald nicht verloren sein werden.
Erinnern wir uns doch einmal z. B. der Eisenbahnfahrten ab unserer Heimatstadt Landsberg. Sei es nun mit unserer „Vorortbahn“ nach Gurkow bzw. nach Döllensradung oder erinnern wir uns unserer „Gebirgsbahn“ nach Soldin, nordwärts in das Höhenland der Neumark — oder südostwärts nach Schwerin/Warthe.
Und endlich auch südwärts in Richtung Zielenzig in das „Knödelland“, so geheißen wegen der vielen dort wachsenden „Knödelbäume“, das sind Bergamott-Birnbäume, die im Bruch „Kruschken“ genannt wurden. Hier überschritten wir zudem zwischen der letzten Warthebruchstation Plonitz-Blockwinkel — 17,90 Meter über NN. — und dem nächsten Bahnhof: Hammer — 23,50 Meter über NN. — die „Schmalzspindgrenze“ zum SternbergerLand und damit zur mitteldeutschen Mundart: Sternbergisch: der Schmalz; warthebrüchisch: das Schmalz und Sternbergisch: der Spind, dagegen warthebrüchisch: das Spind. Und stellen wir uns vor: Das alles erlebten wir in einem Wagen vierter Klasse! Nach 1918 wurden diese „Luxuszüge“ zwar aus dem Verkehr gezogen, und es gab danach nur noch drei Wagenklassen; aber der „Inhalt“ blieb ja der gleiche: Menschen unserer Heimat von einst, Menschen unseres Zungenschlages und unserer Art!
Der selben „Art“ konnten wir auch lauschen beim Handel „Angebot und Nachfrage“, sagt man heute dazu — also bei dem Handel mit all seinen mehr oder weniger überflüssigen Worten, oder wir ließen uns gefangennehmen von dem Volksmund im Wartezimmer des Arztes, des Rathauses, des Landratsamtes oder gar des Finanzamtes! Fast unerschöpflich jedoch rauschte der Born des von einem frohen Herzen, einem schlagfertigen und wortschöpferisch gesteuerten Volksmundes bei öffentlichen Versammlungen, bei Tanzvergnügen, Volksfesten, Hochzeiten, „Federkösten“, auf der Feierabendbank, endlich aber bei der Arbeit in den Werkstätten, den Betrieben, also überall da, wo das Volk zum Volke redete und stets wußte, daß es verstanden wurde..., überall dort formten die Sprecher urplötzlich Ausdrücke, die durch ihren Klang, durch ihre Lautfolge und sogar durch Lautmalerei den gewollten Sinngehalt treffend bezeichnen.
Manche von diesen Begriffen wurden alltäglich, manche seltener, eben zufällig angewendet. Sie lebten im Unterbewußtsein des Volkes, kamen ungerufen auf die Zunge, wurden ausgesprochen ... und verschwanden wieder; sie tauchten unter, wie der garstige Zaungast, der eiligst über den Zaun hinweg in die Fenster äugt und ehe er recht erkannt worden ist, hastig sich duckend, verschwindet.
Schwer ist es, die Herkunft dieser Zaungäste der Sprache nachzuweisen. Dieser eigenartige Wortschatz ist in seinem gesamten Umfang in keinem der allgemeinen Wörterbücher unserer Zeit aufgeführt, höchstens in besonderen Fachbüchern und auch dann noch recht lückenhaft. Ist dieses Sprachgut ursprünglich? Ist es ererbtes Sprechgut aus ältesten Zeiten oder ist es die schöpferische Freude an der Lautmalerei? Sein mannigfaches Vorkommen auch im mecklenburgischen und pommerschen Platt — und dort ist es noch umfangreicher und fester im Bestand — beweist zusätzlich die nahe Verwandtschaft des Plattdeutschen und unserer Heimatmundart und die Zugehörigkeit der beiden zum niederdeutschen Sprachgebiet.
Neben diesem erdgebundenem Sprach- und Sprechgut haben sich nun noch Importe der Sprache eingeschlichen, die auf fremden Gefilden gewachsen sind, nämlich die Fremdwörter, diese sprachlichen Entwicklungshelfer. Sie kamen aus dem Alt-Lateinischen, aber am vielfältigsten aus dem zeitlich näherem Französisch. Ihr Einzug war schon mit dem „Vater unserer Heimat“, dem „Weisen von Sanssouci“, gegeben und verstärkte, vermehrte sich durch die Kriegszeiten bis zumindest 1870/71, durch die Veteranen.
Hatte doch Großvater 1871 die Schlacht bei „Lehmanns“, d.h. Le Mans in Westfrankreich, mitgemacht! Die Kriegsgefangenen und was jene Zeiten sonst noch mit sich brachten, hinterließen auch sprachlich ihre Spuren. Da diese Sprachfremdlinge nicht urständig gewesen sind, sich aber sehr interessant zu machen beliebten, seien sie betrachtet. Sie wirkten wegen der lautschriftlichen Darstellungsmöglichkeiten ihres Sprachklanges und darüber hinaus wegen ihrer landläufigen Ausdeutung recht erheiternd, z. B. Ballbier, rehfangschieren, rampenieren, Kuhfert, Schassee, tiffentieren (dividieren), Kuhragsche, Teepesche, Kappetal... und dienten gern dem „Rennemeh“, d. h. der eitlen Selbstbestätigung der Sprecher und eignen sich heute noch zu einem lustigen und belehrsamen Gesellschaftsspiel.
Die nun folgende Lexikologie, d. h. die reichlich zwanghafte Zusammenstellung ein Familienereignis betreffend, möge alles Vorhergesagte erhärten und ein Bild geben von der Fülle mundartlicher Eigenheiten im Wortbestand unserer ehemals heimischen Volkssprache und ein Bild dazu von ihrem beträchtlichen Eigenleben. Diese Marionetten des Wörterbestandes unserer neumärkischen Mundart muten oft an wie ein sprachliches Kabarett; sie bitten im voraus schon um freundliche Entschuldigung, daß sie mal geboren sind und daß sie noch Geschlechter überleben werden.
Ausdrücke aus dem Plattdeutschen Fritz Reuters bleiben ausgespart, ebenso die modernen Schlagwörter unserer Gegenwart, wie auch selbstverständlich deren trivial-ordinären Begriffsformungen.
Eingeblendet seien dagegen eine „nahrhafte“ und eine „schmerzhafte“ Begebenheit. Rund um Kruppkes Hochzeit
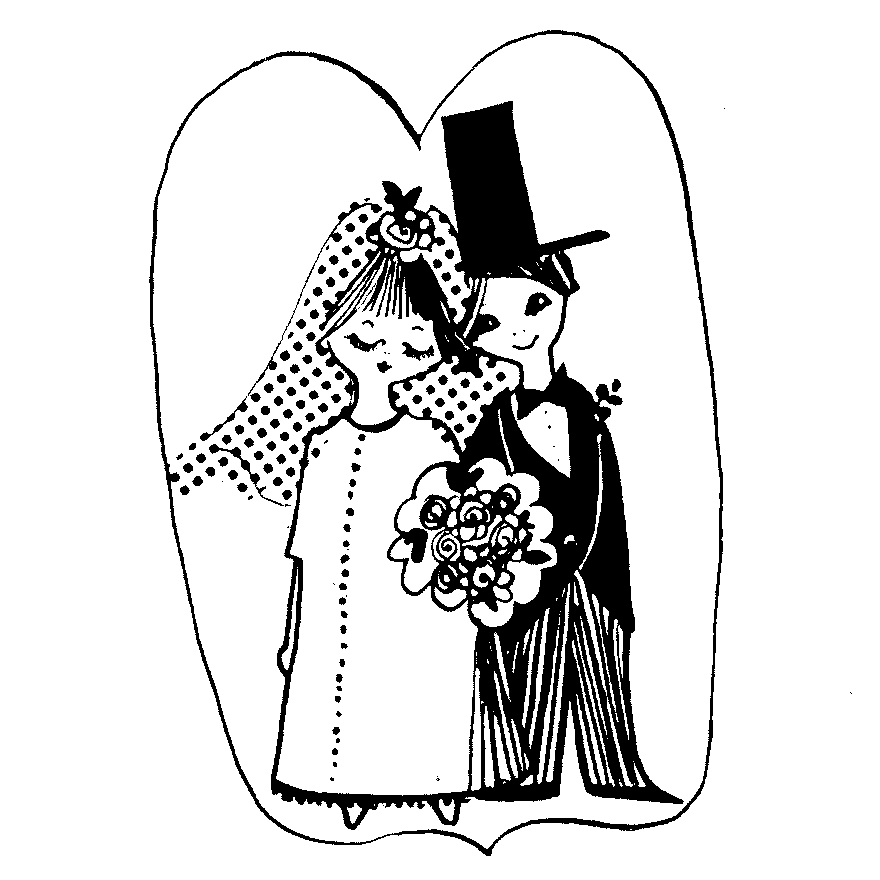
Bei Kruppkes sollte es Hochzeit geben: Anna, die Jüngste, die Krabbe in der Familie, die Krücke, die Krabutzke, ist schon drei Jahre lang verlobt. Anna war ein durchaus ansehnliches Mädchen: sie war keine Tunte, keine Schaute, kein Schussel und nicht wie die meisten anderen ihrer Zeit, die überall rumteirachten, sich auftakelten, sich verluderten, verschluderten, unterkietig quatschten oder sich gar verplemperten. Anna war nicht kiesätig, nicht pimperlich und nicht quengelich und zog keine Flabbe, wenn es mal nicht nach ihrem Willen ging. Sie freute sich auf die Hochzeit: auf ihr weißes Brautkleid, das schön glockig sein sollte und mit Vollants und Franjeln um und dumm.
Den Leuten, die ja alles besser wissen, dauerte es allerdings schon zu lange, sie hatten im letzten Jahr schon fortwährend jemunkelt und jetratscht, die Verlobung würde wohl noch ausenneene-gehen. Aber die Leute hatten ja immer etwas zu quasseln, zu tratschen, zu meckern: sie machten einen Knatsch, ein Jesabber, die Neidhammels, die gnietschijen!
Auch die nähere Verwandtschaft purrte und druckzte und pracherte und drängelte; sie hatten sich alle zu pinselich und zu gnitschich. Es war jedoch alles in bester Ordnung! Nur die Zeiten waren zu mies und manchmal zu kodderigh gewesen.
Mutter Kruppke wollte sich mit der ersten Hochzeit, die sie ausrichtete, doch nicht mierich, nicht moadigch machen, es sollte nicht lumpich, schoofelich und nicht popelich werden.
Mutter Kruppke konnte kein unnötiges Jeseire leiden, nein, das konnte sie nicht verknusen, das machte sie kribbelich. Sie würden ja bestimmt alle genug zu präpeln kriegen. Mutters Hauptsorge war da zunächst der Hochzeitskuchen, daß der bloßig nicht vermalörte, daß er nicht Klamsch und Schmadder wurde. „Beesingetorte“, ihr Lieblingsgebäck, konnte sie nicht backen, denn es gab zu der Zeit — Ostern — noch keine Beesinge aus dem Garten und aus den Fichtenkaweln. Aber für einen guten Kaffee würde sie schon sorgen. Über Lorke oder Lurke sollte keines zu mäkeln haben. Als Fressajsche, als Braten, so war im Familienrat beschlossen, sollte es den Riggebengel vom Hammel und Schweinsmörbraten geben und vorneweg natürlich Karpfenbraun in Bier und Sahne und Fliederkreide; in der Kochkunst, da war Mutter Kruppke firm und injefuchst!
Auf Mutters Geburtstag im Februwar, hatte der Familienrat die Gästeliste aufgestellt. Die ganze kräpelige, puckelige, kruckelige Verwandtschaft, das ganze Krupzeijes und Krajzeijes, die ganze Packajsche und Mischpoke sollte eingeladen werden.
Was zur Aussteuer gehörte, hatte zwarschten Mutter Kruppke so nach und nach schon zusammengeleppert, inwejen Anna genug jeprachert, jejampelt und jejibbelt hatte: sie wollte schon zu Weihnachten vorigchten Jahres unter die Haube gekommen sein, aber länger als bis zu Ostern wollte sie unnode gerne warten. Die größten Schwierigkeiten aber lagen bei Vater Kruppke. Der war ein Blitzgrandig und gnäterig und gnidderig und hartfrätsch (hartfressig). Er hatte immer etwas zu kakeln, zu krakeln, zu gnuckern und zu quengeln; er geriet ziemlich leicht in die Breduillje und in die Rajsche. Kurz gesagt: Vater Kruppke war ein komischer Kautz, ein Krucks, ein vergnitterter Blubberkopp, ein Drähnkötel, der seine Mucken, seine Nicken hatte und Finessen machte und recht patzig werden konnte und der immer strupeln mußte, Strupeleien suchte. Mit ihm hatte die Familie und hatten es noch mehr die Nachbarn menchees (manchmal) so ihren Wunder. Und die meisten Nachbarn konnten ihn nicht verknusen, besonders, wenn er gelegentlich es versuchte, bei ihnen seinen Reibach zu machen, wenn es mehrschtndeeles um die Penunjsche ging. Da kam es dann oft über den Zaun hinweg zu lauten Tischputen und Tischkussionen. Der Gnatzkopp und Drähnekleter Kruppke konnte bei diesen Teebatten direkt aus der Rolle fallen, so sehr escherte er sich ab über die, die den Schlungk nicht voll genug kriegten, die Kappetalisten un ihre Tiefetenten. Und was er da zu sagen hatte, das war teefinnetief unwiderleglich. Nur hatte er wohl ganz vergessen, daß seiner Zeit sein eigener Vater als Teeputant auf einem neumärkischen Gutshof nullens-fullens als Stellmacher die Grundlage gelegt hatte für die Eckzestenzen der gesamten Familie von heute. Aber na, der gute Vater Kruppke mußte nun so verbraucht werden, wie er eben war, da half kein Zackerieren!
Und so dachte auch der künftige Schwiegersohn „Kaddel“ (Karl) Strebler. Der war ein tüchtiger, gelernter Zimmermann. Ein jewiefter, kräwischer, krähjer, kürrer, kiebiger, kiewischer, anschlächscher — mit einem Wort: ein staatscher, ehrpusselijcher und vamooster (famoser) Kerl, bei dem man nicht erst lange zu benschen, zu dallschen brauchte, der schnell auffaßte und zufaßte, ohne lange nachzusimmelieren, der alles mögliche kallfakterte, klabasterte, kniepelte und auch scharwerkte. Er verstand es prima, mit den Schwierigkeiten seines künftigen Schwiegervaters fertig zu werden. Kaddel war auf alles, was so alldagsch vorkom, injefuchst und unbedarft: er schrieb auch — trotz seiner harten Professionen — eine saubere Klaue und konnte sich für andere eine Briesche loofen. Sonn- und Feiertags kam er stets jeschniejelt und jebiejelt zu seiner Auserwählten. Er war nicht — wie manche von seinen Konsorten — tuntelich, taperich, talpzich, wählich, gnietschich, miesepeterich, meckerich, mickerich, murkelich, quackelich, boßich, bluffzich, hartleibsch, nählich, schusselich, jieperich oder gar ungerkietigch. Mancheiner der anderen war eben ein Hanake, eine Nulpe, ein Pachulke, Pojaukel, Flappz; viele waren entweder Schloakze, Talpze, Bluffze, Loabandse, Schlowaken, Schlimze, Lorbasse, Kamuwze, Krabuwken, Bofken, Kräpels, Kroppzeijes, Luderjoahnze oder Dullbräjenz, die des Abends manknunger alles rungenierten, was sie in die Mache kriegten, die alles begrapschten, die die Porten aushoben und in die Gärten stellten, damit sich die Leide (Leute) nicht die Bräjen (Köpfe und die Gehirnmasse) einliefen oder die Plautze verbufften, und die überall stiebitzen, wo es was zu holen gab — die in famichten Bengels. Noch viel weniger war Kaddel ein Süffel, ein Süffling, ein Schwidjee oder ein Fiester; er war einer von denen, die dem ändern alles von den Augen affkieckten nach dem Grundsatz: Dein Flunsch ist mir Befehl! und dann machte ha kenn Kaleika.
So war Kaddel die paßgerechte Ergänzung zu Kruppkes Anna; die war durch das ganze Hin und Her und durch das Jewürmsel und Jemecker gewiß schon ein wenig ruschelig, fisselig und sogar krätig geworden. Na, aber dafür war sie eben noch jung, wo andere ihres Alters jidderig, jadderig, jachterig und markunger rujschelich, huschelich, zickijch und fisselich waren oder gar kribbelich, gnazich und patzich. Was gab es da noch für abstoßende Beispiele: Schlampen, Zausteln, Huttscheln, Drutscheln, Quiekse, Quackeis, Nälekins und loddrige Zoddels. Anstatt rumzufleddern, hatte Anna bei einer erfahrenen Näherin im Dorf die Künste der Nadel erlernt, aber nicht etwa prudeln, knuschern, pruhmen, purkzen, schludern, murkeln, wrutscheln, fuschern, sonst hätte Vater Kruppke ja nicht noch das Lehrgeld estemiert, damit Anna, nachdem sie ihre Fladrujche, ihre Fummels, die Kledajsche hallweje für den Alltag sich selbst zusammenfohmen konnte, nun noch in der Stadt die „feine Küche“ lernte.
Vater hatte trotzdem genug jemeckert und vor sich her jewurmesiert, als Anna danach zu Hause die ersten selbständigen Versuche ihrer Kochkunst vorführte und so allerhand zusammenpurjelte und zusammensterjelte: Torten, Crems und Mayonnaisen (Majornäsen meinte Vater Kruppke), eben all den Pamps, Mattsch, Quansch, Klumpatsch, Bibber, Schlabber, Quadder, Kleister, Tadder, Zadder und die Schlampampe. Das alles war ihm doch mencheens zu labberig, gliebberig, grischjelich, galsterig und wabbelich. Und weiß der Kuckuck, die Parjelei, die fluschte man nur so bei der Anna ihrem Mengelieren von dem Quarjes. Vater bevorzugte — wie kann es anders sein — seiner Zeit entsprechend: zum Beginn des Arbeitstages Klüter- oder Kliebensuppe, selbst wenn die Klieben in der Milch aus Roggenmehl anstatt Weizenmehl und leicht gezuckert waren. Manchmal gab es auch einfache Brotsuppe: Dünne Brotschnitten in aufgekochter Milch.
Zum zweiten Frühstück, besonders in den Hauptarbeitsmonaten des Jahres, genügte ein Stück fetten Specks „über den Daumen“ geschnitten und dazu einen Knust trockenen Brotes. Verdauungsfördernd und beliebt war bei ihm ein Schluck Kornschnaps mit Himbeer oder die gleiche Menge Kümmelschnaps; war der Magen überladen oder erkältet oder sonstwie nicht in Ordnung, da hielt sich Vadder Kruppke selbstgestellte „Wermiede“ (Wermut) bereit.
Für die Hauptmahlzeit bevorzugte der Herr des Hauses — seine Zähne hatten ihre Nicken und wollten nicht mehr so recht — Stuckkartoffeln mit Speckgrieben und dazu Eierkuchen und als Durstlöscher dicke Milch, die in einer Satte aufgestellt worden war. Als eiliges Gericht genügte ausgelassener Speck mit Zwiebelringen und dazu als Magenfüllung Pellkartoffeln. Da die Milch neben den Kartoffeln und den Eiern die Grundnahrungsmittel darstellten, liebte er die Keilikes aus Mehloder Griesteig mit untergeschlagenem Ei angereichert, leicht gesüßt und löffelweise in Milch gegart; dieses Gericht war auch für den Abend nicht von der Hand zu weisen. Vater Kruppke war eben ein Süßmaul und das vornehmlich zum Sonntagnachmittagskaffee, d. h., wenn die Arbeitslage es gestattete. Dann erbat er sich von seiner „Köchin auf Lebenszeit“, „Arme Ritter“: alte Semmeln, durch zwei waagerechte Schnitte in drei dünnere Scheiben geteilt, nur ganz kurz in dicker saurer Milch und Buttermilch angeweicht und in der nur mit einer Speckschwarte gefetteten Stielpfanne oder dem Tiegel schön goldgelb geröstet und dünn gezuckert und dazu den Sonntags-Bohnenkaffee; durch Eintauchen in einen dünnen Eierteig konnte man die „Armen Ritter“ genießerisch aufwerten. Aus dem besagten Eierkuchenteig ließen sich natürlich auch die noch beliebteren Eierplinze — recht dünn, handgroß und in Leinöl oder gar in Schmalz auf der Stielpfanne gebacken, hervorzaubern.
In dicker Milch und mit etwas mehr Mehl angerührter Eierplinzteig war das Ausgangsprodukt zu den Waffeln; das gewichtige Waffeleisen wurde nur mit einer Speckschwarte gefettet, war zwar schwer zu handhaben, gab dafür aber ein Gebäck, das Mutter Kruppke in einem Steintopf für plötzlichen Besuch bereithalten konnte. Den gleichen praktischen Wert hatten die Nunnefetzken, deren Ausgangsmasse dem Mürbekuchenteig entsprach, der ausgerollt in zwei Finger breite und fingerlange Streifen geteilt, mittendurch eingeschlitzt und durch den Schlitz „geschürzt“ wurde. Diese „Nunnefetzken“ wurden schwimmend im heißen Fett: Schmalz, Talg und Lein- oder Rapsöl gesiedet und gut gezuckert. Alle diese Schnurpfeifereien fanden stets und überall ungeteilten Beifall. Genug von dem allen!
Wie sagte doch einst der Dichter? „So wird das Bild der alten Tage durch Eure Träume glänzend weh'n, gleich einer stillen, frommen Sage wird es Euch vor der Seele steh'n!“
Aber bei Kruppkes war jetzt Annas Hochzeit wichtiger als alle nostalgischen, d. h. wehmütigen Erinnerungen und Wünsche des Hausherrn. Und wenn dieses nötige Familienfest überstanden sein würde, dann käme auch der Alltag wieder zu seinem Recht mit seinem so schönen Dreiklang: Arbeiten — Essen — Ruhen!
Das Osterfest kam eben rein zu schnell, zu sehr auf'n Plutz, heran und es war doch noch zuviel zu bedenken, zu simmelieren und zu deichseln. Wenn doch nur schönes Wetter bliebe! Aber der April ist ja als wetterwendsch jefärcht't! Da steht mal bald ein Schwark am Himmel, der, wenn es warm ist, zum Regendreesch und wenn es lau ist, zu Schneeschlagge werden kann; manchmal muschjelt es sich aber auch ein. Doch keine Sorge: Soviel Tropfen Regen, so viel Glück und Segen!
Je näher Ostern kam, um so mehr hatte sich Mutter Kruppke affgeäschert; sie rackerte, drawaljte und wurrachte rein zu viel! Jedes bißchen im Haushalt mußte affjestäbbert un abgerubbelt werden. Wer noch spät abends bei Kruppkes vorüberging, der hörte, wie Möbel runksten, schurrten, schurksten und schlurrten und wie Menschen brabbelten, debberten, schwabbelten, brasselten und kauderten. Und wenn sich Mutter Kruppke zur Ruhe niederlegte, schnubben ging, dann schlurkste sie man bloß noch in ihren Tiffeln, ihre Hände zingerten, ihr war paddig, ganz broock, ihre Stimme war ganz heesch vom vielen Kummedieren, sie hujahnte und hujapte vor Müdigkeit. Sie hatte sich zuletzt so affmaracht, daß sie nicht mehr hochkam, wenn sie sich hinjeknielt hatte; alle Ribben taten ihr weh, daß sie vor Unbehagen im Rücken weimerte: Sie hatte sich wohl verhoben, hatte sich übernommen: Es ging abselut nicht mehr weiter!
Durch Sturz bei Fehltreten auf der Leiter, auch bei Sturz von einer Treppe, oder noch öfter bei spielenden Kindern der Sturz von der Strohmiete oder vom hochbeladenen Erntewagen und im Tass der Scheune, da gab es nicht immer nur Brieschen, sondern da kam es auch zu solchen sorgenschweren Schocks in den Familien. Bei Kruppkes aber, jetzt in der Zeit der Vorbereitung auf die Hochzeit, da fehlte so ein Schreck gerade noch! Er kam doch zu verquast.
In der Zeit der Vorbereitungen auf das Familienfest war die Mutter ja fast wichtiger als die Braut! Jedoch Vater Kruppke wußte Rat; er würde vorerst mal versuchen, „Muttern zu scheddern“. Das war die damalige Therapie bei Bandscheibenschaden. Mit sicherem und festem Griff schob Vater seine starken Arme der Mutter rücklings unter der Achselhöhe hindurch und hob die nicht allzu gewichtige Lebenspartnerin vor sich hoch, so daß sie auf seinen Armen hing, gewissermaßen schwebte, und dann schüttelte und rüttelte, schüttelte und rüttelte er sie mit aller seiner Kraft. Mutter Kruppke wurde es ganz schwarz vor den Augen, ganz schwiemelig und blümerant, ganz mörr wurde ihr! Diese Tortur wurde dreimal vorgenommen! Nach einer längeren Pause — zum Verpusten — folgte dann die Massage des Rückgrates zu beiden Seiten der Wirbelsäule — des Riggenbengels — vom Nacken bis zum Stietz, jeweils in Richtung zum Herzen hin. Um besseres Gleiten zu bewirken, fettete Vater die Fingerspitzen, aber besonders den harten Daumen, gelinde mit Schmalz — „ungesalzene Butter oder auch Lein- und Rapsöl täten es ebenso wirksam“. — Die schmerzenden Stellen, die Ursachen, wurden auf diese Weise bald gefunden und diesen galt nun die vordringlichste Massage. Es sollten keine Knuddeln entstehen. Und siehe da! Nach kurzer Zeit atmete Mutter Kruppke wie erleichtert auf: ihr war es, als ob die quälenden Schmerzen nachließen und einem erlösenden Wohltun wichen. Nach einigen Stunden Ausruhens hatte sich das Stechen und Pieken fast ganz verzogen, ohne Bandajsche, um es kurz zu machen: Alle Familienmitglieder fühlten sich erlöst. Und — o Wunder — gegen Abend, am nächsten Tag, versuchte Mutter dankbar und fröhlich mit dem guten Vater einen vorsichtigen Tanz um den Eßtisch!
Die Sonne war wieder in der Familie Kruppke aufgegangen! Wille und Glauben hatten gesiegt! Auch die heutige Therapie und Technik wird wohl ohne dies eine „Sandkorn keine Berge versetzen können“! Mit diesem Sandkorn im Herzen erwachte nun Anna zu dem schönsten Tag ihres jungen Lebens! Draußen war sonnigstes Frühlingswetter und Hochzeitswetter!
Das war auch wünschenswert für die Zuschauer, schon gestern zum Polterabend und heute nun bei dem Gang zum Standesamt, vor allem bei dem Kirchgang und endlich bei der häuslichen Hochzeitsfeier. Junge und Alte waren gekommen: Großmütter, Mütter, heiratsfähige Töchter, die sich wohl das Muster abgucken sollten, Jungmädchen und Kinder. Sie hatten schon am Tage bei den nötigen Feiergängen die Straße gesäumt und Beifall gespendet und Glückwünsche dazugegeben. Aber mit dem sinkenden Tag und dem heraufkommenden Abend strömten die Gestalten dem Hochzeitshause zu; große Umschlagetücher umgaben Brust und Kopf, das Gesicht möglichst verbergend. Nur die Nasenspitzen schauten heraus und an der Nase entlang gluderten, glumsten, gluppschten und schwulten, kaum noch sichtbar, die Augen. Und die Stimmen hörte man tuscheln, naschjeln und nuschjeln. So stehen sie alle unter dem Fenster: die Kleinen vorn, die Größten dahinter, damit jeder zu seinem Recht komme. Sie dalschen, talpßen, tappßen, alkßen, rampenieren Mutter Kruppken die so sauber gepflegten und geharkten Gartenbeete und rungenieren Vater Kruppken den Gartenzaun. Koofmanns Muppe war noch nicht begänge; der trimmte sich auf dem Landsberger Bullewar, der Richtstraße, zu seiner Landpartie des Sommers. Am dollsten trieben es natürlich die jungen Burschen, die Jungkerls, diese Riedebolde, Ruppsacks, Schubbejakße und infamijchtn Quaddelfritzen! Auf Grund der Erfahrungen vom gestrigen Polterabend hatte Vater Kruppke die Porte (Hoftür) heute morgen fest mit einer Kette verrammelt. Molli, die alte Tache oder Schaule (Hündin) ist vom vielen Bellen ganz heesch (heiser) und ramdösig und kann nur noch japßen.
Und nun erst die ganz Unnützen unter den Zuschauern! Die schnekerten überall herum: sie stäkern und pettern nach dem Riegel an der Porte und piesacken, zerjeln und markein den Hund. Einer von der Bande hat seine Osterschnürrke mitgebracht und schnürrkt nach Molli und einmal sogar durch das Fenster auf die tanzenden, fröhlich trampßenden Hochzeitsgäste. Ein Driebaß hat in der Kute, hingern Stall, eine verfaulte Bruuke gefunden und wirft sie gegen die Zuschauer, so daß die Jitschke diesen die Kleider injuckst und die Tunke bis an das Fenster und sogar in die Stube spritzt. Laut auf krischen die Betroffenen!
Nun wird Vater Kruppke aber doch auch bossig: er möchte die Bengels an die Schlafitchen kriegen, sie verwalken und bietet durch das Fenster den Karnaljen eine Tachtel an. Von einer Tachtel aber wollten die Schubbejackße nichts wissen; dazu wären sie wohl nicht hergekommen; Krüppkes sollten man lieber Kuchen und einen Schluck und Zigarren und Zigaretten herausreichen! So murren und purren und prachern sie zuletzt alle! „Aber keine Kante!“ ruft dazu eine mickeriche Mädchenstimme aus dem Hintergrund.
Und Krüppkes lassen sich nun auch nicht lumpen! Bald hört man die Esser unter dem Fenster gnurpschen, gnurpßen, gnatschen, schmackßen und schmuckßen. „O, jemersch, die Äppel ßu eiern Kuchen sinn je maudicke jewest!“ weimert eine, die gerade ein vermalörtes Stück gefaßt hat. „Und Zucker is ooch nicht ville druff! Der Küche schmeckt doch ßu särp!“ tadelt eine Undankbare.
Der trockene Struselkuchen kreppt und krackt und darum verlangen die Zaungäste Trinkbares; Kaffee, aber keine Plürre! Und Seiter! Und natürlich auch Bier! Das alles wird ihnen zum Fenster hinausgereicht oder auch durch die Haustür gegeben. Aber nun geht der Krakeel erst richtig los! „Jie kennen wohl die Schlünke nicht vollkriejen!“ ruft Vater Kruppke damank. Die Allzueifrigen fangen schon an, sich um die Gaben zu strupeln und zu brangeln. Manch ein Schlurps und Schulps geht bei diesem Gehebbe und Jetuee auf die Erde nieder und wird verschilpert und veraast. Manchener trinkt zu jierig, er verschlickert sich und kriegt danach einen Schluckuff. Wer ganz nährig ist, der foomt, foopt und grappscht sich Eß- und Rauchbares krummdubbelich ein und das nicht immer die Taschen bloß leechvoll. Wenn es um die Fressajsche, um die Futterajsche geht, da fürchtet die Packajsche keine Blamajsche, da achten sie nicht auf die Kledajsche und haben zu den tollsten Verricktigchkeeten die nötige Kuhrajsche!
Nacht, späte Nacht, ist es unterdessen geworden; die Pitroljumlampen — damals! — gläsern, schmookn und kookeln. Die Zuschauer haben sachtekin nach und nach die Plätze unter dem Fenster geräumt und endlich nun sind die Hochzeiter und die Gäste für sich allein!
Es war ja aber auch genung des Feierns und der Aufregungen! Mancheinem sind die Augen schon längst kläterig und klackig; immerfort muß man in ihnen ribbeln und bribbeln! Die Kinder werden schon blarrig, quarrig und quängelich. Erwachsene, die es gewöhnt sind, mit den Hühnern zu Bett zu gehen, krabben, schringen und schubben sich die Faude, sie hujahnen und japßen und reißen unscharniert die Gusche auf; mancheiner ist hin und wieder schon injedrusselt.
Vom Tanzen — Scherbein — will kaum noch einer etwas wissen; die Schafkoppspieler unter den Unbedarften können kaum noch die Karten halten. Nicht einmal die Kaffeetafel nach Middernacht hat viel geholfen. Viele haben schon einen ölkopp; ihnen ist schwiemelich und miesepeterig, ohne daß sie die Schlorrn voll haben, und ohne dünne zu sein.
Die fünf Musikanten haben gegen Uhre viere morgens schon mehr als ein Dutzend Mal den Mondscheinwalzer und „Guter Mond“, ... und noch öfter „Nachhause, nachhause, nachhause gehn wir nicht!“ gespielt. Die Sonne will schon bald aufgehen, als die Letzten heimwärts turkeln, kruckßen und schwoaken: anjeschilpert und brejenklieterig.
Zu guter Letzt hat Anna ihr „Posie-Album“ aus der Schulzeit als Gästebuch herumgehen lassen, gewissermaßen zum Abschied von ihrer Kindheits- und Jugendzeit. Auf den letzten Seiten trugen sich „die Festteilnehmer“ „zum ewigen Gedächtnis“ ein; ... „und manche heiße Trähne fiel!“ Alle Gäste fühlten sich dabei mächtig jeboomfiedelt. Ein alter Onkel, Mutter Krüppkes ältester Bruder, schrieb da mit ungelenken Buchstaben, aber zwinkernden Auges:
„In frohen Zeiten, in harten Zeiten gläubig in die Zukunft schreiten! Und mit den Zeiten — Kleinigkeiten!“
zur Übersicht - RR «««