zur Übersicht - RR «««
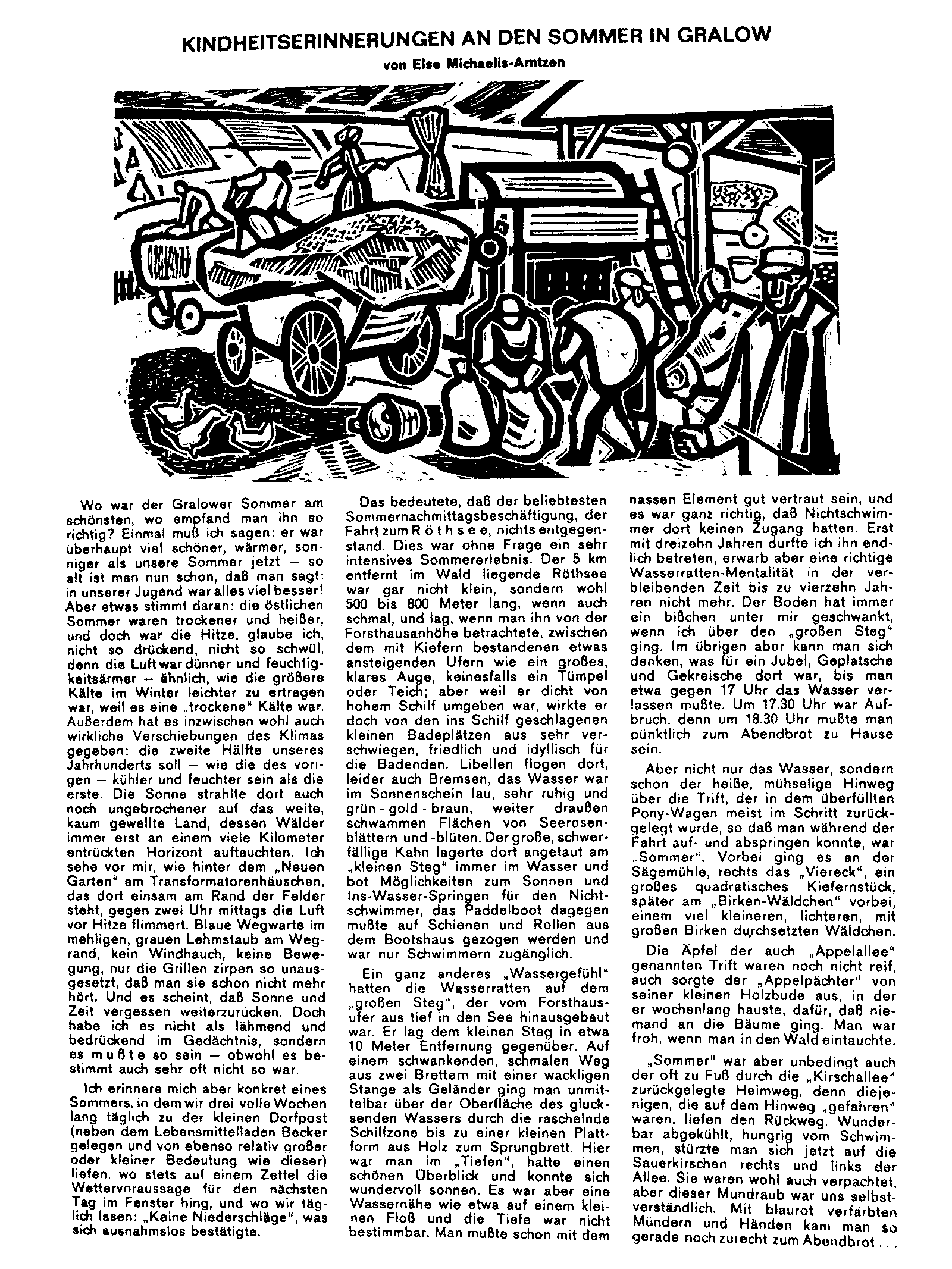
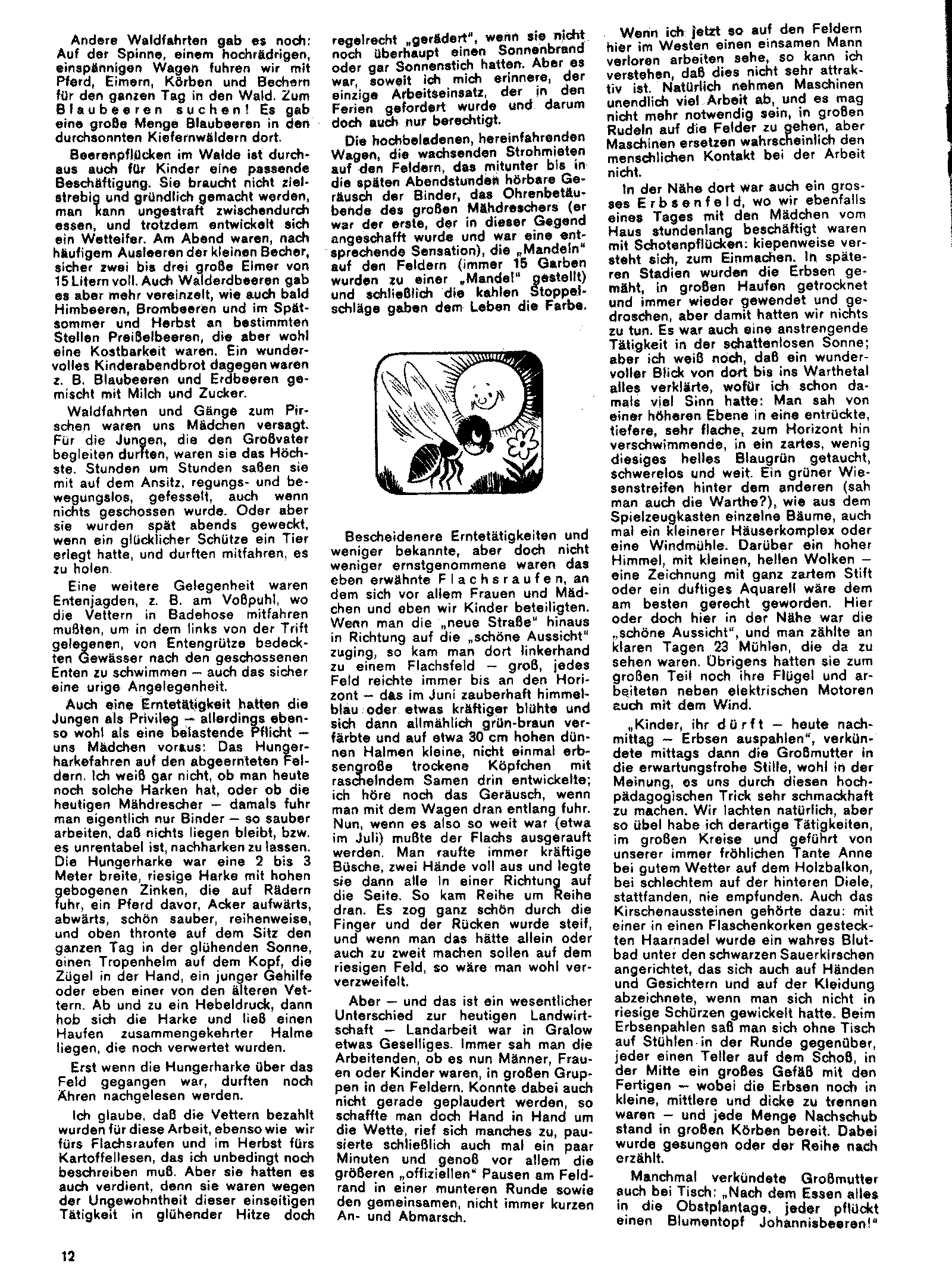
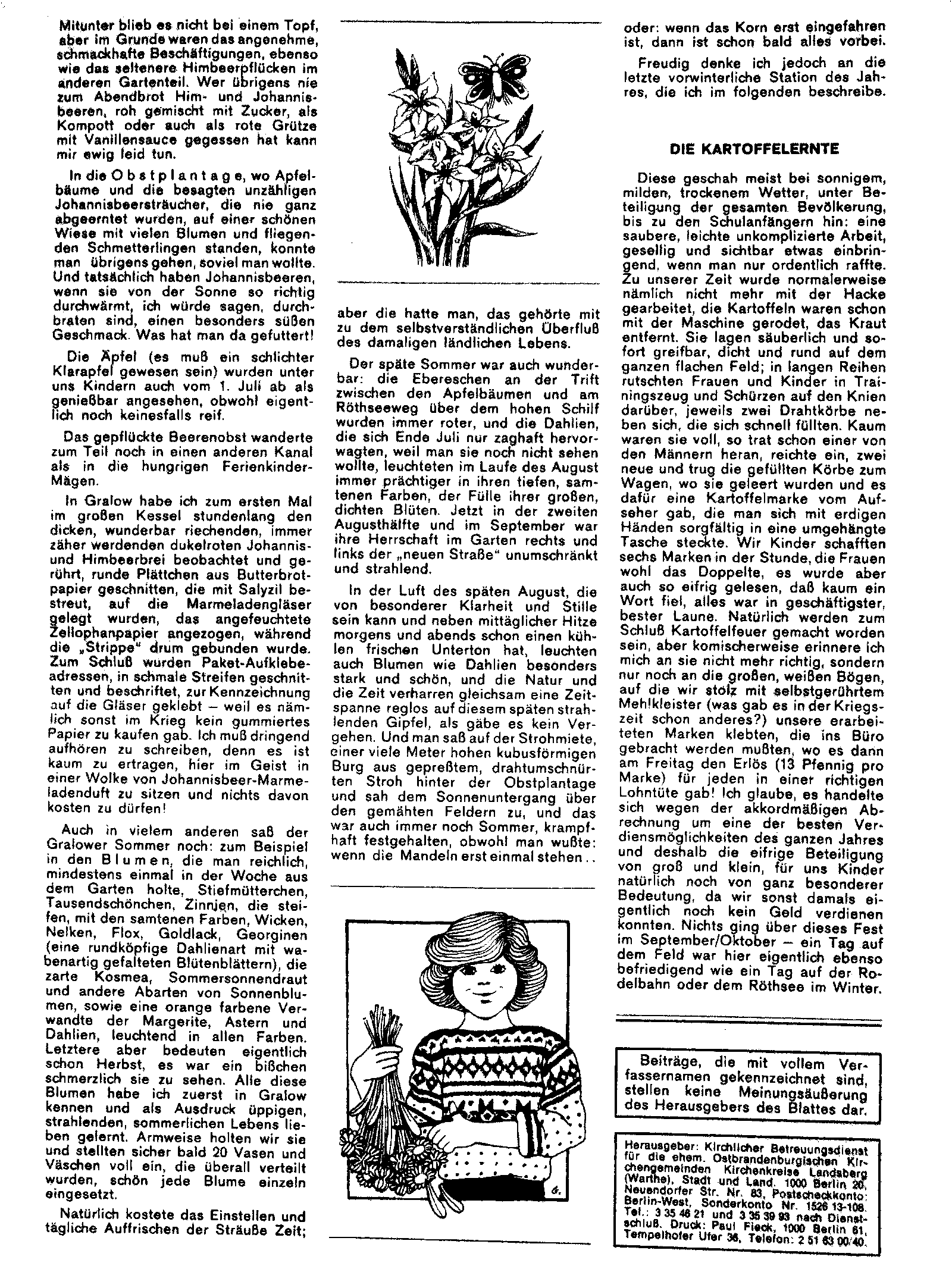
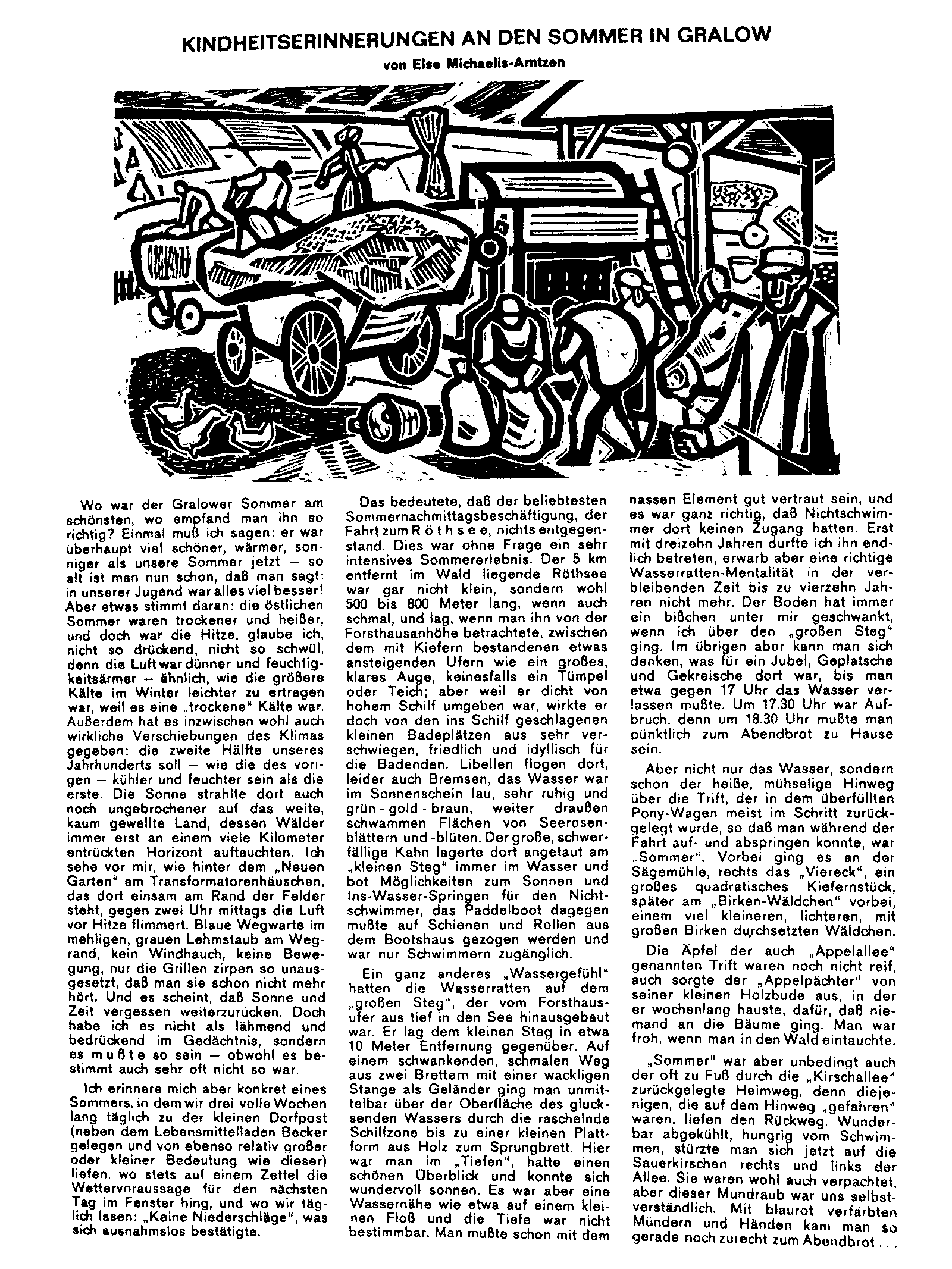
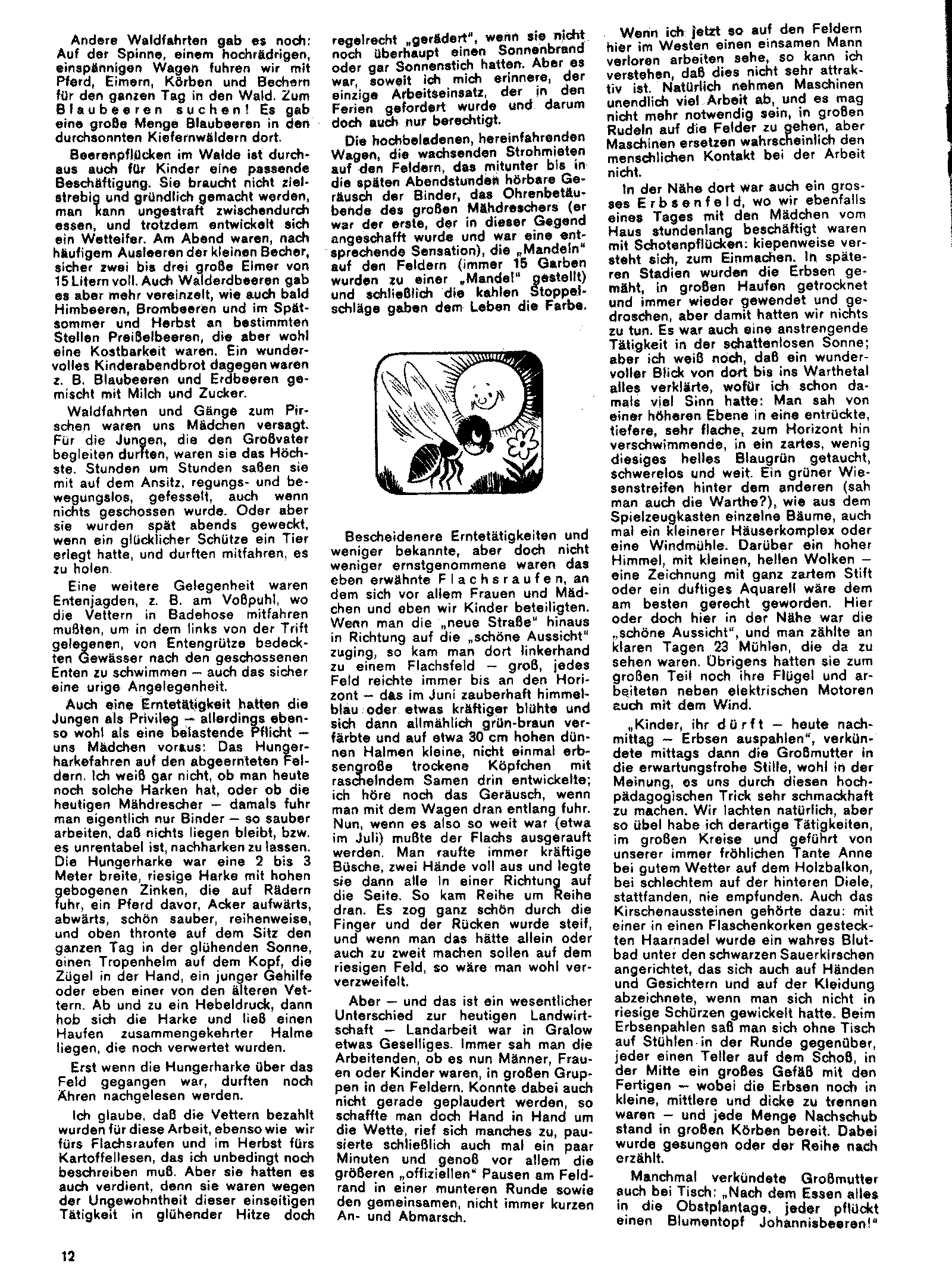
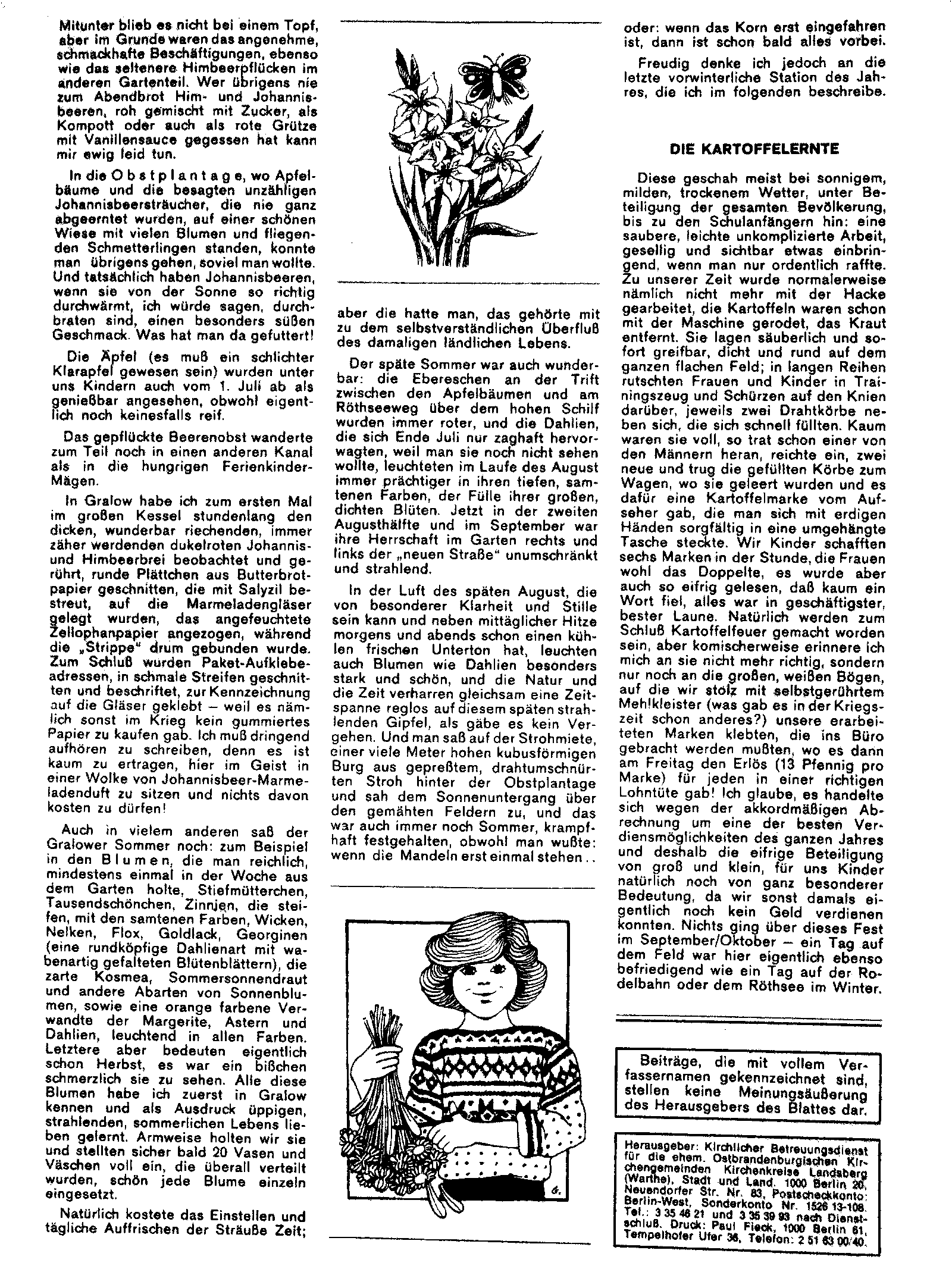
KINDHEITSERINNERUNGEN AN DEN SOMMER IN GRALOW
von Else Michaelis-Arntzen
Wo war der Gralower Sommer am schönsten, wo empfand man ihn so richtig? Einmal muß ich sagen: er war überhaupt viel schöner, wärmer, sonniger als unsere Sommer jetzt — so alt ist man nun schon, daß man sagt: in unserer Jugend war alles viel besser! Aber etwas stimmt daran: die östlichen Sommer waren trockener und heißer, und doch war die Hitze, glaube ich, nicht so drückend, nicht so schwül, denn die Luft war dünner und feuchtigkeitsärmer — ähnlich, wie die größere Kälte im Winter leichter zu ertragen war, weil es eine „trockene“ Kälte war. Außerdem hat es inzwischen wohl auch wirkliche Verschiebungen des Klimas gegeben: die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts soll - wie die des vorigen — kühler und feuchter sein als die erste. Die Sonne strahlte dort auch noch ungebrochener auf das weite, kaum gewellte Land, dessen Wälder immer erst an einem viele Kilometer entrückten Horizont auftauchten. Ich sehe vor mir, wie hinter dem „Neuen Garten“ am Transformatorenhäuschen, das dort einsam am Rand der Felder steht, gegen zwei Uhr mittags die Luft vor Hitze flimmert. Blaue Wegwarte im mehligen, grauen Lehmstaub am Wegrand, kein Windhauch, keine Bewegung, nur die Grillen zirpen so unausgesetzt, daß man sie schon nicht mehr hört. Und es scheint, daß Sonne und Zeit vergessen weiterzurücken. Doch habe ich es nicht als lähmend und bedrückend im Gedächtnis, sondern es mußte so sein — obwohl es bestimmt auch sehr oft nicht so war.
Ich erinnere mich aber konkret eines Sommers, in dem wir drei volle Wochen lang täglich zu der kleinen Dorfpost (neben dem Lebensmittelladen Becker gelegen und von ebenso relativ großer oder kleiner Bedeutung wie dieser) liefen, wo stets auf einem Zettel die Wettervoraussage für den nächsten Tag im Fenster hing, und wo wir täglich lasen: „Keine Niederschläge“, was sich ausnahmslos bestätigte. Das bedeutete, daß der beliebtesten Sommernachmittagsbeschäftigung, der Fahrt zum R ö t h s e e, nichts entgegenstand. Dies war ohne Frage ein sehr intensives Sommererlebnis. Der 5 km entfernt im Wald liegende Röthsee war gar nicht klein, sondern wohl 500 bis 800 Meter lang, wenn auch schmal, und lag, wenn man ihn von der Forsthausanhöhe betrachtete, zwischen dem mit Kiefern bestandenen etwas ansteigenden Ufern wie ein großes, klares Auge, keinesfalls ein Tümpel oder Teich; aber weil er dicht von hohem Schilf umgeben war, wirkte er doch von den ins Schilf geschlagenen kleinen Badeplätzen aus sehr verschwiegen, friedlich und idyllisch für die Badenden. Libellen flogen dort, leider auch Bremsen, das Wasser war im Sonnenschein lau, sehr ruhig und grün - gold - braun, weiter draußen schwammen Flächen von Seerosenblättern und -blüten. Der große, schwerfällige Kahn lagerte dort angetaut am „kleinen Steg“ immer im Wasser und bot Möglichkeiten zum Sonnen und Ins-Wasser-Springen für den Nichtschwimmer, das Paddelboot dagegen mußte auf Schienen und Rollen aus dem Bootshaus gezogen werden und war nur Schwimmern zugänglich.
Ein ganz anderes „Wassergefühl“ hatten die Wasserratten auf dem „großen Steg“, der vom Forsthausufer aus tief in den See hinausgebaut war. Er lag dem kleinen Steg in etwa 10 Meter Entfernung gegenüber. Auf einem schwankenden, schmalen Weg aus zwei Brettern mit einer wackligen Stange als Geländer ging man unmittelbar über der Oberfläche des glucksenden Wassers durch die raschelnde Schilfzone bis zu einer kleinen Plattform aus Holz zum Sprungbrett. Hier war man im „Tiefen“, hatte einen schönen Überblick und konnte sich wundervoll sonnen. Es war aber eine Wassernähe wie etwa auf einem kleinen Floß und die Tiefe war nicht bestimmbar. Man mußte schon mit dem nassen Element gut vertraut sein, und es war ganz richtig, daß Nichtschwimmer dort keinen Zugang hatten. Erst mit dreizehn Jahren durfte ich ihn endlich betreten, erwarb aber eine richtige Wasserratten-Mentalität in der verbleibenden Zeit bis zu vierzehn Jahren nicht mehr. Der Boden hat immer ein bißchen unter mir geschwankt, wenn ich über den „großen Steg“ ging. Im übrigen aber kann man sich denken, was für ein Jubel, Geplatsche und Gekreische dort war, bis man etwa gegen 17 Uhr das Wasser verlassen mußte. Um 17.30 Uhr war Aufbruch, denn um 18.30 Uhr mußte man pünktlich zum Abendbrot zu Hause sein.
Aber nicht nur das Wasser, sondern schon der heiße, mühselige Hinweg über die Trift, der in dem überfüllten Pony-Wagen meist im Schritt zurückgelegt wurde, so daß man während der Fahrt auf- und abspringen konnte, war „Sommer“. Vorbei ging es an der Sägemühle, rechts das „Viereck“, ein großes quadratisches Kiefernstück, später am „Birken-Wäldchen“ vorbei, einem viel kleineren, lichteren, mit großen Birken durchsetzten Wäldchen.
Die Äpfel der auch „Appelallee“ genannten Trift waren noch nicht reif, auch sorgte der „Appelpächter“ von seiner kleinen Holzbude aus, in der er wochenlang hauste, dafür, daß niemand an die Bäume ging. Man war froh, wenn man in den Wald eintauchte.
„Sommer“ war aber unbedingt auch der oft zu Fuß durch die „Kirschallee“ zurückgelegte Heimweg, denn diejenigen, die auf dem Hinweg „gefahren“ waren, liefen den Rückweg. Wunderbar abgekühlt, hungrig vom Schwimmen, stürzte man sich jetzt auf die Sauerkirschen rechts und links der Allee. Sie waren wohl auch verpachtet, aber dieser Mundraub war uns selbstverständlich. Mit blaurot verfärbten Mündern und Händen kam man so gerade noch zurecht zum Abendbrot.
Andere Waldfahrten gab es noch: Auf der Spinne, einem hochrädrigen, einspännigen Wagen fuhren wir mit Pferd, Eimern, Körben und Bechern für den ganzen Tag in den Wald. Zum Blaubeeren suchen ! Es gab eine große Menge Blaubeeren in den durchsonnten Kiefernwäldern dort.
Beerenpflücken im Walde ist durchaus auch für Kinder eine passende Beschäftigung. Sie braucht nicht zielstrebig und gründlich gemacht werden, man Kann ungestraft zwischendurch essen, und trotzdem entwickelt sich ein Wetteifer. Am Abend waren, nach häufigem Ausleeren der kleinen Becher, sicher zwei bis drei große Eimer von 15 Litern voll. Auch Walderdbeeren gab es aber mehr vereinzelt, wie auch bald Himbeeren, Brombeeren und im Spätsommer und Herbst an bestimmten Stellen Preißelbeeren, die aber wohl eine Kostbarkeit waren. Ein wundervolles Kinderabendbrot dagegen waren z. B. Blaubeeren und Erdbeeren gemischt mit Milch und Zucker.
Waldfahrten und Gange zum Pirschen waren uns Mädchen versagt. Für die Jungen, die den Großvater begleiten durften, waren sie das Höchste. Stunden um Stunden saßen sie mit auf dem Ansitz, regungs- und bewegungslos, gefesselt, auch wenn nichts geschossen wurde. Oder aber sie wurden spät abends geweckt, wenn ein glücklicher Schütze ein Tier erlegt hatte, und durften mitfahren, es zu holen Eine weitere Gelegenheit waren Entenjagden, z. B. am Voßpuhl. wo die Vettern in Badehose mitfahren mußten, um in dem links von der Trift gelegenen, von Entengrütze bedeckten Gewässer nach den geschossenen Enten zu schwimmen — auch das sicher eine urige Angelegenheit.
Auch eine Erntetätigkeit hatten die Jungen als Privileg — allerdings ebenso wohl als eine belastende Pflicht — uns Mädchen vorsus: Das Hungerharkefahren auf den abgeernteten Feldern. Ich weiß gar nicht, ob man heute noch solche Harken hat, oder ob die heutigen Mähdrescher — damals fuhr man eigentlich nur Binder — so sauber arbeiten, daß nichts liegen bleibt, bzw. es unrentabel ist, nachharken zu lassen. Die Hungerharke war eine 2 bis 3 Meter breite, riesige Harke mit hohen gebogenen Zinken, die auf Rädern fuhr, ein Pferd davor, Acker aufwärts, abwärts, schön sauber, reihenweise, und oben thronte auf dem Sitz den ganzen Tag in der glühenden Sonne, einen Tropenhelm auf dem Kopf, die Zügel in der Hand, ein junger Gehilfe oder eben einer von den älteren Vettern. Ab und zu ein Hebeldruck, dann hob sich die Harke und ließ einen Haufen zusammengekehrter Halme liegen, die noch verwertet wurden.
Erst wenn die Hungerharke über das Feld gegangen war. durften noch Ähren nachgelesen werden.
Ich glaube, daß die Vettern bezahlt wurden für diese Arbeit, ebenso wie wir fürs Flachsraufen und im Herbst fürs Kartoffellesen, das ich unbedingt noch beschreiben muß. Aber sie hatten es auch verdient, denn sie waren wegen der Ungewohntheit dieser einseitigen Tätigkeit in glühender Hitze doch regelrecht „gerädert“, wenn sie nicht noch überhaupt einen Sonnenbrand oder gar Sonnenstich hatten. Aber es war, soweit ich mich erinnere, der einzige Arbeitseinsatz, der in den Ferien gefordert wurde und darum doch auch nur berechtigt.
Die hochbeladenen, hereinfahrenden Wagen, die wachsenden Strohmieten auf den Feldern, das mitunter bis in die späten Abendstunden hörbare Geräusch der Binder, das Ohrenbetäubende des großen Mähdreschers (er war der erste, der in dieser Gegend angeschafft wurde und war eine entsprechende Sensation), die „Mandeln“ auf den Feldern (immer 15 Garben wurden zu einer „Mandel“ gestellt) und schließlich die kahlen Stoppelschläge gaben dem Leben die Farbe.
Bescheidenere Erntetätigkeiten und weniger bekannte, aber doch nicht weniger ernstgenommene waren das eben erwähnte Flachsraufen, an dem sich vor allem Frauen und Mädchen und eben wir Kinder beteiligten. Wenn man die „neue Straße“ hinaus in Richtung auf die „schöne Aussicht“ zuging, so kam man dort linkerhand zu einem Flachsfeld — groß, jedes Feld reichte immer bis an den Horizont — das im Juni zauberhaft himmelblau oder etwas kräftiger blühte und sich dann allmählich grün-braun verfärbte und auf etwa 30 cm hohen dünnen Halmen kleine, nicht einmal erbsengroße trockene Köpfchen mit raschelndem Samen drin entwickelte; ich höre noch das Geräusch, wenn man mit dem Wagen dran entlang fuhr. Nun, wenn es also so weit war (etwa im Juli) mußte der Flachs ausgerauft werden. Man raufte immer kräftige Büsche, zwei Hände voll aus und legte sie dann alle in einer Richtung auf die Seite. So kam Reihe um Reihe dran. Es zog ganz schön durch die Finger und der Rücken wurde steif, und wenn man das hätte allein oder auch zu zweit machen sollen auf dem riesigen Feld, so wäre man wohl ververzweifelt.
Aber — und das ist ein wesentlicher Unterschied zur heutigen Landwirtschaft — Landarbeit war in Gralow etwas Geselliges. Immer sah man die Arbeitenden, ob es nun Männer, Frauen oder Kinder waren, in großen Gruppen in den Feldern. Konnte dabei auch nicht gerade geplaudert werden, so schaffte man doch Hand in Hand um die Wette, rief sich manches zu, pausierte schließlich auch mal ein paar Minuten und genoß vor allem die größeren „offiziellen“ Pausen am Feldrand in einer munteren Runde sowie den gemeinsamen, nicht immer kurzen An- und Abmarsch.
Wenn ich jetzt so auf den Feldern hier im Westen einen einsamen Mann verloren arbeiten sehe, so kann ich verstehen, daß dies nicht sehr attraktiv ist. Natürlich nehmen Maschinen unendlich viel Arbeit ab, und es mag nicht mehr notwendig sein, in großen Rudeln auf die Felder zu gehen, aber Maschinen ersetzen wahrscheinlich den menschlichen Kontakt bei der Arbeit nicht.
In der Nähe dort war auch ein grosses Erbsenfeld, wo wir ebenfalls eines Tages mit den Mädchen vom Haus stundenlang beschäftigt waren mit Schotenpflücken: kiepenweise versteht sich, zum Einmachen. In späteren Stadien wurden die Erbsen gemäht, in großen Haufen getrocknet und immer wieder gewendet und gedroschen, aber damit hatten wir nichts zu tun. Es war auch eine anstrengende Tätigkeit In der schattenlosen Sonne; aber ich weiß noch, daß ein wundervoller Blick von dort bis ins Warthetal alles verklärte, wofür ich schon damals viel Sinn hatte: Man sah von einer höheren Ebene in eine entrückte, tiefere, sehr flache, zum Horizont hin verschwimmende, in ein zartes, wenig diesiges helles Blaugrün getaucht, schwerelos und weit. Ein grüner Wiesenstreifen hinter dem anderen (sah man auch die Warthe?). wie aus dem Spielzeugkasten einzelne Bäume, auch mal ein kleinerer Häuserkomplex oder eine Windmühle. Darüber ein hoher Himmel, mit kleinen, hellen Wolken — eine Zeichnung mit ganz zartem Stift oder ein duftiges Aquarell wäre dem am besten gerecht geworden. Hier oder doch hier in der Nähe war die „schöne Aussicht“, und man zählte an klaren Tagen 23 Mühlen, die da zu sehen waren. Übrigens hatten sie zum großen Teil noch ihre Flügel und arbeiteten neben elektrischen Motoren auch mit dem Wind.
„Kinder, ihr dürft — heute nachmittag — Erbsen auspahlen“, verkündete mittags dann die Großmutter in die erwartungsfrohe Stille, wohl in der Meinung, es uns durch diesen hochpädagogischen Trick sehr schmackhaft zu machen. Wir lachten natürlich, aber so übel habe ich derartige Tätigkeiten, im großen Kreise und geführt von unserer immer fröhlichen Tante Anne bei gutem Wetter auf dem Holzbalkon, bei schlechtem auf der hinteren Diele, stattfanden, nie empfunden. Auch das Kirschenaussteinen gehörte dazu: mit einer in einen Flaschenkorken gesteckten Haarnadel wurde ein wahres Blutbad unter den schwarzen Sauerkirschen angerichtet, das sich auch auf Händen und Gesichtern und auf der Kleidung abzeichnete, wenn man sich nicht in riesige Schürzen gewickelt hatte Beim Erbsenpahlen saß man sich ohne Tisch auf Stühlen in der Runde gegenüber, jeder einen Teller auf dem Schoß, in der Mitte ein großes Gefäß mit den Fertigen - wobei die Erbsen noch in kleine, mittlere und dicke zu trennen waren - und jede Menge Nachschub stand in großen Körben bereit. Dabei wurde gesungen oder der Reihe nach erzählt. Manchmal verkündete Großmutter auch bei Tisch: „Nach dem Essen alles in die Obstplantage, jeder pflückt einen Blumentopf Johannisbeeren!“
Mitunter blieb es nicht bei einem Topf, aber im Grunde waren das angenehme, schmackhafte Beschäftigungen, ebenso wie das seltenere Himbeerpflücken im anderen Gartenteil. Wer übrigens nie zum Abendbrot Him- und Johannisbeeren, roh gemischt mit Zucker, als Kompott oder auch als rote Grütze mit Vanillensauce gegessen hat kann mir ewig leid tun.
In die O b s t p l a n t a g e, wo Apfelbäume und die besagten unzähligen Johannisbeersträucher, die nie ganz abgeerntet wurden, auf einer schönen Wiese mit vielen Blumen und fliegenden Schmetterlingen standen, konnte man übrigens gehen, soviel man wollte. Und tatsachlich haben Johannisbeeren, wann sie von der Sonne so richtig durchwärmt, ich würde sagen, durchbraten sind, einen besonders süßen Geschmack. Was hat man da gefuttert!
Die Äpfel (es muß ein schlichter Klarapfel gewesen sein) wurden unter uns Kindern auch vom 1. Juli ab als genießbar angesehen, obwohl eigentlich noch keinesfalls reif.
Das gepflückte Beerenobst wanderte zum Teil noch in einen anderen Kanal als in die hungrigen Ferienkinder-Mägen.
In Gralow habe ich zum ersten Mal im großen Kessel stundenlang den dicken, wunderbar riechenden, immer zäher werdenden dukelroten Johannis- und Himbeerbrei beobachtet und gerührt, runde Plättchen aus Butterbrotpapier geschnitten, die mit Salyzil bestreut, auf die Marmeladengläser gelegt wurden, das angefeuchtete Zellophanpapier angezogen, während die „Strippe“ drum gebunden wurde. Zum Schluß wurden Paket-Aufklebeadressen, in schmale Streifen geschnitten und beschriftet, zur Kennzeichnung auf die Gläser geklebt — weil es nämlich sonst im Krieg kein gummiertes Papier zu kaufen gab. Ich muß dringend aufhören zu schreiben, denn es ist kaum zu ertragen, hier im Geist in einer Wolke von Johannisbeer-Marmeladenduft zu sitzen und nichts davon kosten zu dürfen!
Auch in vielem anderen saß der Gralower Sommer noch: zum Beispiel in den Blumen, die man reichlich, mindestens einmal in der Woche aus dem Garten holte, Stiefmütterchen, Tausendschönchen, Zinnjen, die steifen, mit den samtenen Farben, Wicken. Nelken, Flox, Goldlack, Georginen (eine rundköpfige Dahlienart mit wabenartig gefalteten Blütenblättern}, die zarte Kosmea, Sommersonnendraut und andere Abarten von Sonnenblumen, sowie eine orange farbene Verwandte der Margerite, Astern und Dahlien, leuchtend in allen Farben. Letztere aber bedeuten eigentlich schon Herbst, es war ein bißchen schmerzlich sie zu sehen. Alle diese Blumen habe ich zuerst in Gralow kennen und als Ausdruck üppigen, strahlenden, sommerlichen Lebens lieben gelernt. Armweise holten wir sie und stellten sicher bald 20 Vasen und Väschen voll ein, die überall verteilt wurden, schön jede Blume einzeln eingesetzt.
Natürlich kostete das Einstellen und tägliche Auffrischen der Sträuße Zeit; aber die hatte man, das gehörte mit zu dem selbstverständlichen Überfluß des damaligen ländlichen Lebens.
Der späte Sommer war auch wunderbar: die Ebereschen an der Trift zwischen den Apfelbäumen und am Röthseeweg über dem hohen Schilf wurden immer roter, und die Dahlien, die sich Ende Juli nur zaghaft hervorwagten, weil man sie noch nicht sehen wollte, leuchteten im Laufe des August immer prächtiger in ihren tiefen, samtenen Farben, der Fülle ihrer großen, dichten Blüten. Jetzt in der zweiten Augusthälfte und im September war ihre Herrschaft im Garten rechts und links der „neuen Straße“ unumschränkt und strahlend.
In der Luft des späten August, die von besonderer Klarheit und Stille sein kann und neben mittäglicher Hitze morgens und abends schon einen kühlen frischen Unterton hat, leuchten auch Blumen wie Dahlien besonders stark und schön, und die Natur und die Zeit verharren gleichsam eine Zeitspanne reglos auf diesem späten strahlenden Gipfel, als gäbe es kein Vergehen. Und man saß auf der Strohmiete, einer viele Meter hohen kubusförmigen Burg aus gepreßtem, drahtumschnürten Stroh hinter der Obstplantage und sah dem Sonnenuntergang über den gemähten Feldern zu, und das war auch immer noch Sommer, krampfhaft festgehalten, obwohl man wußte: wenn die Mandeln erst einmal stehen ... oder wenn das Korn erst eingefahren ist, dann ist schon bald alles vorbei. Freudig denke ich jedoch an die letzte vorwinterliche Station des Jahres, die ich im folgenden beschreibe.
DIE KARTOFFELERNTE
Diese geschah meist bei sonnigem, milden, trockenem Wetter, unter Beteiligung der gesamten Bevölkerung, bis zu den Schulanfängern hin: eine saubere, leichte unkomplizierte Arbeit, gesellig und sichtbar etwas einbringend, wenn man nur ordentlich raffte. Zu unserer Zeit wurde normalerweise nämlich nicht mehr mit der Hacke gearbeitet, die Kartoffeln waren schon mit der Maschine gerodet, das Kraut entfernt. Sie lagen säuberlich und sofort greifbar, dicht und rund auf dem ganzen flachen Feld; in langen Reihen rutschten Frauen und Kinder in Trainingszeug und Schürzen auf den Knien darüber, jeweils zwei Drahtkörbe neben sich, die sich schnell füllten. Kaum waren sie voll, so trat schon einer von den Männern heran, reichte ein, zwei neue und trug die gefüllten Körbe zum Wagen, wo sie geleert wurden und es dafür eine Kartoffelmarke vom Aufseher gab, die man sich mit erdigen Händen sorgfältig in eine umgehängte Tasche steckte. Wir Kinder schafften sechs Marken in der Stunde, die Frauen wohl das Doppelte, es wurde aber auch so eifrig gelesen, daß kaum ein Wort fiel, alles war in geschäftigster, bester Laune. Natürlich werden zum Schluß Kartoffelfeuer gemacht worden sein, aber komischerweise erinnere ich mich an sie nicht mehr richtig, sondern nur noch an die großen, weißen Bögen, auf die wir stolz mit selbstgerührtem Mehlkleister (was gab es in der Kriegszeit schon anderes?) unsere erarbeiteten Marken klebten, die ins Büro gebracht werden mußten, wo es dann am Freitag den Erlös (13 Pfennig pro Marke) für jeden in einer richtigen Lohntüte gab! Ich glaube, es handelte sich wegen der akkordmäßigen Abrechnung um eine der besten Verdiensmöglichkeiten des ganzen Jahres und deshalb die eifrige Beteiligung von groß und klein, für uns Kinder natürlich noch von ganz besonderer Bedeutung, da wir sonst damals eigentlich noch kein Geld verdienen konnten. Nichts ging über dieses Fest im September/Oktober — ein Tag auf dem Feld war hier eigentlich ebenso befriedigend wie ein Tag auf der Rodelbahn oder dem Röthsee im Winter.
Beiträge, die mit vollem Verfassernamen gekennzeichnet sind, stellen keine Meinungsäußerung des Herausgebers des Blattes dar.
Herausgeber: Kirchlicher Betreuungsdienst für die ehem. Ostbrandenburgischen Kirchengemeinden Kirchenkreise Landsberg (Warthe). Stadt und Land. 1000 Berlin 20, Neuendorfer Str. Nr 83.
Erstellt am 04.10.2016 - Letzte Änderung am 04.10.2016.